Erlebnis Naturerbe
Geoinformationstechnologien gewinnen im Bereich des Tourismus zunehmend an Bedeutung. Durch die rasante Entwicklung innovativer Hard- und Softwarelösungen können ehemals statische und analoge Daten dynamischer und ortsabhängig zur Verfügung gestellt werden. In der Kombination von Naturschutz und Tourismus werden die Potenziale dieser sogenannten ortabhängigen Diensten (Location Based Services = LBS) bisher nicht ausgeschöpft.
Die hier vorgestellten Arbeiten greifen diese Ansätze auf und kombinieren Naturschutzthemen und Routingwerkzeuge, um Naturerleben zu ermöglichen. Ziel ist die nachhaltige und verträgliche Erschließung des über das Schutzgebietssystem Natura 2000 geschützten europäischen Naturerbes mittels moderner Geoinformationstechnologien. Hierzu werden die Naturschutzinformationen thematisch aufbereitet und über gemeinsame Eigenschaften in Verbindung gebracht. Diese werden dann in einem Netzwerk visualisiert, mit einem Rundrouting-Algorithmus kombiniert und per Smartphone-Applikation und Webportal zur Verfügung gestellt. Der Anwender der Applikation kann damit ausgewählte Naturerlebnis-Themen für seine Tourenplanung nutzen. In diesem Beitrag werden das Konzept zur Erarbeitung und Vermittlung der Naturthemen, die Visualisierung per Netzwerk und die thematische Rundroutenberechnung näher erläutert.
Natural Heritage as Adventure – Imparting nature conservation themes with the help of geoinformation technologies
Geoinformatics are gaining increasing importance in the tourism sector. The rapid development of innovative hardware and software solutions has caused a shift from analogue and static information to highly dynamic data provision refering to the location of the user. For the combination of nature conservation and tourism the potentials of ‘Location Based Services’ (LBS) have not been fully exploited yet.
The projects presented here combine environmental topics and routing tools for nature experience, with the aim to use modern geoinformation technologies to support a sustainable tourism access to the natural heritage protected under Natura 2000. In order to reach this aim nature topics are defined and related to each other via common elements. They are visualized in a thematic network and combined with round-trip routing algorithms. They are accessible via web portal or a respective smartphone application. The user can select and combine several natural topics of interest to setup optimized nature travel routes.
The paper describes the concept of how to setup and link the natural heritage information and its technical implementation in a thematic network and routing application.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Der Einfluss von Geoinformationstechnologien im Bereich Tourismus nimmt stetig zu. Mobile Navigation im Auto und auf dem Mobiltelefon zu Fuß und dem Rad sowie mobile Museums- und Naturparkführer sind nur einige Beispiele. Durch innovative Hard- und Softwarelösungen kommt es zu einer zunehmenden Verlagerung ehemals analoger statischer Informationen hin zu digitalen dynamischen Inhalten, die dem Touristen multimedial zur Verfügung gestellt werden. Solche ortsbezogenen Dienste (Location Based Services = LBS) liefern somit eine Informations-Dienstleistung auf Basis der räumlichen Lage des Nutzers mit Hilfe mobiler Kommunikationsnetzwerke (z.B. Mobilfunk, Internet) und mobiler Endgeräte (z.B. Mobiltelefon). Mit der zunehmenden Marktdurchdringung von mobilen Smartphones und Tablets werden sehr hohe Marktpotenziale für LBS in den nächsten Jahren prognostiziert (BLM 2013). Die neuen technischen Möglichkeiten dieser Geräte ermöglichen Touristen eine Vielzahl von Funktionen, die nachweislich die touristischen Erfahrungen beeinflussen können (Wang et al. 2012). Multimediale Informationen können zu verschiedenen Zeitpunkten (in der Reiseplanung oder vor Ort) über solche mobilen Applikationen (Apps) zur Verfügung gestellt werden und dienen der Orientierung und der Information über Sehenswürdigkeiten, aktuelle Ereignisse und Erfahrungen anderer Touristen (Burghardt et al. 2003, Edwards et al. 2006, Raper et al. 2007a).
Während mobile ortsbezogene Informationssysteme in vielen Großstädten zum festen Tourismusangebot gehören, wird deren Potenzial im Naturschutz nicht ausgenutzt. Bisher setzten vor allem Experten und Fachliebhaber mobile Geo-Applikationen ein, z.B. in der digitalen Artenerfassung im Gelände (Aden et al. 2011, 2013) oder zur Meldung von Naturbeobachtungen direkt an amtliche Stellen, etwa der Standorte von Altbäumen, Alleen oder Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten (LANUV 2012). Dabei wird das Image der Natur genutzt, um die Attraktivität einer Region zu erhöhen. Fast die Hälfte aller Wanderer (45 %) als eine Zielgruppe dieser Entwicklungen nennen als spontane Assoziation das Naturerlebnis (Neumeyer & Dicks 2010: 34).
Die Vermittlung dieser besonderen Natureigenschaften erfolgt jedoch auf Webportalen des Naturschutzes oftmals rein informativ. So bietet das Informationsportal EyeonEarth der Europäischen Umweltagentur ( http://www.eyeonearth.org ) vielfältige Web2.0-Funktionen (Blogs, Tweets, interaktive Karten) zur Darstellung und Vermittlung von Umweltinformationen an. Das Webportal Natura2000Viewer ( http://natura2000.eea.europa.eu/# ) wiederum ist eine reine Kartenanwendung zur Darstellung der europäischen Schutzgebietsnetzwerks und der amtlichen Gebietsinformationen. Darüber hinaus werden Naturschutz-Applikationen und Webportale nur von einem an naturschutzfachlichen Inhalten a priori interessierten Personenkreis genutzt. Für die große Mehrheit der Bevölkerung scheinen sie jedoch ebenso unbekannt wie unattraktiv, da sie sich nur sehr wenig mit den Lebenswelten der Allgemeinheit decken. Partizipative Portale richten sich an kultur- und naturschutzfachlich Interessierte zum Aufbau von Datenbasen, z.B. das Kulturlandschafts-Wiki KLEKS ( http://www.kleks-online.de/ ). Mobile Applikationen zum Naturerleben sind zwar oftmals multimedial aufbereitet und bieten somit einen GPS-gestützten Reiseführer an, die präsentierten Inhalte und Routen lassen sich aber nicht nach individuellen Naturinteressen anpassen (z.B. die App Erlesene Natur https://itunes.apple.com/de/app/erlesene-natur/id500042927?mt=8 ).
Bestehende touristische Routing-Webportale für Radfahrer oder Wanderer bieten hingegen keine Berührungspunkte zu Naturschutz-Themen an bzw. es fehlt die Möglichkeit, diese angebotenen Informationen individuell zu einer Wanderungen oder Familienradtouren auf Basis von Naturschutzdaten zusammenzustellen. Portale zu Themen wie „Naturfreude“ ( http://www.naturfreude-erleben.de/Touren/ ) oder „Natur aktiv erleben“ berücksichtigen nicht fachlich begründete Naturschutzanliegen (z.B. schützenswerte Landschaften, Arten), sondern reduzieren das Naturerleben in der Regel auf Touren innerhalb reizvoller Landschaften. Aktivitäten bezogene Portale wie z.B. http://www.bikemap.net oder das Tourenportal des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( http://www.adfc-tourenportal.de ) stellen lediglich vordefinierte Routen per Download zur Verfügung. Werkzeuge zur individuellen Routenberechnung (über Start-, Ziel- und Zwischenpunkte) finden sich z.B. auf den landesweiten Routenplaner für Wandern und Radfahren in Nordrhein-Westfalen ( http://www.radroutenplaner.nrw.de, http://www.wanderroutenplaner.nrw.de ). Jedoch ist es auch hier nicht möglich, die Routenberechnung thematisch (z.B. nach Naturerlebnis und Naturschutzthemen) zu gewichten.
Ziel des durch die Europäische Union und das Land NRW unterstützten Kooperationsprojekts „FFH-Identitäten vernetzen – Westfälisches Naturerbe kennen und erleben“ (Erlebnis Naturerbe) ist es, mittels moderner GIS-, GPS- und Kommunikationstechnologien die nachhaltige und verträgliche Erschließung des über die EU-Direktive Natura 2000 (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie, FFH, EC 1992) geschützten europäischen Naturerbes zum Zwecke der landschaftsbezogenen Erholung zu fördern und auf diese Weise den Tourismus zu stärken. Mit dem Schutzgebietssystem Natura 2000 verbindet die Europäische Union (EU) das Ziel, den Artenschwund und den Verlust der biologischen Vielfalt gemäß der international anerkannten Zielvorgaben zu stoppen.
So stellt sich für die Naturvermittlung und -bildung zunächst die Frage, wie breite Schichten der Bevölkerung an das Thema Naturschutz und Biodiversität herangeführt werden können. Inhaltlich sollen nicht nur naturtouristische Ziele als Kulisse für Freizeitaktivitäten dienen (Bundesamt für Naturschutz 2013), es soll vielmehr ein konkreter Beitrag zur Naturbildung geleistet werden.
Kerngedanke des Projekts ist es, Wissen über Natura 2000 in eine mobile Applikations-Umgebung erlebniswirksam einzubringen. Damit sollen Naturschutz-Themen informativ aufbereitet und über eine Routingapplikation auch erlebbar gestaltet werden. Für das Projekt sind ein Web-Portal, eingebettet in ein Content Management System, und eine plattformübergreifende mobile Applikation vorgesehen, die in den Funktionen für die Benutzer im Allgemeinen übereinstimmen.
Der vorliegende Beitrag beschreibt die ersten Ergebnisse dieses Projekts zur Aufarbeitung vorhandener Naturschutzdaten für mobilen Applikationen, Definition von regionalen Naturlebnisthemen und Vermittlung dieser Themen innerhalb einer mobilen Applikation und eines Webportals mit Hilfe einer interaktiven Themennetz-Darstellung. Um die Naturschutz-Themen in Form einer Radtour erlebbar zu machen, wurde ein Rundrouting-Algorithmus implementiert, der auf Basis individuell ausgewählter Naturthemen optimierte Rundrouten berechnet. Exemplarisch wurden die Methoden im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen umgesetzt.
2 Methoden
2.1 Ausarbeitung der Naturschutzthemen
Das Erkennen von FFH-Gebieten ist für den Besucher nicht immer möglich, da die Beschilderung der Gebiete unzureichend ist (Gunkel 2012). Ausnahmen bilden beispielsweise Moore oder Heidegebiete, welche durch Lehrpfade erschlossen oder durch eine entsprechende Beschilderung ausgestattet sind. Dass aber die häufig anzutreffenden und daher für den Besucher „gewohnten“ Buchenwälder auch Bestandteil eines Schutzgebietssystems sein können, erschließt sich nicht auf den ersten Blick und kann auch nicht mit dem Argument des Besonderen oder Seltenen begründet werden. So stellt sich für die Naturvermittlung und -bildung zunächst die Frage, wie breite Schichten der Bevölkerung an das Thema Naturschutz und Biodiversität herangeführt werden können. Um der Aufgabenstellung gerecht zu werden, den Nutzern von Apps und Webportalen Naturschutzthemen unaufdringlich nahe zu bringen und ein tieferes Verständnis für die Landschaft des zentralen Münsterlandes zu erzeugen, wurden von der inhaltlichen Seite vier Bausteine abgearbeitet.
(1) Zusammenstellung der Grundlagendaten und Auswertung der vorhandenen Kenntnisse über die Schutzgebietskulisse: Zunächst wurden allgemein verfügbare Karteninformationen, für das Projekt zur Verfügung gestellte Geodaten (z.B. die Landschaftsinformationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) sowie die beim Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V. niedergelegten Daten und Informationen) sowie die Kenntnisse der Naturschutzfachbehörden aufgenommen. Darüber hinaus wurden einschlägig arbeitende Institutionen wie die Geographische Kommission für Westfalen oder das Naturkundemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und weitere Experten zum Thema Naturerlebnis im Kreis Coesfeld befragt. Diese Informationen wurden in die notwendigen Geodatenformate überführt und bei Bedarf im Gelände ergänzt (Tab. 1).
(2) historische Analyse: Über eine Literatur- und Medienauswertung wurden die für die Ausgestaltung der Naturschutz-Themen und möglichen Routen erforderlichen lokalen Informationen erarbeitet. Basierend auf den dort zusammengestellten Quellen wurden Audio- und Video-Beiträge vorgeschlagen, die über das Webportal und die App bereitgestellt werden können. Zudem bildete dieser Schritt eine wesentliche Basis, um die Erzählstränge für sogenannte Story-Lines einzugrenzen und attraktiv zu gestalten.
(3) Formulierung der Naturerlebnis-Themen und Points of Interest (POI): Welche Parameter dann tatsächlich den eigentlichen Wert eines Gebietes für den Besucher einerseits und den Naturschutz andererseits bedingen, musste in einem eigenen Schritt erarbeitet werden. Dies erfolgte durch eine inhaltliche Trennung, indem nicht die im Gelände erfassbaren Naturbestandteile an sich herausgearbeitet und beschrieben wurden, sondern indem sogenannte Naturerlebnis-Themen formuliert wurden, welche bei Nutzern des Systems Interesse wecken sollen. Begriffe wie „Höhlenbewohner“ (Tiere, die Höhlen bewohnen) sollen das Interesse des Nutzers wecken. Verbindende Themen wie z.B. „Münsterländer Marmor“, bringen dabei naturschutzfachliche Themen (Waldtypen, die auf diesem Substrat stocken) mit kulturhistorischen Aspekten (dem in regional typischen Gebäuden häufig verwendeten Kalksandstein) zusammen, und agieren zugleich als Mittler zu bereits vorhandenen Radwanderrouten (Baumberger Sandsteinroute) und den Angeboten lokaler Touristiker (Tab. 2). Damit diese Themen auch im Gelände erlebbar werden, wurden diese mit konkreten Punkt-Informationen (Point of Interest = POI) hinterlegt, die dann über den Standort per mobiler Applikation abrufbar sind. Für die Datenhaltung wurde das Xerleben-Datenmodell zur Beschreibung kommunaler Freizeitdaten (Andrae et al.2012) erweitert. Dadurch soll die Austauschbarkeit mit touristischen Daten des Landes erleichtert werden.
(4) Aufbau von Naturerlebnis-Narrativen (Story-Lines): Schließlich wurden im vierten Schritt die zuvor ausgearbeiteten Inhalte in Narrativen (Story-Lines) dargestellt. Dies sind Erzählstränge, welche einen bestimmten roten Faden zu einer Geschichte verdichten. Diese Story-Lines werden aufgebaut durch Stationen, denen Themen und POIs zugeordnet werden (Tab. 3).
2.2 Visualisierung der Naturschutzthemen und Nutzung in Rundrouting-Algorithmus
Das Natura-2000-Netzwerk ist ein europäisch zusammenhängendes Netz aus Schutzgebieten. Um diesen Grundgedanken aufzugreifen, wurde auf eine traditionelle, hierarchische Darstellung der Naturschutz-Themen verzichtet. Stattdessen wird dem Benutzer des Webportals und der mobilen Applikation ein spinnennetzähnliches Themennetzwerk angeboten, das er durch Berührung in seiner Konstellation verändern kann (Abb. 1).
So entsteht eine intuitive Art des Navigierens. Das sogenannte Themennetz liefert über Steckbriefe kurze Informationen in Text und Bild, welche ggf. auch mit anderen Webinhalten verlinkt sein können. Um sich über ein Thema zu informieren, kann der Nutzer von dort weitere Inhalte aufrufen oder das Thema auswählen, um es für das spätere Routing zu verwenden. Es wurde darauf geachtet, dass in diesem Netzwerk jedes Thema eine Mindestanzahl von Nachbarn hat, so dass keine Sackgassen vorkommen. Das Themennetzwerk kann dabei sukzessive ausgebaut werden. Die Datengrundlage für das Netzwerk bildet dabei eine konfigurierbare XML-Datei. Hat der Benutzer die Themenauswahl abgeschlossen, können zur Berechnung der individualisierten Route weitere Einstellungen wie Routendauer, Länge oder Startpunkt festgelegt werden.
Diese Informationen werden dann an den Routing-Algorithmus übergeben. Dieser beachtet die vom Nutzer eingegebenen Werte und Themen und berechnet entsprechend mehrere optimierte Rundrouten. Dabei gilt es, das Problem des Handelsreisenden (Traveling Salesman Problem = TSP) (Lawler et al. 1985) zu lösen: Dieser hat die Aufgabe, eine bestimmte Anzahl von Städten zu besuchen, die räumlich willkürlich verteilt sind und durch ein Netzwerk von Straßen untereinander verbunden sind. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass kein Weg zweimal benutzt wird, um zu gewährleisten, dass eine optimale Route gefunden wurde. Für die serverseitige Berechnung der Rundrouten wurde eine angepasste Version des Ameisenalgorithmus‘ (Dorigo et al. 2006), ein kombinatorischer Optimierungsprozess, basierend auf dem Verhalten von realen Ameisen, in Java implementiert. Durch die Themenauswahl des Benutzers werden die zu besuchenden Punkte auf der Karte festgelegt (ähnlich den Städten beim TSP). Mit Hilfe des Ameisenalgorithmus‘ lässt sich eine optimierte Route sehr effizient berechnen. Dabei werden die gewählte Routenlänge und Themenschwerpunkte berücksichtigt. Die Datenhaltung der Routen-Segmente, Themenbeschreibungen und POIs erfolgt innerhalb einer Open-Source-PostgreSQL-Datenbank mit PostGIS-Aufsatz. Das Webportal wurde auf Basis des Publishing-Systems Wordpress umgesetzt. Die Kartendarstellung des Webportals wurde auf Basis der JavaScript Bibliothek OpenLayers realisiert. Für die mobile Applikation wurde die Leaflet-JavaScript-Bibliothek eingebunden.
2.3 Plattformübergreifende Umsetzung
Im Bereich der Desktop-Entwicklung für Browser an Laptops oder fest installierten PCs gibt es eine Vielzahl von standardisierten Entwicklungsumgebungen und -möglichkeiten. Bei mobilen Plattformen hingegen führt die zunehmende Anzahl der Geräte auch zu einem steigenden Grad der Fragmentierung im Bereich der mobilen Betriebssysteme. So benötigt man zur Programmierung einer mobilen Applikation für die drei aktuell führenden Plattformen (Gartner 2011) jeweils verschiedene Programmiersprachen. Während Googles Android auf Java basiert, nutzt iOS von Apple Objective-C und Microsofts Windows Mobile Phone unterstützt nur C-Sharp und VisualBasic.Net. Um dieser Problematik zu entgehen und eine plattformunabhängige Lauffähigkeit zu gewährleisten, fokussiert sich die Entwicklung in diesem Projekt auf eine Kombination von HTML5, Javascript und CSS3. Diese hybride Lösung wird zunehmend populärer (Albert & Stiller 2011) und ermöglicht in Kombination mit der Open-Source Lösung „PhoneGap“ ( http://phonegap.com/ ) die Erstellung von nativen mobilen Applikationen, die auch in den jeweiligen Onlinestores eingepflegt werden können. So benötigt man nur eine Datenbasis und kann diese für die verschiedenen mobilen Betriebssysteme kompilieren.
Zur Umsetzung der HTML5- und JavaScript-Programmierung wurde für die mobile Applikation das Framework Sencha Touch 2.0 ( http://www.sencha.com/products/touch/ ) und für die Webportal-Lösung das Desktoppendant ExtJS in der Version 4.1.1 eingesetzt. Dieses überarbeiteten HTML5-Frameworks unterstützen alle modernen Browser und basieren auf dem bekannten Model-View-Controller-(MVC)-Entwurfsmuster (Gamma et al. 2011), wodurch eine modulare Softwarearchitektur nach dem Baukastenprinzip ermöglicht wird. So ist es jederzeit möglich, neue Module einzufügen oder vorhandene Module zu bearbeiten, ohne dass andere Programmteile beeinträchtigt werden. Durch die objektorientierte Struktur ist es auch machbar, eigene Module in das Framework zu integrieren.
3 Ergebnisse und Diskussion
Durch den in diesem Projekt entwickelten Ansatz zur Aufbereitung der Naturschutzthemen als Naturerlebnisthemen und deren Einbettung in moderne Soft- und Hardware-Umgebungen können diese Inhalte besser vermittelt werden. Mit einem Anteil von 14,1 % der Landesfläche der Bundesrepublik umfassen die Schutzgebiete gemäß der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie eine erhebliche Flächenkulisse (Bundesamt für Naturschutz 2010). Diese Gebiete und vor allem deren Beitrag zum Schutz von Lebensräumen, Arten und der weitergehenden Ökosystemfunktionen sind in der breiten Bevölkerung jedoch weithin unbekannt. Hier gilt es zweierlei zu unterscheiden: Erstens schützt die FFH-Richtlinie die Biotope in ihrem jeweiligen Verbreitungsraum. Das heißt, dass der auf den Baumbergen vorkommende „ganz normale“ Buchenwald hier als Lebensraumtyp besonders geschützt ist, eben weil er hier in Deutschland sein Hauptverbreitungsgebiet besitzt. Zweitens kommen auch Waldtypen vor, die selten sind, etwa weil sie nur an Stellen stocken, an denen durch das hoch anstehende Grundwasser besondere Bedingungen vorherrschen (etwa der Mitteleuropäische Eichen-Hainbuchenwald).
Diese naturschutzfachlich bedeutsamen Informationen sind in der Regel aber nur Fachexperten bekannt. Häufig sind Artenschutz und Schutzgebiete negativ konnotiert und werden in der Presse häufig als den technologischen Fortschritt hemmend oder als Luxus dargestellt. Schuster (2003) benennt sieben verschiedene Gründe für eine mangelnde Akzeptanz z.B. von Großschutzprojekten. Darunter sind auch Informationsdefizite, Freiheitseinengung und Wahrnehmungsbarrieren.
Mit dem hier entwickelten Ansatz der Naturerlebnis-Themen und der Vermittlung über moderne mobile Technologien kann für die im Gebiet vorkommenden Lebensräume und Arten ein vertieftes Verständnis hergestellt werden. Dem (touristischen) Besucher wird die Bedeutung dieser Schutzobjekte dadurch bewusster. Hierbei sind gewisse Grundelemente leitend, welche Kultur und Natur verbinden, so dass von einem Naturerbe gesprochen werden kann. Diese wurden in ausgesuchten Story-Lines aufgearbeitet und können durch die spezifischen Nutzungsmöglichkeiten des Smartphones multimedial und im Sinne des Naturschutzes vermittelt werden.
Exemplarisch umgesetzt wurden die Methoden zur Aufbereitung und Vermittlung der Naturschutzthemen zu Natura 2000 in Verbindung mit kulturhistorischen und touristischen Informationen im Kreis Coesfeld. Dieser ist stark von Landwirtschaft geprägt. Charakteristisch sind die sich kleinteilig abwechselnden kleinen Wälder, Feldgehölze, Hecken, Gräben und Gehöfte sowie wenige Reste von Mooren und Heiden. Besondere Elemente sind die zahlreichen Wasserschlösser, Sakralbauten und pittoresken Dorf- bzw. Kleinstadtkerne sowie der Höhenzug der Baumberge (187m. ü. NN, aber ca. 100 bis 120m über der flachwelligen Umgebung), der von den umliegenden Gemeinden touristisch sehr stark beworben wird. Die naturschutzfachliche Bedeutung spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
In der Aufbereitung der Naturerlebnis-Themen wurden diese touristischen Themen jedoch gezielt genutzt und mit den Natura-2000-Themen möglichst in Verbindung gebracht. So lässt sich z.B. naturkundlich eine große Menge an Eigenheiten über die Baumberge berichten. So spielt der durch Kalk zusammengehaltene Sandstein der Baumberge nicht nur als Baustein für die Sakral- und Profanbauten des Münsterlandes (Paulusdom und Rathaus Münster) eine Rolle, sondern auch als Untergrund für schützenswerte Natura-2000-Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten. So ist beispielsweise der in den Wäldern der Baumberge vorkommende Feuersalamander eine geschützte Art. Es ist jedoch unwahrscheinlich und zum Schutze der Art auch unerwünscht, dass er von einer großen Zahl Erholungssuchender aufgespürt und gestört wird. Aber mit Hilfe entsprechender Audio- und Videoinformationen können diese Inhalte vor Ort dem Nutzer der mobilen Applikation dennoch bereitgestellt werden, ohne zu konkrete Ortsinformationen zu nennen. Ein Beispiel für eine Story-Line inklusive den zugehörigen naturschutzfachlichen Elementen und FFH-Lebensraumtypen ist in Tab. 3 dargestellt.
Durch den Einsatz neuer LBS-Technologien können solche Informationen vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Ein kritischer Faktor und zugleich Gegenstand aktueller Forschungen ist dabei die Personalisierung und Adaption der LBS an Nutzergruppen (Espeter & Raubal 2009, Raper et al 2007b). Bezogen auf die Vermittlung von Naturschutzinformationen bedeutet das z.B. eine individuelle Berücksichtigung sowohl der Naturinteressen des Nutzers als auch eine Berücksichtigung der regionalen Natur-Besonderheiten vor Ort. Dieser Aspekt wurde im Projekt durch die Entwicklung und Anwendung eines Rundrouting-Algorithmus‘ berücksichtigt, der auf Basis individueller Interessen (frei wähl- und kombinierbare Naturerlebnis-Themen) optimierte Radtouren berechnet. Die entwickelten Methoden gehen dabei über den Status quo bestehender Routingportale hinaus und erlauben ein thematisches Routing nach individuellen Schwerpunkten. Dabei werden nicht nur A-B-Routen berechnet, sondern auch themenoptimierte Rundrouten angeboten.
Für eine erfolgreiche Verbreitung mobiler Applikationen ist es notwendig, die drei vorherrschenden Betriebssysteme iOS (Apple), Android (Google) und Windows Phone (Microsoft) in der Entwicklung zu berücksichtigen. Um den Entwicklungsaufwand zu minimieren, wurde auf eine hybride Web-App Lösung gesetzt. Über geplante Praxistests mit verschiedenen Smartphones der drei Betriebssysteme werden die Funktionalitäten geprüft.
Ein für die Nutzer intuitives Auswahl-Werkzeug erlaubt die Informationsrecherche und Ergebnis-Darstellung. Die Auswahl der Themen erfolgt über das interaktive Themennetz (Abb. 1). Hier wird dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, relevante Themen für den Naturschutz und deren Zusammenhänge besser zu verstehen, diese für eine Routen-Berechnung auszuwählen und letztendlich in Form einer Radtour auch vor Ort zu erleben. Durch den modularen Aufbau der entwickelten Komponenten ist eine Übertragung und Weiterentwicklung möglich, z.B. durch die Integration des Naturschutzthemen-Netzwerks in andere touristische oder Naturschutz-Portale. Die Inhalte des Netzwerks (d.h. Themenbeschreibung, Bild, Verknüpfung mit Nachbarthemen, vgl. Abb. 1) liegen als separate, frei konfigurierbare XML-Dateien vor. Diese können bei Bedarf einfach um neue oder geänderte Themen erweitert werden. Auch die Anwendung dieses Visualisierungswerkzeuges in weiteren Themenbereichen ist dadurch möglich.
Sowohl das Routing als auch die Vermittlung räumlicher Informationen zu Naturschutzthemen benötigen räumlich differenzierte und aufbereitete Geodaten. Die vorliegenden Naturschutzfachinformationen mussten für das aufgebaute System überarbeitet werden. Hierzu musste eine Zuordnung der Daten zu den Naturerlebnis-Themen erfolgen, bei Bedarf waren weitere Geodaten zu erfassen. Das betraf vor allem die Überarbeitung von Wegeverläufen innerhalb der FFH-Schutzgebiete und die Nacherfassung von Punktinformationen, die dem Nutzer des Systems vor Ort weitere Informationen zum Thema Natura 2000 zur Verfügung stellen (per Text, Audio oder Video).
Diese Arbeiten stellen für eine Übertragung der Entwicklungen auf andere geografische Regionen einen kritischen Punkt dar. Während die Natura-2000-Daten (Schutzgebietsinformationen, Vorkommen geschützter Arten etc.) zumindest in Deutschland je Bundesland standardisiert vorliegen, müssen diese noch mit zusätzlichen POI-Informationen (z.B. idealer Standort zur Betrachtung des Schutzgebiets, erreichbar per Rad und/oder Fuß) angereichert werden. Diese Informationen liegen in der Regel nur über regionales Expertenwissen vor, auf das nicht standardisiert zurückgegriffen werden kann. Hier wurde versucht, über die beschriebene vierstufige Herangehensweise die Erarbeitung der Informationen zu strukturieren, so dass diese auch bei einer Ausweitung auf weitere Naturräume genutzt werden können.
Für eine bessere Austauschbarkeit der POI-Daten wurde über das Xerleben-Datenmodell auf eine Erweiterung des kommunalen NRW-Datenstandards TFIS (Krickel 2012) aufgesetzt. Somit lassen sich diese Naturerlebnis-Informationen mit bestehenden kommunalen Daten einfach kombinieren und austauschen, sofern diese den XErleben-Standard unterstützen. Mit der zunehmenden Harmonisierung und Bereitstellung amtlicher Naturschutzdaten in Folge des Bundesgesetzes über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG), werden die Probleme der Datenschnittstellen und Verfügbarkeit geringer werden. Hierbei ist es jedoch nicht ausreichend, lediglich OGC-konforme Web-Mapping-Dienste anzubieten, sondern die Informationen auch als physikalische Geodaten bereitzustellen, damit diese noch wie hier beschrieben touristisch aufbereitet werden können
4 Ausblick
In den laufenden Projektarbeiten soll das Informationssystem frei zugänglich gemacht (Abb. 3, http://www.erlebnis-naturerbe.de ) und auch auf Wanderer ausgeweitet werden. Hierzu werden die Wanderwege im Kreis Coesfeld aufbereitet und in die Routingapplikation überführt. Die bisher verwendeten Story-Lines sind als fest definierte Narrative mit fixen Elementen (Startpunkt, Zwischenpunkte und Endpunkt) in das System eingebunden. Innerhalb der verbleibenden Projektphase sollen diese Elemente auch in das individuelle Themenrouting eingebunden werden. So sollen in die vom Nutzer des Systems gerechneten Routen (auf Basis von Startpunkt, Dauer/Entfernung, ausgewählte Erlebnis-Themen) Story-Line-Elemente automatisch eingebunden werden. Ebenfalls weiter verbessert und ausgebaut wird die Sprachnavigation der Route im Gelände sowie die Bereitstellung der Audio- und ggf. Videoinformationen im Gelände. Gerade in den ländlichen Bereichen der Naturschutzgebiete ist eine Offline-Bereitstellung und Navigation von hoher Bedeutung.
Dank
Das Projekt „FFH-Identitäten vernetzen – Westfälisches Naturerbe kennen und erleben“ wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Programms für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Wir danken dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW für die Bereitstellung der Informationen aus dem Radroutenplaner NRW sowie dem Westfälischen Heimatbund, Sauerländischen Gebirgsverein und Baumberge-Verein Münster für die Beistellung der Wanderwege-Daten. Dank gilt auch dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) – Amt für Landschafts- und Baukultur – für die Informationen zu POI im Kreis Coesfeld.
Literatur
Aden, C., Kastner, F., Loesbrock, J., Krohn-Grimberghe, S. (2013): Neue Ansätze digitaler Artenerfassung für den ehrenamtlichen Naturschutz – Ergebnisse der Entwicklung mobiler Lösungen in Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (3), 101-107.
–, Schaal, P., Loesbrock, J. (2011): Artenerfassung digital in Niedersachsen – ein Beitrag zur effektiveren Arbeit im ehrenamtlichen Naturschutz. In: Strobl, J., Blaschke, T., Griesebner, G., Hrsg., Angewandte Geoinformatik, Wichmann, Heidelberg, 196-205.
Albert, K., Stiller, M. (2012): Der Browser als mobile Plattform der Zukunft – die Möglichkeiten von HTML5-Apps. In: Verclas, S., Linnhoff-Popien, C., eds., Smart Mobile Apps, Springer, Berlin, 147-160.
Andrae, C., Hinrichs, J., Nienstedt, K., Kruth, F., Zolper, A., Bretschneider, D. (2012): XErleben in der Praxis – Implementierung eines Objektmodells für „Objekte von Interesse“. In: Strobl, J., Blaschke, T., Griesebner, G., Hrsg., Angewandte Geoinformatik, Wichmann, Heidelberg, 290-296.
Bundesamt für Naturschutz (2010): Natura 2000 in Deutschland. 2. Aufl. Bonn. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/BFN_Broschuere_deu_lang.pdf (letzter Zugriff 11.04.2013).
– (2013): Ökologischer Tourismus und Naturtourismus. http://bfn.de/0323_iyeoeko.html (letzter Zugriff 11.03.2013).
BLM (2013): Location-based Services 2013. Vorstudie zu Angeboten, Nutzung und lokalen Werbemarkt-potenzialen ortsbezogener mobiler Dienste in Deutschland. Studie im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). http://www.blm.de/apps/documentbase/data/pdf1/Goldmedia_Location_Based_Services.pdf (letzter Zugriff 22.02.2013).
Burghardt, D., Edwardes, A., Weibel, R. (2003): WebPark – Entwicklung eines mobilen Informationssytems für Erholungs- und Naturschutzgebiete. Kartogr. Nachr. 53 (2), 58-64.
Dorigo, M., Birattari, M., Stützle, T. (2006): Ant Colony Optimization: Artificial Ants as a Computational Intelligence Technique. IEEE Computational Intelligence Magazine 1 (4), 28–39.
EC (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:NOT (letzter Zufgriff 12.11.2013).
Edwards, S., Blythe, J., Scott, P., Weihong-Guo A. (2006): Tourist Information delivered through mobile devices: findings from the image project. Information Technology & Tourism 8, 31-46.
Espeter, M., Raubal, M. (2009): Location-based decision support for user groups. Journal of Location Based Services 3 (3), 165-187.
Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. (2011): Entwurfsmuster. Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software, 2. Aufl. Addison-Wesley, München, Boston.
Gartner (2011): Press Release Gartner Research. Egham, UK, April 7, 2011. http://www.gartner.com/newsroom/id/1622614 (letzter Zugriff 11.03. 2013).
Gunkel, E. (2012): Analyse der FFH-Gebietsgrenzen im Kreis Coesfeld. Kartierung und Evaluation der Grenzlinien. Unveröff. Bachelorarb., Institut für Landschaftsökologie, WWU Münster.
Kreis Höxter (2012): iOS-Applikation Erlesene Natur. https://itunes.apple.com/de/app/erlesene-natur/id500042927?mt=8 (letzter Zugriff 11.04.2013).
Krickel, B. (2012): Informationserhebung zur Aktualisierung von ATKIS© und Freizeitkataster in Nordrhein-Westfalen. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 4, 240-246.
LANUV (2012): Bürger-Naturschutz – Arten, Alleen, Altbäume. http://www.lanuv.nrw.de/natur/apps.htm (letzter Zugriff 22.02.2013).
Lawler, E.L., Lenstra, J.K, Rinnooy, A.H.G., Smoya, D.B. (1985): The Traveling Salesman Problem. A Guided Tour of Combinatorial Optimization. Wiley, Chichester.
Neumeyer, E., Dicks, U. (2010): Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern. Forschungsber. 591. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin.
Schuster, K. (2003): Image und Akzeptanz von Naturschutz in der Gesellschaft. In: Deutscher Rat für Landespflege, Hrsg., Naturschutz – eine Erfolgsstory? Schr.-R. DRL 75, 80-89.
Raper, J., Gartner, G., Karimi, H., Rizos, C. (2007a): Applications of location based services: A selected review. Journal of Location Based Services 1 (2), 89-111.
–, Gartner, G., Karimi, H., Rizos, C. (2007b): A critical evaluation of location based services and their potential. Journal of Location Based Services 1 (1), 5-46.
Wang, D., Park, S., Fesenmaier, D. (2012): The Role of Smartphones in Mediating the Touristic Experience. Journal of Travel Research 51 (4), 371-387.
Anschriften der Verfasser: Oliver Buck, Cliff Pereira und Dr. Andreas Müterthies, EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH, Oststraße 2-18, D-48145 Münster, E-Mail oliver.buck@eftas.com, cliff.pereira@eftas.com und andreas.mueterthies@eftas.com; Andre Große-Stoltenberg und Prof. Dr. Tillmann Buttschardt, Angewandte Landschaftsökologie/Ökologische Planung, Institut für Landschaftsökologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Robert-Koch-Straße 26-28, D-48149 Münster, tillmann.buttschardt@uni-muenster.de und ags@uni-muenster.de; Josef Räkers, Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Borkener Straße 13, D-48653 Coesfeld, E-Mail josef.raekers@kreis-coesfeld.de; Dr. Patrick-Johannes Wolf, NLU – Projektgesellschaft mbH & Co. KG, Kley 22a, D-48308 Senden, E-Mail info@nlu-services.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen






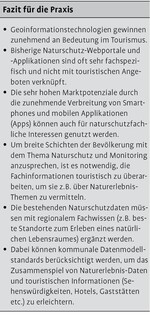
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.