Energiewende und Landschaftsästhetik
Im Rahmen der „Energiewende“ sollen Landschaften verstärkt zur Energiegewinnung aus regenerativen Energiequellen genutzt werden. In der Diskussion über die landschaftsästhetischen Konsequenzen zeigt sich eine Diskrepanz: Die Veränderungen des Landschaftsbildes sind nicht selten erheblich und stehen für viele Bürger emotional an erster Stelle; sie werden aber oft nicht gleichrangig mit den anderen Schutzgütern behandelt, wobei auf die Subjektivität der Bewertung von Landschaftsbildern verwiesen wird. Der Aufsatz macht deutlich, wie sich ästhetische Bewertungen von Energieanlagen in der Landschaft versachlichen lassen, indem man die in unserer Kultur einflussreichen intersubjektiven Landschaftsideale als Maßstab verwendet. Für Windenergieanlagen, Solarfarmen und Kurzumtriebsplantagen wird erörtert, wie sie sich auf diejenigen ästhetischen Qualitäten auswirken, die im Hinblick auf diese Ideale eine schützenswerte Landschaft ausmachen. Da ein erhebliches Konflikt- und Minderungspotenzial besteht, muss bei der Planung von Energieanlagen in der Landschaft eine räumliche Steuerung erfolgen, die landschaftsästhetische Qualitäten umfassend berücksichtigt.
Energy Turnaround and Landscape Aesthetics – Objective evaluation of the aesthetics of energy plants referring to three intersubjective landscape ideals
The implementation of the ‘Energiewende’ (energy turnaround) in Germany requires the increasing use of landscapes for the production of regenerative energies. The discussion about the effects for landscape aesthetics shows a clear discrepancy: the changes of the visual landscape are frequently significant, and they emotionally rank first for many citizens. At the same time these changes are not treated equally to effects on the other natural ressources with reference to the subjectivity of the evaluation of the landscape scenery. The paper shows how aesthetic evaluations of energy plants in the landscape can be objectified by referring to intersubjective landscape ideals. The study investigates the effects of wind power plants, solar farms and short-rotation plantations on those aesthetic qualities which belong to the ideals of a landscape worth protecting. Since this theme holds significant conflict potential the spatial planning of energy plants in the landscape has to comprehensively consider the quality of landscape aesthetics.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Anlässlich der „Energiewende“ wird intensiv diskutiert, wie und in welchem Maße Landschaften zukünftig zur Energiegewinnung aus regenerativen Energiequellen genutzt werden können und sollen. In den oftmals kontroversen Diskussionen spielen ganz unterschiedliche Belange eine Rolle, etwa ökonomische, soziale, ökologische und nicht zuletzt landschaftsästhetische. Im Hinblick auf die landschaftsästhetischen Belange zeigt sich eine Diskrepanz: Zwar haben sie besondere Relevanz, denn Energieanlagen, insbesondere Windenergieanlagen, wirken sich auf das Landschaftsbild oft erheblich und weiträumiger aus als auf die Schutzgüter des Naturhaushalts. Bei Windenergieanlagen ist der Raum mit ästhetischen Fernwirkungen deutlich größer als der mit Meideeffekten auf Vögel und sehr viel größer als die Standfläche (LAG-VSW 2007, NLT 2011: 7f., 15). Außerdem fühlen sich viele Bürger durch diese Auswirkungen betroffen, weil das Landschaftsbild zentrale Bedeutung dafür hat, ob man sich in einem Gebiet wohl und heimisch fühlt (DRL 2005, Nohl 2006, 2010: 4). Aber in Planungsverfahren wird das Schutzgut Landschaftsbild meist nicht gleichrangig mit den anderen Schutzgütern behandelt und es bestehen methodische Unsicherheiten bei seiner Erfassung und Bewertung, wobei nicht selten auf den subjektiven Charakter der Qualitäten des Landschaftsbildes verwiesen wird (vgl. Demuth 2000: If., Jessel et al. 2003: 10, Roth 2012: 1f.).
Dieser Aufsatz soll dazu beitragen, dass landschaftsästhetische Belange bei der Planung von „Energielandschaften“ umfassender und sachlich angemessener berücksichtigt werden. Im ersten Schritt wird dargelegt, dass die ästhetische Wahrnehmung und Bewertung von Landschaften, bei aller Subjektivität und Emotionalität, objektiven Charakter hat, insofern sie auf intersubjektiven Wahrnehmungsmustern bzw. Landschaftsidealen basiert. Nimmt man diese Ideale als Maßstab, so kann man über die ästhetischen Qualitäten von Landschaften und über die landschaftsästhetischen Wirkungen von Energieanlagen sachlich und nachvollziehbar diskutieren. Im zweiten Schritt werden die drei in unserer Kultur besonders einflussreichen Landschaftsideale charakterisiert: das aufklärerische, das konservative und das romantische Landschaftsideal. Im dritten Schritt wird dann erörtert, wie Energieanlagen jeweils ästhetisch zu beurteilen sind, wenn man als Beurteilungsmaßstab eines dieser drei Landschaftsideale zugrunde legt, wobei sich die Analyse auf drei Formen von Energieanlagen beschränkt: Windenergieanlagen, Solarfarmen und Schnellwuchs/Kurzumtriebsplantagen.
2 Zur Intersubjektivität ästhetischer Landschaftswahrnehmung
Ästhetische Wahrnehmungen und Beurteilungen von Landschaften gelten vielfach als individuell, subjektiv und emotional. Und tatsächlich sind sie abhängig von individuellen Gewohnheiten, Präferenzen, Stimmungen und Erwartungen (vgl. Hunziker 2010: 33f.). Dennoch bewegt man sich bei der landschaftsästhetischen Beurteilung von Energieanlagen nicht im Bereich des rein Subjektiven, wie es die Aussprüche „Über Geschmack lässt sich nicht streiten“ und „Beauty is in the eye of the beholder“ nahelegen. Denn es gilt auch: Jede ästhetische Wahrnehmung von Landschaft erfolgt, so individuell und subjektiv sie im Einzelnen auch sein mag, auf der Basis und im Rahmen überindividueller, intersubjektiver Wahrnehmungsmuster, die mit bestimmten Präferenzen und Bewertungen verbunden sind (vgl. Cosgrove 1998, Hunziker 2010, Kirchhoff & Trepl 2009, Trepl 2012).
Teilweise handelt es sich um universelle, weltweit ähnliche Wahrnehmungsmuster, die evolutionsbiologisch erklärbar sind (siehe zusammenfassend Hunziker 2010), im Wesentlichen jedoch – das wird durch ihre inter- und intrakulturelle Verschiedenheit sowie ihre kulturhistorischen Wandlungen belegt – um kulturell geprägte Wahrnehmungsmuster (Cosgrove 1998, Drexler 2010, Eisel 2004, Kirchhoff & Trepl 2009, Kirchhoff & Vicenzotti 2013, Nicolson 1959, Roger 1999, Trepl 2012, Wenzel 1991). „A landscape is a cultural image, a pictorial way of representing, structuring or symbolising surroundings“ (Daniels & Cosgrove 1988: 1). Diese kulturellen Wahrnehmungsmuster werden durch kulturelle Überlieferung bzw. Enkulturation weitergegeben (vgl. Hunziker 2010: 36f., Schama 1995) und dabei zumeist so weitgehend internalisiert, dass sie unbewusst wirken bzw. als selbstverständlich gegeben erscheinen, weshalb man von einer vermittelten Unmittelbarkeit bzw. einer zweiten Natur des Menschen spricht (Testa 2008). Demnach kann man über Landschaftswahrnehmungen und die landschaftsästhetischen Wirkungen von Energieanlagen dann sachlich und intersubjektiv nachvollziehbar diskutieren, wenn man diese kulturellen Wahrnehmungsmuster als Maßstab verwendet.
3 Drei Landschaftsideale
3.1 Vorbemerkungen
In unserer Kultur gibt es unterschiedliche intersubjektive Wahrnehmungsmuster, durch die wir Ausschnitte der Erdoberfläche als Landschaft wahrnehmen. Die drei einflussreichsten werden im Folgenden beschrieben. Mit Blick auf ihren ideengeschichtlichen Entstehungsort werden sie als das aufklärerische, das konservative und das romantische Landschaftsideal bezeichnet. Am ausführlichsten behandelt wird das konservative Landschaftsideal, da es in unserem deutschsprachigen Kulturraum eine besonders große Rolle spielt (schon in England und Frankreich ist es anders; vgl. Drexler 2010). Man kann davon ausgehen, dass die meisten in unserem Kulturkreis aufgewachsenen Menschen alle drei Landschaftsideale verinnerlicht haben und sich, je nach Stimmung und Situation, an dem einen oder anderen Ideal orientieren, aber insgesamt ein bestimmtes Ideal präferieren. Die nachfolgenden Charakterisierungen der drei Landschaftsideale basieren auf den Analysen von Eisel (1982, 2006), Kirchhoff (2011, 2012b), Kirchhoff & Trepl (2009), Kirchhoff & Vicenzotti (2013), Siegmund (2009, 2011) und Trepl (2012). Sie sind gegenüber diesen Analysen vereinfacht und sie beschränken sich auf die Hauptcharakteristika der Ideale.
3.2 Das aufklärerische Landschaftsideal
Dem aufklärerischen Denken zufolge gibt es eine ahistorische, universelle Vernunft, die alle Menschen, ihrer Natur nach, besitzen. Gemäß derjenigen Richtung aufklärerischen Denkens, in dem sich ein einflussreiches Landschaftsideal herausgebildet hat, soll gesellschaftliche Ordnung entsprechend universellen Vernunftprinzipien, also überall auf der Welt auf die gleiche Weise, gestaltet werden, wozu man sich von Willkürherrschaft und unvernünftigen Traditionen, aber auch von Triebhaftigkeit und Egoismus befreien müsse. Wenn eine Landschaft eine natürlich erscheinende, harmonische Gestalt hat, die diese nach Vernunftprinzipien gestaltete Gesellschaftsordnung symbolisiert, „wenn sie beim Betrachter Assoziationen auslöst, die sich zur moralisch-gesellschaftlichen Gesamtidee vereinen lassen“ (Siegmund 2009: 165), dann gilt sie als schön.
Wegen des Universalismus spielen lokale landschaftliche Besonderheiten keine konstitutive Rolle; sie werden sogar eher negativ bewertet, weil sie auf unvollständige Emanzipation von unvernünftigen lokalen Traditionen hinweisen. Die aufklärerische Ideallandschaft ist nicht eine organisch gewachsene, sondern eine konstruierte Landschaft. Paradigmatisch umgesetzt worden ist dieses Ideal konstruierter scheinbarer Natürlichkeit in bestimmten Varianten von Landschaftsgärten, wobei natürliche Gegebenheiten, die ästhetisch unharmonisch wirkten, durchaus beseitigt wurden. Dabei diente das einfache Landleben bzw. das Idealbild einer arkadischen Hirtenlandschaft, die einen angenommenen natürlichen Urzustand der Freiheit und Gleichheit aller Menschen symbolisiert, als Vorbild, und als Gegenbild das dekadente Leben am absolutistischen Hof bzw. der Barockgarten mit seinen unnatürlichen geometrischen Formen.
3.3 Das konservative Landschaftsideal
Das konservative Landschaftsideal basiert auf einer aufklärungskritischen Geschichtsphilosophie (siehe insbesondere Herder 1784-1791, Riehl 1854), der zufolge Vernunft kein ahistorisches, universelles Vermögen ist, sondern ein genetisch-kontextualistisches, das sich immer nur in individueller Form realisiert. Das Ziel kultureller Entwicklung ist die Ausbildung kultureller Eigenart, nicht die Verwirklichung universeller Vernunftprinzipien. Damit kulturelle Entwicklung gelingt, muss sie durch das Wechselspiel zweier Faktoren bestimmt sein: durch die besonderen natürlichen Bedingungen eines Gebietes und durch den Charakter der Menschen, die in diesem Gebiet leben.
Beide Faktoren wirken nicht statisch und unabhängig voneinander, sondern prägen sich wechselseitig: Die Menschen erfassen die spezifischen Nutzungsmöglichkeiten und Restriktionen, die das Gebiet, in dem sie leben, aufgrund seiner spezifischen natürlichen Bedingungen (Boden, Klima, Gesteine usw.) aufweist; sie realisieren diese spezifischen Nutzungsmöglichkeiten und reagieren auf die Restriktionen so, wie es ihrem besonderen Charakter bzw. ihren Traditionen entspricht – ohne dabei die natürlichen Besonderheiten durch technische Maßnahmen zu beseitigen oder unwirksam zu machen. Zugleich formen die natürlichen Umweltbedingungen den Charakter, die Lebensweise und die Traditionen der Menschen. Im Laufe der Zeit bildet sich so durch wechselseitige Prägung eine einzigartige und zweckmäßige kulturelle Einheit von „Land und Leuten“ (Riehl 1854), in der eine einzigartige Vielfalt kultureller Traditionen und Formen der Landnutzung untrennbar verwoben ist mit einer einzigartigen Kulturlandschaft, die eine charakteristische, organisch gewachsene Vielfalt von Landschaftsbestandteilen aufweist. „So modificieren sich die Nationen nach Ort, Zeit und ihrem innern Charakter; jede trägt das Ebenmaas ihrer Vollkommenheit, unvergleichbar mit andern, in sich“ (Herder 1784-1791: XIV/227). Die Schönheit einer (Kultur-)Landschaft wird gedeutet als der sinnlich wahrnehmbare Ausdruck ihrer zweckmäßigen Eigenart; eine Landschaft ist umso schöner, je vollkommener ausgebildet ihre Eigenart ist.
Eigenart meint demnach nicht eine Kombination aus irgendwelchen unterschiedlichen, besonderen oder seltenen Dingen, und auch die Wiedererkennbarkeit oder numerische Einmaligkeit einer solchen Kombination ist keine hinreichende Bedingung für Eigenart; sie ergibt sich vielmehr ausschließlich durch einen Prozess der Selbstdifferenzierung einer natürlichen Einheit (Naturlandschaft) oder naturräumlich-kulturellen Einheit (Kulturlandschaft), indem diese eine Vielfalt für sie typischer Besonderheiten hervorbringt, die zusammen ein harmonisches Ganzes aus zueinander passenden Teilen bilden.
Vielfalt meint demnach nicht eine Vielzahl irgendwelcher Elemente, so dass weder Abwechslungsreichtum noch Vielgestaltigkeit hinreichende Bedingungen für Vielfalt sind. Deshalb trägt z.B. eine Weihnachtsbaumkultur, die in einem Waldgebiet oder einer traditionellen Streuwiesenlandschaft angelegt wird, nicht zu deren Eigenart und Vielfalt bei, obwohl sie die Anzahl der Landschaftselemente erhöht; vielmehr ist sie ein die Eigenart und Vielfalt beeinträchtigender Fremdkörper (vgl. Fischer-Hüftle 1997: 241, 243). Diese wichtige Differenz zwischen Eigenart und Vielfalt einerseits und Vielzahl, Abwechslungsreichtum, Vielgestaltigkeit, Informationsgehalt usw. andererseits wird in vielen Landschaftsbildbewertungsverfahren nicht berücksichtigt (siehe aber Demuth 2000: 147ff., Köhler/Preiss 2000), so dass die Bewertung der Eigenart und Vielfalt von Landschaften unangemessen operationalisiert wird (vgl. Eisel 2006, Kirchhoff 2012a, Wenzel 1991, siehe aber Roth 2012: 57-59).
3.4 Das romantische Landschaftsideal
Am Beginn der Romantik steht die Feststellung, dass die Aufklärung mit ihrer Orientierung an Vernunft zu einer Versachlichung der Welt führt, zu einer – wie Max Weber (1919) später sagte – „Entzauberung der Welt“. Auf diese entzaubernde Versachlichung reagiert die Romantik mit einer Kunstreligion: mit der Idee und individuellen Praxis einer ästhetischen Neuschaffung einer höheren, zauberhaften Wirklichkeit jenseits der versachlichten Alltagswelt durch die Phantasie des produktiven künstlerischen Subjekts. Nicht eine kollektive vernünftige gesellschaftliche Ordnung soll geschaffen werden, sondern ein flüchtiger Augenblick möglich sein, in dem das ästhetisch-produktive Ich eine Entgrenzung erlebt. Romantisch ist, „was uns zivilisationsfern und stimmungsvoll erscheint, schwärmerisch und in jedem Fall anti-intellektuell“ (Klessmann 1979: 10). So ist die romantische Ideallandschaft nicht die harmonische Kulturlandschaft, sondern eine Landschaft, die als Seelenspiegel dienen kann und die es dem sehnsuchtsvollen Blick erlaubt, sich in eine nicht erreichbare, dem Zugriff der Vernunft entzogene, ferne Natur zu verlieren, in der alle Konturen verschwimmen, alle Bestimmtheiten sich auflösen; eine Landschaft, die es erlaubt, zum Horizont zu blicken, an dem Erde und Himmel, Materielles und Immaterielles verschmelzen – und so eine Einheit des sonst Getrennten zu imaginieren. Zudem sucht der romantische Blick eine nahe Natur, die abgründig oder wild ist und als geheimnisvoller Ort wahrgenommen werden kann, an dem die Vernunft machtlos ist.
4 Beurteilung von Energieanlagen relativ zu den drei Landschaftsidealen
4.1 Vorbemerkungen
Wie sind Energieanlagen in der Landschaft ästhetisch zu beurteilen in Abhängigkeit davon, ob man als Maßstab das aufklärerische, das konservative bzw. das romantische Landschaftsideal zugrunde legt? Dies wird im Folgenden für Windenergieanlagen (WEA; Abb.1), Solarfarmen (SF) und Schnellwuchs/Kurzumtriebsplantagen (KUP) erörtert. Die Analyse beschränkt sich auf die grundsätzlichen Beurteilungsprinzipien, also darauf, ob die jeweilige Energieanlage in das landschaftliche Idealbild passt, ob sie die für das jeweilige Idealbild relevanten Eigenschaften beeinträchtigt oder stärkt. In konkreten Planungen und Eingriffsgutachten muss man darüber hinaus berücksichtigen, dass die landschaftsästhetischen Wirkungen von Energieanlagen auch abhängig sind von der Gestaltung und Sichtbarkeit der Energieanlagen sowie von der Beschaffenheit und ästhetischen Empfindlichkeit der jeweiligen Landschaft. Agro-Forst-Systeme werden nicht behandelt, da ihre landschaftsästhetischen Wirkungen so sehr von ihrer Gestaltung abhängen, dass eine differenzierte, hier nicht darstellbare Analyse erforderlich wäre.
4.2 Energieanlagen und konservatives Landschaftsideal
Im Hinblick auf das konservative Landschaftsideal ist entscheidend, wie sich Energieanlagen auf die Eigenart und Vielfalt von Landschaften auswirken. In vielen Fällen erhöht sich durch eine WEA, SF oder KUP zwar die Anzahl unterschiedlicher Elemente in der Landschaft, zur Vielfalt und Eigenart tragen sie aber weder in Naturlandschaften noch in (traditionellen) Kulturlandschaften bei. Denn diese Energieanlagen stellen keinen für solche Landschaften typischen Bestandteil dar. Sie sind Fremdkörper und beeinträchtigen somit das Landschaftsbild in seiner gewachsenen Eigenart.
Wenn neu errichtete Energieanlagen das Erscheinungsbild einer Gegend dominieren und ein neuartiges Landschaftsbild schaffen, entsteht dann aber nicht eine neue Landschaft mit Eigenart? Das wäre nur dann der Fall, wenn sich die neue Landnutzungsform aus dem Zusammenspiel besonderer naturräumlicher Gegebenheiten und besonderer kultureller Traditionen ergeben hätte und damit in regionalspezifischer Weise ausgeprägt wäre.
Bei KUP (Abb.2) ist das in der Regel nicht der Fall: Denn zumeist werden einige wenige, nicht gebietstypische Arten, z.B. Klone von Balsampappeln, in homogenen Monokulturen angepflanzt, die relativ großflächig geerntet werden (LfULG 2011); so unterscheiden KUP sich erheblich von historischen Niederwäldern, die je nach Region, Nutzung und Standort sehr unterschiedlich als inhomogenes Mosaik ausgeprägt waren (Müller-Wille 1980). KUP können aber dann positive Wirkungen haben, wenn sie für die Eigenart einer Landschaft typische, aber fehlende Gehölze ersetzen.
WEA und SF (Abb.3) haben eindeutig keinen regionalspezifischen Charakter: Sie sind Produkte industrieller Serienproduktion, die in Material und Gestalt ohne Bezug auf naturräumliche und kulturelle Besonderheiten hergestellt werden, so dass überall in Deutschland im Prinzip derselbe Anlagentyp eingesetzt wird (bei WEA mit Variationen je nach mittlerer Windgeschwindigkeit). Darin unterscheiden sich WEA von den historischen Windmühlen, in deren Tradition sie von manchen Befürwortern gestellt werden; denn deren Bauweise war regional unterschiedlich je nach Mühlenbaumeister, Verwendungszweck und den regional verfügbaren Materialien (Schnelle 2012).
Haben aber WEA nicht regionalspezifischen Charakter, weil sie, in viel größerem Maße als SF und KUP, bevorzugt unter bestimmten Standortbedingungen realisiert werden? Regionaltypischen Charakter kann man allenfalls für die erste Ausbauphase der Windenergie in den 1990er Jahren geltend machen, in der WEA fast ausschließlich in den norddeutschen Küstenregionen errichtet wurden; für den heutigen Ausbau, der deutschlandweit, in praktisch allen Landschaften erfolgt, gilt das nicht; so heißt es in einer Studie des Umweltbundesamtes (2013), die 13,8% der Fläche Deutschlands als von der Windhöffigkeit geeignet für WEA einstuft (ebd.: 2), ausdrücklich: „Das ermittelte Potenzial ist über ganz Deutschland verteilt“ (ebd.: 3). Selbst dann, wenn WEA weiterhin gehäuft in bestimmten Gebieten installiert werden sollten, wäre das nicht das Ergebnis eines regionalen Prozesses der Entwicklung von Eigenart, sondern das Ergebnis eines überregionalen ökonomischen und politischen Prozesses.
Aber können WEA nicht das Landschaftsbild zumindest bereichern? Tatsächlich werden sie auch positiv wahrgenommen, weil sie wegen ihrer großen Höhe und häufig exponierten Lage als Landmarken Orientierung bieten (so etwa Marquardt 2011) und imposant, manche sagen auch majestätisch-erhaben, wirken. Solche positiven Wahrnehmungen erfolgen aber nicht aus der Perspektive des konservativen Landschaftsideals. Aus der Perspektive dieses Ideals müssen sich Landmarken aus der Eigenart der Landschaftsstruktur ergeben; und WEA sind nicht majestätisch-erhaben, sondern übermäßig groß: Sie missachten den durch natürliche Elemente wie Bäume und kulturelle Elemente wie Kirchtürme gesetzten vertikalen Maßstab und zerstören so die harmonischen Proportionen der Landschaft (vgl. Nohl 2010, NLT 2011: 7f.) (zu konservativen und anderen Konzepten landschaftlicher Erhabenheit siehe Kirchhoff & Trepl 2009, Lobsien 1986, Trepl 2012).
Festzuhalten ist also: Im Hinblick auf das in unserer Kultur einflussreiche Ideal landschaftlicher Eigenart und Vielfalt muss man WEA, SF und in der Regel auch KUP als Beeinträchtigung von Natur- und Kulturlandschaften beurteilen. Das gilt, wegen ihrer großen Höhe und häufig exponierten Lage, insbesondere für WEA. Wenn manche Autoren sagen, WEA könnten so in der Landschaft angeordnet werden, dass die Eigenart der Landschaft erhalten bleibt (Schöbel 2012: 142), oder sogar meinen, WEA steigerten die Eigenart von Landschaften (Schindler 2005: 5), dann wird der Begriff „Eigenart“ (vgl. Kirchhoff 2012b) nicht richtig verwendet (siehe oben).
4.3 Energieanlagen und romantisches Landschaftsideal
Wie sind Energieanlagen aus der Perspektive des romantischen Landschaftsideals zu beurteilen? Problematisch ist hier nicht, dass WEA, SF und KUP die Eigenart von Landschaften beeinträchtigen, sondern dass sie zur Technisierung und Industrialisierung und damit Versachlichung des Landschaftsbildes beitragen. Das gilt bedingt für KUP, sofern sie in Form einer großflächigen, agro-industriellen Landnutzung realisiert werden, vor allem aber für die technisch-industriellen WEA und SF. Während in agro-industriellen Landnutzungen noch Organismen das letztendliche Produktionsmittel darstellen und technische Großgeräte wie Traktoren nur temporär präsent sind als Hilfsmittel der Produktion, ist im Falle der WEA und SF das eigentliche Produktionsmittel eine technisch-industrielle Anlage, die permanent in der Landschaft steht (vgl. Nohl 2010: 9, Puchert 2009: 85).
In der Naherfahrung beeinträchtigen (großflächige) KUP und vor allem WEA und SF die phantasievolle romantische Wahrnehmung einer wilden oder geheimnisvollen Natur. Die phantasievolle Flucht in die Ferne des Horizontes wird von WEA – auch buchstäblich – durchkreuzt: Die Ferne ist nicht mehr der Vernunft entrückt, sondern mit vernünftiger Technik besetzt; die Vertikale wird betont, wohingegen der romantische Blick den Horizont sucht als Ort des unbestimmten Übergangs von der Erde zum Himmel (vgl. Nohl 2010: 10).
Zu den aktuellen Tendenzen, WEA über Wäldern zu errichten (Abb.4 und 5), ist anzumerken: Wald spielt im romantischen Landschaftserleben eine besondere Rolle. Er fungiert als Gegenwelt zur Zivilisation, in der romantische Stimmungen und Gefühle der Freiheit von Zivilisation und Vernunft geweckt werden und die Sehnsucht nach Stille erfüllt wird – man denke an Tiecks „Waldeinsamkeit“ oder an Eichendorffs Wald als zeitlose Idylle, die dem vergänglichen Menschsein gegenübersteht (Apel 1998, Harrison 1992, Klessmann 1979). Eine im Wald errichtete WEA stört, diesen weit überragend, den romantischen Blick über bewaldete Hügel in die Ferne; sie beeinträchtigt, vor allem akustisch, die typische Stimmung im Inneren eines Waldes (vgl. Breuer 2012: 13, Nohl 2010: 11f.).
4.4 Energieanlagen und aufklärerisches Landschaftsideal
Wie sind Energieanlagen in der Landschaft zu beurteilen, wenn man das aufklärerische Landschaftsideal zugrunde legt? Hier gibt es keinen Konflikt mit dem Ideal landschaftlicher Eigenart oder kulturferner „Wildheit“, wohl aber mit dem Ideal einer natürlich erscheinenden Harmonie. Das gilt für großflächige, als Monokulturen angelegte KUP und insbesondere für die technisch-industriellen WEA und SF (s.o.), die in Größe, Form, Material und Farbe im Gegensatz zum natürlichen Charakter von Landschaften stehen (vgl. Nohl 2010: 9).
Unter bestimmten Umständen und in gewisser Hinsicht lassen sie sich jedoch positiv deuten: nämlich dann, wenn man in ihnen Zeichen eines demokratisch legitimierten, vernünftigen Zukunftsentwurfs sieht, der in einer moralisch gebotenen, weil nachhaltigen und risikoarmen Nutzung natürlicher Ressourcen besteht. Eine solche positive Deutung setzt allerdings wohl voraus, dass die Energieanlage einen demokratischen Gemeinwillen repräsentiert. Das kann z.B. bei einem „Bürgerwindpark“ der Fall sein, der diese Bezeichnung nicht nur deshalb trägt, weil ein formales Partizipationsverfahren durchgeführt worden ist oder Bürger zu seinen Eigentümern zählen, sondern deshalb, weil er auf der Basis eines umfassenden demokratischen kommunalen Willensbildungsprozesses (von lokal ansässigen Bürgern) realisiert worden ist.
5 Ausblick
Nimmt man die kulturell geprägten Landschaftsideale, die dem subjektiv-individuellen Sehen von Landschaften zugrunde liegen, als Maßstab, so sind sachlich angemessene, intersubjektiv nachvollziehbare ästhetische Beurteilungen der Auswirkungen von Energieanlagen in der Landschaft möglich. Lösen muss man sich dafür allerdings von der irrigen Ansicht, eine sachliche und nachvollziehbare Argumentation sei nur auf der Basis von Mess- und Zählbarem möglich.
Wenn man so verfährt, dann zeigt sich: KUP, SF und insbesondere WEA müssen aus der Perspektive sowohl des konservativen Ideals landschaftlicher Eigenart und Vielfalt als auch aus der des romantischen Interesses an wilder, geheimnisvoller Natur und phantasievoller Flucht in die Ferne des Horizontes in der Regel als erhebliche Beeinträchtigungen beurteilt werden. Aus der Perspektive des aufklärerischen Landschaftsideals ergibt sich eine weniger eindeutige Bewertung: SF, WEA und großflächige KUP laufen zwar dem Ideal von Natürlichkeit zuwider, werden jedoch unter bestimmten Umständen positiv wahrgenommen als Symbole eines vernünftigen demokratischen Gemeinwillens.
Wenn zuweilen gesagt wird, WEA würden die landschaftliche Eigenart nicht beeinträchtigen, so beruhen solche Einschätzungen auf einem fragwürdigen Verständnis des Begriffs landschaftlicher Eigenart. Wenn der Gebrauch des Wortes Landschaft so erweitert wird, dass die Verbindung zum kulturellen Gehalt des Begriffs – der wesentlich in den ästhetischen aufklärerischen, konservativen und romantischen Landschaftsidealen besteht – ignoriert wird (so z.B. Prominski 2006), dann kann man zu ganz anderen, im Prinzip beliebigen ästhetischen Bewertungen von Energieanlagen in der „Landschaft“ gelangen.
Folgt nun aus den Bewertungen von Energieanlagen, die sich aus den drei Landschaftsidealen ableiten lassen – wenn man zudem in Rechnung stellt, dass das konservative und das romantische Landschaftsideal in unserer Kultur große Bedeutung haben und im BNatSchG das Ziel formuliert ist, die Vielfalt und Eigenart von Landschaften zu erhalten –, dass Energieanlagen aus landschaftsästhetischer Perspektive grundsätzlich abzulehnen sind?
Diese Schlussfolgerung wäre nicht richtig, vielmehr muss man differenzieren: Einerseits gibt es viele Landschaften, die durch agro-industrielle Nutzung oder Vorbelastungen durch technische Infrastruktur bereits keine oder kaum noch schützenswerte landschaftsästhetische Qualitäten wie Eigenart und Vielfalt oder Natürlichkeit besitzen; in solchen Landschaften verursachen Energieanlagen aus landschaftsästhetischer Perspektive nur relativ geringe Beeinträchtigungen. Andererseits gibt es noch zahlreiche Landschaften mit hoher landschaftsästhetischer Qualität; in diesen wären die Beeinträchtigungen durch Energieanlagen sehr erheblich.
Entscheidend ist demnach, bei Standortentscheidungen für Energieanlagen eine räumliche Steuerung zu realisieren, in der landschaftsästhetische Qualitäten umfassend, sachlich angemessen und nachvollziehbar berücksichtigt werden; das gilt umso mehr, weil landschaftsästhetische Qualitäten eine große Rolle spielen, wenn es um die Akzeptanz von Energieanlagen in der Landschaft geht. Nur so lässt sich verhindern, dass im Rahmen oder auch Namen der notwendigen „Energiewende“ unnötig und in zu großem Maße landschaftsästhetische Qualitäten verloren gehen.
Dank
Der Aufsatz basiert auf zwei Vorträgen, die gehalten wurden auf den Tagungen „Wald – Energie – Landschaft. Wie sieht die Kulturlandschaft der Zukunft aus?“ (15.-17.02.2013, Leitung: Prof. Dr. Anton Fischer, Prof. Dr. Reinhard Mosandl und Prof. Dr. Michael Suda von der Technischen Universität München sowie Pfr. Dr. Jochen Wagner, Evangelische Akademie Tutzing) bzw. „Zukunft Landschaft: Neue Energielandschaften in der Oberpfalz“ (20.–21.06.2013, Veranstalter: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege/ANL). Den Tagungsteilnehmern danke ich für die anregenden Diskussionen, die ich in dieser Publikation berücksichtigt habe. Den anonymen Gutachtern danke ich für ihre konstruktiven Anregungen zu weiteren Verbesserungen des Manuskripts, ebenso Gisela Kirchhoff.
Literatur
Apel, F. (1998): Deutscher Geist und deutsche Landschaft. Eine Topographie. Knaus, München.
Breuer, W. (2012): Wald unter Strom. Mussen wir uns mit Windenergieanlagen im Wald abfinden? Nationalpark 2012 (1), 12-17.
Cosgrove, D.E. (1998): Social formation and symbolic landscape. The University of Wisconsin Press, Madison.
Daniels, S., Cosgrove, D.E. (1988): Introduction: iconography and landscape. In: Daniels, S., Cosgrove, D.E., eds., The iconography of landscape, Essays on the symbolic representation, design, and use of past environments, CUP, Cambridge, 1-10.
Demuth, B. (2000): Das Schutzgut Landschaftsbild in der Landschaftsplanung. Methodenüberprüfung anhand ausgewählter Beispiele der Landschaftsrahmenplanung. Mensch & Buch, Berlin.
Drexler, D. (2010): Landschaft und Landschaftswahrnehmung: Untersuchung des kulturhistorischen Bedeutungswandels von Landschaft anhand eines Vergleichs von England, Frankreich, Deutschland und Ungarn. Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken.
DRL (Deutscher Rat für Landespflege, Hrsg., 2005): Landschaft und Heimat. DRL, Meckenheim.
Eisel, U. (1982): Die schöne Landschaft als kritische Utopie oder als konservatives Relikt. Soziale Welt 33 (2), 157-168.
– (2004): Naturbilder sind keine Bilder aus der Natur – Orientierungsfragen an der Nahtstelle zwischen subjektivem und objektivem Sinn. Gaia 13 (2), 92-98.
– (2006): Landschaftliche Vielfalt mit und ohne Sinn. Über den Nutzen einer Methode in der Landschaftsplanung und im Naturschutz. In: Eisel, U., Körner, S., Hrsg., Landschaft in einer Kultur der Nachhaltigkeit, Band I: Die Verwissenschaftlichung kultureller Qualität, Universität Kassel, 92-119.
Fischer-Hüftle, P. (1997): Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft aus der Sicht eines Juristen. Natur und Landschaft 72 (5), 239-244.
Harrison, R.P. (1992): Wälder. Ursprung und Spiegel der Kultur. Hanser, München.
Herder, J.G. (1784-1791): Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Publiziert als Bände XIII und XIV in: Suphan, B., Hrsg., 1877-1913: Johann Gottfried Herder, Sämtliche Werke, Olms, Hildesheim.
Hunziker, M. (2010): Die Bedeutungen der Landschaft für den Menschen: objektive Eigenschaft der Landschaft oder individuelle Wahrnehmung des Menschen? In: Eidgenössische Forschungsanstalt WSL, Hrsg., Landschaftsqualitat, Konzepte, Indikatoren und Datengrundlagen, Birmensdorf, 33-44.
Jessel, B., Fischer-Hüftle, P., Jenny, D., Zschalich, A. (2003): Erarbeitung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben 899 82 130 des Bundesamtes für Naturschutz. BfN-Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, Bonn.
Kirchhoff, T. (2011): „Natur“ als kulturelles Konzept. Zeitschrift für Kulturphilosophie 5 (1), 69-96.
– (2012a): Pivotal cultural values of nature cannot be integrated into the ecosystem services framework. PNAS 109 (46), E3146.
– (2012b): Räumliche Eigenart. Sinn und Herkunft einer zentralen Denkfigur im Naturschutz, in Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung. Schr.-R. TLUG 103, 11-22.
–, Trepl, L. (2009): Landschaft, Wildnis, Ökosystem: Zur kulturbedingten Vieldeutigkeit ästhetischer, moralischer und theoretischer Naturauffassungen. Einleitender Überblick. In: Kirchhoff, T., Trepl, L., Hrsg., Vieldeutige Natur – Landschaft, Wildnis und Ökosystem als kulturgeschichtliche Phänomene, transcript, Bielefeld, 13-66.
–, Vicenzotti, V. (2013): A historical and systematic survey of European perceptions of wilderness. Environmental Values [pre-copyediting version], http://www.whpress.co.uk/EV/EVpapers.html (zuletzt aufgerufen: 05.11.2013).
Klessmann, E. (1979): Die deutsche Romantik. DuMont, Köln.
Köhler, B., Preiss, A. (2000): Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes – Grundlagen und Methoden zur Bearbeitung des Schutzguts „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft“ in der Planung. Inform.d. Naturschutz Nieders. 20 (1), 3-60.
LAG-VSW (Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 2007): Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Ber. Vogelschutz 44, 151-153.
LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2011): Schnellwachsende Baumarten. Anbau auf landwirtschaftlichen Flächen.
Lobsien, E. (1986): Landschaft als Zeichen. Zur Semiotik des Schönen, Erhabenen und Pittoresken. In: Smuda, M., Hrsg., Landschaft, Suhrkamp, Frankfurt/M., 159-177.
Marquardt, K. (2011): Windenergieanlagen (WEA) in der Landschaft. Unveröff. Expertise. Zitiert in: Ratzbor, G., Windenergieanlagen und Landschaftsbild, Zur Auswirkung von Windrädern auf das Landschaftsbild, http://www.dnr.de/downloads/thesenpapier-landschaftsbild.pdf (zuletzt aufgerufen: 05.11.2013).
Müller-Wille, W. (1980): Der Niederwald in Westdeutschland. In: Müller-Wille, W., Hrsg., Beiträge zur Forstgeographie in Westfalen, Geographische Kommission für Westfalen, Münster, 7-38.
Nicolson, M.H. (1959): Mountain gloom and mountain glory. The development of the aesthetics of the infinitive. Cornell University Press, Seattle.
NLT (Niedersächsischer Landkreistag e.V., 2011): Naturschutz und Windenergie. NLT, Hannover.
Nohl, W. (2006): Heimat als symbolischer Aneignungsprozess – konzeptionelle Überlegungen und empirische Untersuchungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (5), 140-145.
– (2010): Landschaftsästhetische Auswirkungen von Windkraftanlagen. Schönere Heimat 99 (1), 3-12.
Prominski, M. (2006): Landschaft – warum weiter denken? Eine Antwort auf Stefan Körners Kritik am Begriff „Landschaft Drei“. Stadt + Grün 55 (12), 34-39.
Puchert, F. (2010): Entscheidungsfaktoren in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Windenergie im Landkreis Aurich. Lang, Frankfurt/M.
Riehl, W.H. (1854): Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik. Erster Band: Land und Leute. Gotta’scher Verlag, Stuttgart.
Roger, A. (1999): La théorie du paysage en France: 1974-1994. Champ Vallon, Seyssel.
Roth, M. (2012): Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung. Entwicklung und Anwendung einer Methode zur Validierung von Verfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes durch internetgestützte Nutzerbefragungen. Rhombos, Berlin.
Schama, S. (1995): Landscape and memory. Vintage, New York.
Schnelle, W. (2012): Mühlenbau. Wasserräder und Windmühlen bewahren und erhalten. Beuth, Berlin.
Schindler, R. (2005): Landschaft verstehen. Industriearchitektur und Landschaftsästhetik im Schwarzwald. Modo, Freiburg.
Schöbel, S. (2012): Windenergie und Landschaftsästhetik: Zur landschaftsgerechten Anordnung von Windfarmen. Jovis, Berlin.
Siegmund, A. (2009): Die Vieldeutigkeit der Bilder im Landschaftsgarten. In: Kirchhoff, T., Trepl, L., Hrsg., Vieldeutige Natur – Landschaft, Wildnis und Ökosystem als kulturgeschichtliche Phänomene, transcript, Bielefeld, 163-177.
– (2011): Der Landschaftsgarten als Gegenwelt. Ein Beitrag zur Theorie der Landschaft im Spannungsfeld von Aufklärung, Empfindsamkeit, Romantik und Gegenaufklärung. Königshausen & Neumann, Würzburg.
Testa, I. (2008): Selbstbewusstsein und Zweite Natur. In: Vieweg, K., Welsch, W., Hrsg., Hegels Phänomenologie des Geistes, Suhrkamp, Frankfurt/M., 286-307.
Trepl, L. (2012): Die Idee der Landschaft. Eine Kulturgeschichte von der Aufklärung bis zur Ökologiebewegung. transcript, Bielefeld.
Umweltbundesamt (2013): Potenziale der Windenergie an Land – Studie zur Ermittlung des bundesweiten Flächen und Leistungspotentials der Windenergienutzung an Land. DessauRoßlau.
Weber, M. (1919): Wissenschaft als Beruf. Dunker & Humblot, Berlin.
Wenzel, J. (1991): Über die geregelte Handhabung von Bildern. Garten + Landschaft 91 (3), 19-24.
Anschrift des Verfassers: Dr. Thomas Kirchhoff, Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V., Arbeitsbereich Theologie und Naturwissenschaft, Schmeilweg 5, D-69118 Heidelberg, E-Mail thomas.kirchhoff@fest-heidelberg.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen





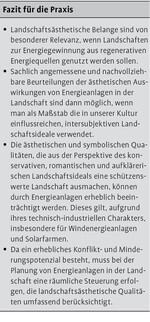
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.