Energetische Nutzung von Biomasse-Reststoffen
Bioenergiepotenziale sind stark begrenzt. Vor allem der Nutzen von Anbaubiomasse mit ihrer geringen Flächeneffizienz sowie ihrem hohen Betriebsmitteleinsatz ist für den Klima- und Naturschutz fragwürdig. Ein nachhaltig nutzbares, weitgehend unerschlossenes Potenzial besteht dagegen in der Verwertung von Biomassereststoffen. Für zwei Beispielgemeinden in Baden-Württemberg wurde daher untersucht, inwieweit sich die Bioenergienutzung in den kommunalen Landschaftsplan integrieren lässt. Neben Analysen zur Anbaubiomasse (u.a. Bestimmung von Ausschluss- und Eignungsgebieten) wurde herausgearbeitet, welchen steuernden und aktivierenden Einfluss die Landschaftsplanung haben kann, um die Nutzung biogener Reststoffe voranzutreiben. Der Beitrag gibt Hinweise für ein strukturiertes Vorgehen.
- Veröffentlicht am
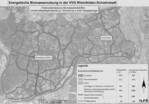
Aktivierung und Steuerung durch die Landschaftsplanung
Von Verena Marggraff und Hans-Georg Schwarz-von Raumer
Die Ziele der Energiewende sind hoch gesteckt. Mit der EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien (RL 2009/28/EG) gilt für Deutschland das verbindliche nationale Ziel, bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18 % am Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Allein im Stromsektor soll der Anteil bis dahin kontinuierlich auf 35 %, bis zum Jahr 2050 sogar auf 80 % ansteigen (EEG 2012), bei der Wärmeproduktion soll der Anteil 14 % betragen (BMU 2010). Dabei setzt man neben Wind- und Solarnutzung in hohem Maße auf die Verwendung von Biomasse.
Studien wie Crutzen et al. (2007), Butterbach-Bahl et al. (2010), Leopoldina (2012) und NBBW (2012) verdeutlichen, dass die Bioenergiepotenziale jedoch sehr begrenzt sind. Vor allem die Anbaubiomasse lässt mit ihrer geringen Flächeneffizienz sowie ihrem hohen Betriebsmitteleinsatz für Anbau, Dünger, Ernte, Transport und Verarbeitung die Klimabilanz im Allgemeinen negativ aussehen. Im Bereich der Biogasproduktion empfehlen Experten sogar, Anbaubiomasse nur vor dem Hintergrund der Stabilisierung von agrarischen Abfällen und dem fluktuierenden Energiebedarf zu nutzen (Leopoldina 2012).
Ein nachhaltig nutzbares Potenzial im Bereich der Bioenergie wird hingegen in der Verwertung von biogenen Reststoffen gesehen. Die Flächen, auf denen derartige Reststoffe anfallen, werden häufig nicht mehr für die Futtererzeugung für das Vieh benötigt, verursachen dadurch in vielen Kommunen zusätzliche Entsorgungskosten und beeinflussen durch die gängige Praxis der Kompostierung und der damit verbundenen Methanbildung die Klimabilanz negativ (Peters et al. 2009).
Um eine nachhaltige Energieerzeugung aus Biomasse gezielt voranzutreiben, wurden Möglichkeiten der steuernden Einflussnahme durch die Landschaftsplanung im Rahmen einer durch die LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) geförderten Studie untersucht (Bachmann et al. 2010; Galandi et al. 2010). Dafür wurden Anbaubiomasse und biogene Reststoffe hinsichtlich einer Integrierbarkeit in den kommunalen Landschaftsplan am Beispiel zweier baden-württembergischer Gemeinden genauer beleuchtet.
Die nachfolgenden Ausführungen heben den Teilaspekt der energetischen Biomassereststoffnutzung hervor, da vor allem hier noch großes Ausbau- bzw. Aktivierungspotenzial gesehen wird (vgl. Wirtschaftsministerium BW 2010). In der o.g. Studie wurde aufgezeigt, inwieweit sich eine Potenzialanalyse zum Aufkommen von biogenen Reststoffen in die Planungsphasen des Landschaftsplans integrieren lässt, und es wurden Empfehlungen für eine systematische Vorgehensweise abgeleitet.
Landschaftsplanung stellt einen Planungsprozess dar, in dem Natur und Landschaft adressiert und dabei unterschiedliche Planungsphasen durchlaufen werden. Der „baden-württembergische Weg“ unterscheidet so die Phasen Orientierung, Analyse, Zielkonzept, Alternativen, Raumverträglichkeit und Leitbild, Handlungsprogramm sowie Beobachtung (Hage & Bachmann 2012). Die spezifischen Anforderungen und Voraussetzungen der jeweiligen Gemeinde werden in diese Planungsphasen aufgenommen. Im landschaftsplanerischen Kontext besteht die Möglichkeit, die Vorkommen von räumlich relevanten Biomassereststoffen in Karten darzustellen und auf Grundlage der vorhandenen Flächen und Ausgangssubstrate das energetisch verwertbare Mengen- bzw. Flächenpotenzial zu quantifizieren. Für die Studie „Energetische Biomassenutzung und Landschaftsplanung“ (Bachmann et al. 2010) wurden dafür die einzelnen Planungsphasen themenspezifisch aufgearbeitet.
Am Beispiel der drei Planungsphasen Orientierung, Analyse sowie Raumverträglichkeit und Leitbild soll die Methode hier im Ansatz vorgestellt werden. Die Arbeitsschritte einer Potenzialanalyse zur räumlichen Verteilung von Reststoffen in der Landschaft konnten direkt in die Analysephase integriert werden.
(1) Die Orientierungsphase dient der grundsätzlichen Klärung der spezifischen Ausgangssituation in der Gemeinde und ihrer zukünftigen Ziele. Orientierende Fragestellungen zur energetischen Reststoffnutzung, die in dieser ersten Phase auszuloten sind, konnten wie folgt skizziert werden:
Wie hoch ist das Interesse der Gemeinde, sich am Klimaschutz zu beteiligen? (Die energetische Nutzung von Biomassereststoffen bietet besonders hohes Potenzial, erfordert aber einen relativ hohen Aktivierungsaufwand.)
Welche Synergieeffekte mit dem Naturschutz und mit anderen kommunalen Interessen (z.B. Einsparung von Entsorgungskosten) sind zu erwarten?
Von welchem Potenzial an Biomassereststoffen kann in der Gemeinde ungefähr ausgegangen werden?
Wie hoch wird die Bereitschaft der einzelnen Akteure (z.B. Landwirte, Anlagenbetreiber, Energienutzer) eingeschätzt, dieses Potenzial zu aktivieren?
Gibt es in der Region Institutionen wie Arbeits- und Beschäftigungsförderungen? Lassen sich hier Arbeitskräfte akquirieren, die im Hinblick auf Bergung, Transport, Sortierung usw. der dezentral anfallenden Reststoffe eingesetzt werden können?
Wo befinden sich bereits vorhandene oder geplante Biogasanlagen und Heizkraftwerke? Mit welcher technologischen Ausstattung und Kapazität arbeiten diese (z.B. Nass- oder Trockenfermentation)? Lassen sich anfallende Reststoffe in bestehenden Anlagen mit verwerten?
Gibt es kommunale Kompostplätze/Grüngutsammelplätze? Wie viel Biomasse fällt dort an? Besteht Interesse, Alternativen zur klassischen Kompostierung auszubauen?
Wo befinden sich möglichst viele potenzielle Wärmeabnehmer (öffentliche Einrichtungen, Gewerbegebiete etc.)? Sind die Gemeinden am Aufbau eines Nahwärmenetzes interessiert?
Wo befinden sich die Kläranlagen der Gemeinden? Wie wird der Klärschlamm bisher verwendet?
Gibt es ein Trennsystem für biogenen Hausmüll („braune Tonne“ o.Ä.)? Falls nicht, ist eine Einführung sinnvoll?
(2) In der Analysephase werden nach Hage & Bachmann (2012) der Naturhaushalt und die Landschaft beschrieben und hinsichtlich Nutz- und Schutzwürdigkeit bewertet. Hierzu können Potenzialerhebungen zum Aufkommen von Biomassereststoffen zählen. Eine besondere Rolle spielen dabei Landschaftspflegematerialen, da aus ihrer Nutzung generell Synergieeffekte mit den Zielen von Natur und Landschaft resultieren können.
Auf Ebene der kommuna-len Landschaftsplanung erweist sich die Berücksichtigung des technischen Potenzials als zielführend. Für die beiden untersuchten Beispielgemeinden wurde das technische Potenzial an Reststoffen erhoben, das ggf. für eine Vergärung in einer Biogasanlage zur Verfügung stünde. Grundlage für die Berechnungen waren GIS-Analysen der unterschiedlichen Flächentypen (Grünland, Streuobstwiesen, Ackerland, Infrastruktur, Gewässer u.a.) und deren Flächenpotenzial. Darauf aufbauend konnten Abschätzungen der durchschnittlichen Zuwachsraten der Biomassen (Mengenpotenzial) anhand von Faustzahlen erfolgen. Reststoffe wie biogener Hausmüll, Abfallprodukte aus Industrie und Gewerbe und tierische Exkremente, die nicht aus der Landschaftspflege stammen, können in einer Gesamtkalkulation ergänzend mit aufgenommen werden.
Es liegt nahe, auf diejenigen raumrelevanten Reststofffraktionen zu fokussieren, die im Landschaftsplan kartographisch dargestellt werden können und darüber hinaus Synergieeffekte mit den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erwarten lassen. In den untersuchten Gemeinden wurden dafür folgende Fraktionen genauer betrachtet:
Biomasse von Straßen- und Gewässerrändern,
Biomasse von Säumen und Brachen im Ackerland,
Biomasse aus der Streuobstwiesenpflege,
Biomasse von kommunalen Ausgleichsflächen,
holzige Biomasse aus der Pflege von Offenlandgehölzen (Landschaftspflegeholz),
landwirtschaftliche Reststoffe (z.B. Grünschnitt aus Überschussgrünland, Reststroh im Ackerland, tierische Exkremente),
Restholz aus Forsten.
(3) Ein raumverträgliches Leitbild stellt Vorschläge zur weiteren Entwicklung der Landschaft heraus. Zur Aktivierung der Biomassepotenziale sollen zum einen die Möglichkeiten zur energetischen Nutzung ausgeschöpft werden, zum anderen können gleichzeitig Sicherungs- und Entwicklungsziele der Schutzgüter erfüllt werden. Ein mögliches Leitbild konnte wie folgt skizziert werden:
Die Gemeinden wollen sich verstärkt für den Klimaschutz einsetzen und sind an innovativen Lösungen interessiert. Es werden sowohl krautig-halmgutartige als auch holzige Biomasse aus der Landschaftspflege energetisch genutzt, die durch weitere Reststoffe wie beispielsweise biogenen Hausmüll und tierische Exkremente mengenmäßig noch ergänzt werden. Reststoffe werden zu Wertstoffen. Eine effektive energetische Verwertung wird nach kaskadischem Nutzungsprinzip sowie in Kraft-Wärme-Kopplung gewährleistet. Dafür kommen moderne Technologien in dezentralen Lösungen zum Einsatz. Durch ein angepasstes Pflegemanagement entstehen Synergieeffekte mit Naturschutzinteressen und die Wertschöpfung innerhalb der Kommunen wird nachhaltig gestärkt.
Fazit. Vor dem Hintergrund einer beschleunigten Energiewende ist es mehr denn je notwendig, mit planerischen Instrumenten auf eine nachhaltige Landschaftsentwicklung hinzuwirken. Im Ergebnis der Studie hat sich gezeigt, dass der Landschaftsplan ein adäquates Instrument zur Aktivierung und Steuerung bisher ungenutzter Flächen- und Mengenpotenziale raumrelevanter Biomassereststoffe darstellt. Kartenmaterial und textliche Ausführungen zur Strukturierung von Orientierungsrahmen, Zielkonzeption, Leitbild, Handlungsprogramm und Beobachtung, wie im Beitrag angedeutet, helfen hier.
Auf Grundlage standörtlicher und kulturlandschaftlicher Gegebenheiten können in der Analysephase zusätzlich nutzbare Reserven an biogenen Reststoffen aufgezeigt und so in der Gemeinde kommuniziert werden. Daraus lassen sich konkrete Empfehlungen ableiten. Durch die landschaftsplanerisch aufbereitete Potenzialerhebung liegt den Gemeinden im Vorfeld eine Basis für die spätere Auswahl optimierter Anlagenstandorte und technologien im Bioenergiesektor vor. Weitere Studien sollten gezielt darauf hinwirken, auch Reststofffraktionen in nachhaltige Energiekonzepte mit einzubinden. Der technische Fortschritt im Bereich der Bioenergieproduktion erlaubt es zunehmend, auch problematische Biomassen (z.B. aus der extensiven Landschaftspflege) einzusetzen und förderpolitische Instrumentarien wie der Landschaftspflegebonus und die Deckelung von Anbaubiomasse bei der Biogasproduktion (EEG 2009) machen ihren Einsatz immer attraktiver.
Literatur
Bachmann, J., Ganlandi, R., Hage, G., Marggraff, V., Reeg, T. (2010): Energetische Biomassenutzung und Landschaftsplanung. Unveröff. Studie im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg.
BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2010): http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/42038/40870/, Abgerufen am: 14.01.2010.
Butterbach-Bahl, K., Leible, L., Kälber, S., Kappler, S., Kiese, R. (2010): Treibhausgasbilanz nachwachsender Rohstoffe – wissenschaftliche Kurzdarstellung. Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Crutzen, P.J., Mosier, A.R., Smith, K.A., Winiwarter, W. (2007): N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. ACPD7, 11191-11205, 2007.
EEG (2009): Erneuerbare-Energien-Gesetz in der Fassung vom 01.01. 2012: http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2012_bf.pdf (abgerufen am 01.10.2012).
Galandi, R., Reeg, T., Marggraff, V. (2010): Landschaftsplanung und Eingriffsregelung – energetische Biomassenutzung und kommunale Landschaftsplanung. Naturschutz-Info 1/2010, 42-46.
Hage, G., Bachmann, J. (2012): Leitfaden für die kommunale Landschaftsplanung in Baden-Württemberg. Der Landschaftsplan im Detail. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW, Hrsg.). http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/41319/ (abgerufen am 20.10.2012).
Leopoldina (2012): Empfehlungen Bioenergie: Möglichkeiten und Grenzen. Kurzfassung. http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/201207_Stellungnahme_Bioenergie_kurz_de_en_final.pdf (abgerufen am 01.10.2012).
NBBW (Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg, 2012): Energiewende – Implikationen für Baden-Württemberg: http://www.nachhaltigkeitsbeirat-bw.de/mainDaten/dokumente/energiegutachten2012.pdf (abgerufen am 15.09. 2012).
Peters, W., Schönthaler, K., Marggraff, V., Kaufmann, P., Krismann, A., Jennemann, C. (2009): Kommunalverbund Voralb EU-Leuchtturmprojekt „EULE Genial Voralb“. Abschlussbericht zum Teilbeitrag Bioenergieerzeugung aus Biomassereststoffen –Ausführliche Darstellung. Bosch & Partner.
Wirtschaftsministerium BW (Baden-Württemberg) (2010): http://bio-pro.de/magazin/thema/00167/ index.html?lang=de&artikelid=/artikel/04720/index.html (abgerufen am 01.02.2013).
Anschrift der Verfasser(in): Dipl.-Ing. Verena Marggraff und Dr. Hans-Georg Schwarz-von Raumer, Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart, Keplerstraße 11, D-70174 Stuttgart, E-Mail verena.marggraff@ilpoe.uni-stuttgart.de und svr@ilpoe.uni-stuttgart.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.