Extensive Ganzjahresbeweidung mit Pferden auf orchideenreichen Kalk-Halbtrockenrasen
Abstracts
Die positiven Effekte auf die Arten- und Strukturvielfalt in großflächigen Weidelandschaften sind durch zahlreiche Studien belegt. Am Beispiel einer Plateaulage in den „Toten Tälern“ wird gezeigt, dass eine extensive Ganzjahresbeweidung auch die Möglichkeit des gezielten Managements von Offenland-Lebensräumen nach der FFH-Richtlinie bietet. Auf einem ehemals militärisch genutzten, stark verbrachten Kalk-Halbtrockenrasenstandort mit (noch) zahlreichen Orchideenvorkommen wurde 2009 eine Ganzjahresweide mit Koniks etabliert.
Wesentliche Ergebnisse der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle sind der Erhalt der typischen Artengemeinschaften der Kalk-Halbtrockenrasen und wertgebender Orchideenvorkommen sowie eine deutliche Verbesserung der lebensraumtypischen Strukturen. Maßgeblich dafür ist die gleichmäßige Nutzung der Weidefläche durch die Weidetiere. Die Gehölzentwicklung ist im Gebiet aufgrund des winterlichen Verbisses durch die Weidetiere in Verbindung mit den ausgeprägten Trockenphasen überwiegend unproblematisch. Die untersuchten faunistischen Artengruppen reagierten bisher positiv bzw. blieben in ihrem Bestand stabil.
Low-intensity Horse Grazing on Orchid-rich Calcareous Grasslands – Effects in the Natura 2000 site “Tote Täler südwestlich Freyburg” in Saxony-Anhalt
Numerous studies have established the positive effects on plant and animal species and on the structural diversity of large herbivores grazing. Using the example of the Natura 2000 Site “Tote Täler südwestlich Freyburg” the study shows that this management regime is suitable to maintain and improve calcareous grasslands in accordance with the Habitats Directive. In 2009 a horse pasture (horse breed: Koniks) was established on the former military training area accompanied by scientific monitoring. The calcareous grasslands retained many orchid species but still showed intensive grass encroachment. Main results of the monitoring were that the species communities typical for calcareous grasslands and the orchid species could be maintained, and the vegetation structures could be significantly improved through an evenly distributed pasturing of the entire site. Due to winter browsing and dry soil conditions encroachment by shrub species could be significantly restricted. The studied groups of animals increased or remained stable.
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
Die positiven Effekte großflächiger extensiv genutzter Standweiden mit robusten Megaherbivoren (Weidelandschaften) hinsichtlich der Arten- und Strukturvielfalt auf Landschaftsebene sind durch zahlreiche Studien belegt (u.a. Riecken et al. 2004). Die ihnen zugrunde liegenden Mechanismen und Prozesse wurden aktuell in Rosenthal et al. (2012) zusammengefasst. Wenig ist dagegen zu den Möglichkeiten des gezielten Managements von Offenland-Lebensräumen nach der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) durch extensive Ganzjahresweiden bekannt. In den für diese Lebensräume ausgewiesenen Schutzgebieten ist die Sicherung eines mindestens guten Erhaltungszustands bzw. die Wiederherstellung dessen ein prioritäres Ziel. In der Naturschutzpraxis werden zur Erreichung dieses Zieles überwiegend traditionelle, sich in der Vergangenheit bewährte Formen des Offenlandmanagements empfohlen. Für die hier behandelten Kalk-Halbtrockenrasen sind das die Hütehaltung oder die Koppelbeweidung mit Schafen und Ziegen (Beinlich et al. 2009). In Regionen, wo diese traditionellen Formen der Magerrasenpflege etabliert sind und sich regionale Akteursgruppen für deren Erhalt engagieren, sollte deshalb auch unbedingt durch entsprechende Förderinstrumente und Unterstützung regionaler Vermarktungsstrategien die wirtschaftliche Nachhaltigkeit gesichert werden (u.a. Rühs et al. 2005).
In vielen Regionen Deutschlands sind aber aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation im Vergleich zu den oft ausgedehnten Magerrasen nur noch sehr wenige (Klein-) Tierhalter aktiv (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2011). Die Folge sind großflächig unterbeweidete oder brachfallende Flächen, die durch einen zunehmenden Verlust an Tier- und Pflanzenarten gekennzeichnet sind (Beinlich et al. 2009, Poschlod et al. 2005). In der ersten Sukzessionsphase sind oft eine zunehmende Vergrasung, Verfilzung und Verbuschung mit Polykormonsträuchern zu verzeichnen.
Die Wiederherstellung solcher verbrachter Halbtrockenrasen steht vor einer großen Herausforderung: Es muss ein für diese Region wirtschaftlich nachhaltiges Nutzungskonzept entwickelt werden, das einerseits in der Lage ist, die Pflegedefizite zurückzuführen, aber andererseits auch während dieser Wiederherstellungsphase den Erhalt der (noch) vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sichert. Oft müssen in dieser Phase höhere Besatzstärken der Weidetiere zum Einsatz kommen, um nachhaltig eine fortgeschrittene Verfilzung und Verbuschung zurückzuführen (siehe auch Elias et al. eingereicht). Sind die Ursachen für das Pflegedefizit in regional nicht oder nur unzureichend verfügbaren Schaf- und Ziegenbeständen zu suchen, müssen zudem alternative Nutzungskonzepte getestet werden.
In dem hier vorgestellten Beispiel wurde das Experiment gewagt, auf einem stark verfilzten und vergrasten Kalk-Halbtrockenrasenstandort (Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati mit Dominanzbeständen der Aufrechten Trespe – Bromus erectus) mit (noch) zahlreichen Orchideenvorkommen eine Ganzjahresweide mit Koniks zu etablieren.
Während es für den Erhalt anderer Offenland-Lebensraumtypen durch Megaherbivorenweiden bereits positive Fallstudien gibt (Heiden: Felinks et al. 2012 und Lorenz et al. im Druck, Auengrünland: Mann & Tischew 2010a, b, Schaich & Barthelmes 2012), wird der Einsatz von Megaherbivoren auf Kalk-Magerrasen bislang eher kritisch gesehen (Seifert et al. 2006). Das betrifft vor allem auch den Einsatz von Pferden, die nach Aussagen in der Literatur durch die Anlage von Latrinen, Meidung dieser Bereiche zur Futteraufnahme und eine insgesamt sehr ungleichmäßige Raumnutzung negative Effekte in Bezug auf die Ausprägung von Zielgesellschaften bewirken (u.a. Edwards & Hollis 1982, Kleyer et al. 2004). Zudem wurden von regionalen Experten zahlreiche Bedenken in Bezug auf den Erhalt der noch vorhandenen Orchideenpopulationen im Gebiet geäußert. Nicht zuletzt war auch die Umzäunung des fast 100ha großen Gebietes Gegenstand starker Kritik. Eine umfassende naturschutzfachliche Erfolgskontrolle und Öffentlichkeitsarbeit sollte deshalb das 2009 gestartete Projekt begleiten. Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden folgende Fragestellungen beantwortet:
(1) Kann die ganzjährige extensive Beweidung mit Pferden eine ausgewogene Raumnutzung der Kalk-Halbtrockenrasen garantieren?
(2) Können die typischen Artengemeinschaften und lebensraumtypischen Habitatstrukturen der Kalk-Halbtrockenrasen (FFH-LRT 6210*) gemäß FFH-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (92/43/EWG) erhalten bzw. wiederhergestellt werden?
(3) Können durch diese Form der Beweidung Verbuschungstendenzen aufgehalten werden?
2 Charakteristika des Unter- suchungsgebietes und Methoden
Das Untersuchungsgebiet umfasst die 87ha große Beweidungsfläche in der Plateaulage des Naturschutzgebietes „Tote Täler“ (Abb. 1). Neben historischen Steinbrüchen war das Gebiet bis in die 1950er-Jahre von Ackerflächen, Brachen und Gebüschgruppen, anschließend durch militärische Nutzung geprägt. Nach Abzug der Truppen 1992 und Eingliederung in das seit 1967 bestehende NSG „Tote Täler“ 1995 erfolgte zum Erhalt der Halbtrockenrasen eine Schafhutung mit zu geringer Besatzstärke. Zu Beginn der Megaherbivorenbeweidung waren überwiegend stark verfilzte, grasreiche Halbtrockenrasen des FFH-Lebensraumtyps „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) in prioritärer Ausprägung mit besonderen Beständen bemerkenswerter Orchideen (6210*)“ verbreitet. Trotz vieler Verbrachungszeiger (v.a. ausdauernde Ruderalarten) war das Arteninventar des LRT 6210* jedoch noch weitgehend vollständig erhalten.
Das Gebiet weist eine Gesamtartenzahl von ca. 320 Gefäßpflanzenarten auf. Neben individuenreichen Vorkommen von Braunroter Sitter (Epipactis atrorubens), Großes Zweiblatt (Listera ovata), Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea), Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Helm- (Orchis militaris) und Purpur-Knabenkraut (O. purpurea) in den Ökotonbereichen sind die offenen Bereiche flächig mit einer überregional bedeutsamen Population der Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) bestanden, die sich in Sachsen-Anhalt an ihrer nordöstlichen Arealgrenze befindet. Aufgrund der ausgeprägten Trockenphasen war die Verbuschung zu Projektbeginn gering: Einzelne Gebüschgruppen von Rosen (Rosa spp.), Weißdorn (Crataegus spp.) und Schlehe (Prunus spinosa) prägen die halboffene Landschaft.
Die Avifauna ist mit 37 Brutvogelarten, die Tagfalter- und Widderchenfauna mit 56 Arten bedeutsam (Stand 2012). Eine Population der vom Aussterben bedrohten Rotflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) bildet das zweitnördlichste Vorkommen in Mitteleuropa.
Im Mai 2009 begann die Megaherbivorenbeweidung mit der Robustrasse Konik mit einer Besatzstärke von ca. 0,3GVE/ha. Jeden Herbst wurde die Besatzstärke durch Entnahme des Reproduktionszuwachses stark herabgesetzt (ca. 0,15GVE/ha) und gegen Winterende mit neuen Stuten auf ca. 0,2GVE/ha erhöht. Eine geringe Zufütterung erfolgte nur in den schneereichen Wintern 2010 und 2011 (2400kg bzw. 3300kg).
Die naturschutzfachliche Erfolgskontrolle erfolgt gemäß der Empfehlungen von Lorenz et al. (im Druck) auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (siehe Tab. 1). Durch Eichung der Telemetriedaten mit den direkten Weidetierbeobachtungen konnten mittels Diskriminanzanalyse die Aktivität „Fressen“ klassifiziert und die räumlichen und zeitlichen Präferenzen der Herde mit einer Kerndichteanalyse dargestellt werden.
3 Ergebnisse
3.1 Raumnutzung der Weidetiere
Die Analysen zur Raumnutzung der Weidetiere zeigen, dass die Weide mit Ausnahme der vegetationsarmen Steinbrüche relativ gleichmäßig zur Futteraufnahme genutzt wird (Abb. 1). Tendenziell weniger genutzt werden nur die von der zentralen Fläche (inkl. Tränke) sehr weit entfernten Randbereiche. Im Winter werden jedoch diese Randbereiche in ähnlicher Intensität wie die zentrale Weidefläche genutzt (Abb. 2). Da die Geländebeobachtungen vor allem in den Wintermonaten einen verstärkten Gehölzverbiss zeigten, ist in Bezug auf die gewünschten Effekte zur Offenhaltung des Gebietes die Winterbeweidung von maßgeblicher Bedeutung. Die Lage der Tränke wirkt sich vor allem in Trockenphasen auf die räumliche Nutzung aus. In der übrigen Zeit ist das Nutzungsmuster weniger abhängig von der Tränke, da zur Wasseraufnahme auch temporäre Gewässer oder Schnee genutzt werden. Aufgrund der relativ gleichmäßigen Ausprägung der Vegetation sind die Unterschiede im räumlichen Fraßverhalten zwischen den Jahreszeiten generell gering.
Weitergehende Analysen zur Verteilung unterschiedlicher Vegetationsbestände zeigten, dass es nicht zur Ausbildung von nitrophilen (Hochstauden-)Fluren infolge Latrinenbildung kam. Auch die Entwicklung von Weiderasen ist mosaikartig über die Gesamtfläche verteilt und ihre Verteilung dynamisch.
3.2 Lebensraumtypisches Arteninventar
Das lebensraumtypische Arteninventar als elementarer Baustein zur Bewertung des Erhaltungszustandes des FFH-Lebensraumtyps Naturnahe Kalk-Trockenrasen (6210*) blieb über den gesamten Beweidungszeitraum stabil. Das trifft auch auf die Arten niedrigerer Deckung im Ausgangsbestand zu (siehe Tab. 2). Auf den Kontrollflächen ist dagegen durch die Verschlechterung der Vegetationsstruktur ein Trend zur Abnahme der Artenzahlen zu verzeichnen.
Die häufigste und überregional bedeutsame Orchideenart Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) kommt auch nach vier Jahren Beweidung in einer Gesamtpopulation von mehr als 1900 Individuen vor. Der auf den 14 Dauerbeobachtungsflächen untersuchte Bestand hat sich seit Beweidungsbeginn von 109 Individuen 2009/2010 zu 88 Individuen 2012 nur unwesentlich verändert. Andere Populationen der Bienen-Ragwurz in Sachsen-Anhalt weisen in diesem Zeitraum ebenfalls scheinbare Individuenrückgänge auf (Hoch 2012 mdl.).
3.3 Lebensraumtypische Habitatstrukturen
Neben dem lebensraumtypischen Arteninventar sind nach der FFH-Richtlinie die lebensraumtypischen Habitatstrukturen maßgeblich für die Bewertung des Erhaltungszustands (siehe Tab. 3). Als wesentliche Indikatoren dienen die Strukturvielfalt und der Kräuteranteil. Insbesondere die Dominanz von Polykormonbildnern und/oder hochwüchsigen Horstgräsern führt zu einer schlechten Bewertung der Ausprägung des Lebensraumtyps Kalk-Trockenrasen (6210*). Diese Vergrasungsstadien werden im behandelten Gebiet maßgeblich durch die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) und die Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) geprägt. Seit Beweidungsbeginn 2009 sind v.a. bei der Aufrechten Trespe deutlichere Rückgänge zu verzeichnen.
Dementsprechend reduzierte sich der Gräseranteil um etwa 20%, der Kräuteranteil erhöhte sich. Die Krautschichtdeckung nahm insgesamt leicht ab. Durch die Trittwirkung der Weidetiere leicht ansteigende offene Bodenstellen sind in Bezug auf Habitatstrukturen für Tiergruppen positiv zu bewerten. Die ohnehin geringe Gehölzdeckung konnte im Status quo gehalten werden, ebenso wurde die Streubildung der Krautschicht, welche die Etablierung konkurrenzschwacher Pflanzenarten hemmt, fast halbiert. Der Dung ist gleichmäßig verteilt (keine Ausbildung von Geilstellen) und seine Menge bisher gering (mittlere Deckung 0,1%).
Der zu Beweidungsbeginn ungünstige Erhaltungszustand des Lebensraumtyps 6210* war ausschließlich auf die schlechte Ausprägung der lebensraumtypischen Habitatstrukturen (Pflegedefizit!) zurückzuführen. Durch die extensive, ganzjährige Beweidung mit Pferden konnten die Habitatstrukturen schnell in einen nach der FFH-Kartieranleitung SachsenAnhalts (LAU 2010) günstigen Zustand zurückgeführt und gleichzeitig das lebensraumtypische Arteninventar erhalten werden.
Der Vergleich der beweideten Plots mit den unbeweideten Kontrollplots hinsichtlich ausgewählter lebensraumtypischer Habitatstrukturen zeigt, dass im Gegensatz zu der deutlichen Streuabnahme auf den beweideten Plots diese auf den Kontrollflächen im Median weiter zunimmt und zu einer weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes führt (siehe Abb. 4). Der deutlichen Zunahme des Kräuteranteils an der Krautschicht auf den beweideten Flächen (teilweise bereits Erhaltungszustand A!) steht eine nur geringe Zunahme auf den unbeweideten Kontrollflächen gegenüber (siehe Abb. 5).
3.4 Gehölzentwicklung
Die auf vielen beweideten Kalk-Halbtrockenrasen problematische natürliche Gehölzentwicklung wird sowohl durch den Verbiss der Weidetiere als auch durch die ausgeprägten Trockenphasen begrenzt. Die Entwicklung der mittleren Gehölzdeckung weist im Verlauf von vier Beweidungsjahren lediglich marginale Veränderungen auf. Interessant ist dabei, dass auch in Teilbereichen, in denen zu Beweidungsbeginn eine höhere Gehölzdeckung vorhanden war, keine rasante Zunahme stattgefunden hat.
3.5 Faunistische Artengruppen
Die Anzahl der in den Roten Listen Sachsen-Anhalts (Stand: LAU 2004) geführten Arten ist verhältnismäßig hoch: sechs Vogelarten, drei Heuschreckenarten, 25 Tagfalter- und Widderchenarten. Heidelerche (Lullula arborea), Neuntöter (Lanius collurio) und Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) sind zudem Arten der europäischen Vogelschutz-Richtlinie, Anhang I. Seit Beweidungsbeginn konnten von der gefährdeten Schlingnatter (Coronella austriaca) 18 Individuen erfasst und ein Reproduktionsnachweis erbracht werden. Ihre Populationsgröße wird aktuell auf 25 bis 64 adulte Individuen geschätzt. Die faunistischen Untersuchungen zeigen bisher keine negativen Auswirkungen durch die Megaherbivorenbeweidung. Im Gegenteil, in der Avifauna sind erste Bestandserhöhungen bei mehreren wertgebenden Brutvogelarten, insbesondere der Heidelerche (Lullula arborea) (Anstieg von acht Revieren 2010 auf 15 Reviere 2012) und Grauammer (Emberiza calandra) (Anstieg von 13 Revieren 2010 auf 16 Reviere 2012), zu verzeichnen. Die Anzahl der Reviere weiterer Zielarten für die extensive halboffene Weidelandschaft liegt für den Neuntöter (Lanius collurio) bei 23, für die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) bei fünf und für den Wendehals (Jynx torquilla) bei 13 (detaillierte Ergebnisse siehe Freuck im Druck). Die mittleren Artenzahlen der Heuschrecken auf den Makroplots betragen 9,6 (2010), 7 (2011) und 10,3 (2012). Die mittleren Artenzahlen der Tagfalter und Widderchen bleiben mit 7,5 (2010), 8,7 (2011) und 8,2 (2012) konstant, wobei die mittleren Individuenzahlen kontinuierlich ansteigen: 58,2 (2010), 70,2 (2011) und 131,7 (2012). Auch deutschlandweit besonders gefährdete und schützenswerte Arten wie beispielsweise die Berghexe (Chazara briseis) blieben in ihrem Bestand stabil.
4 Diskussion
Im Unterschied zu anderen Fallstudien mit einer Megaherbivorenbeweidung können wir in unserem Projektgebiet eine annähernd gleichmäßige Raumnutzung feststellen. Lediglich weiter entfernt liegende Randbereiche werden etwas seltener aufgesucht. Diese Randbereiche sind durch Auszäunungen von Vorwaldbereichen von der Hauptweidefläche nur durch relativ schmale Korridore zu erreichen. Aufgrund forstrechtlicher Belange waren diese Auszäunungen nicht zu vermeiden. Eine stärkere Nutzung von entfernt liegenden Randbereichen könnte durch eine generelle Erhöhung der Besatzstärke erreicht werden, was aber zu naturschutzfachlich unerwünschten Sekundäreffekten wie eine stärkere Verbiss- und Trittwirkung auf wertgebende Arten wie z.B. Orchideen führen könnte.
In einigen dieser Bereiche führte das Pflegedefizit, das bereits vor Beweidungsbeginn vorgefunden wurde, zur Notwendigkeit, durch den Flächennutzer Entbuschungsmaßnahmen (ca. 2ha) durchführen zu lassen. Eine geringere Nutzungsintensität in Teilbereichen ist aber nicht zwingend negativ zu bewerten: Einige Orchideenarten kommen hier gehäuft vor und lichte Verbuschungsstadien am Rand von blütenreichen offenen Flächen stellen wichtige (Teil-)Habitate für Tierarten dar, v.a. für Vögel und Tagfalter. Ebenso sind Einzelgehölze und Gebüschgruppen als wichtige Bruthabitate und Ansitzwarten für die Avifauna erhalten geblieben (Freuck im Druck), was dem Ziel der Entwicklung einer halboffenen Weidelandschaft entspricht.
Im Allgemeinen ist die Gehölzentwicklung im Vergleich mit anderen Projekten und Lebensraumtypen, in denen bei Ganzjahresbeweidung häufig schneller eine deutliche Verbuschung auftritt (u.a. Buttenschøn & Buttenschøn 2001, Cornelissen & Vulink 2001), im behandelten Gebiet unproblematisch. Ursachen sind in dem bereits zu Projektbeginn relativ geringen Verbuschungsgrad (12%) und dem Vorkommen von schmackhafteren Arten wie Kirsche (Prunus cerasus, P. avium), Ahorn (Acer spp.) und Schneeball (Viburnum lantana) zu sehen. Weniger präferierte Arten wie Birke (Betula pendula) fehlen. Auch der anstehende Muschelkalk mit geringer Bodenauflage und die Niederschlagsarmut wirken einem raschen Gehölzaufkommen entgegen.
Bisher ist im Untersuchungsgebiet keine Ausbildung von Latrinen (ausgeprägte Geilstellen) vorzufinden. Das steht im Gegensatz zu den Untersuchungen von Edwards & Hollis (1982, Beweidung mit Rindern, Ponys und Damhirschen), Kleyer et al. (2004, Beweidung mit Ponys) sowie Süss & Schwabe (2007, Eselbeweidung). Vielmehr ist der Dung (auch jahreszeitlich gesehen) relativ gleichmäßig über die gesamte Weide verteilt und es werden Dungbereiche im Folgejahr beweidet, ohne dass bisher ein verstärkter Parasitenbefall aufgetreten ist. Durch den Verzicht auf Antibiotika und einen niedrig dosierten Einsatz von Entwurmungsmitteln ist ein guter Abbau des Dungs gewährleistet, ohne dass die Tiergesundheit gefährdet war.
Analog zu den Berichten von Bolz (2005) von bayerischen Pferdeweiden zeigen sich auch in unserem Projektgebiet bisher eher positive Effekte des Dungeintrags, insbesondere in Hinblick auf eine Erhöhung der Biodiversität: Die in Sachsen-Anhalt als ausgestorben angenommene koprophile Pilzart Punktierte Porenscheibe (Poronia punctata) ist erstmals wieder aufgetreten (Nachweis durch Huth 2013 mdl.). Die Problematik des lokalen Nährstoffeintrags ist im Projektgebiet aufgrund der Limitierung der Nährstoffverfügbarkeit in ausgeprägten Trockenphasen weniger gegeben; im Gegensatz zu anderen Pferdeweiden (Seifert et al. 2006) haben sich nitrophile Ruderalpflanzen bisher nicht ausgebreitet. Ähnliche Ergebnisse erzielte auch Strohwasser (2005) in unterschiedlichen Lebensräumen im Allgäu: Die Pferdebeweidung führte nicht zur Eutrophierung von nährstoffarmen Standorten wie kalkreiche Steinböden mit Pionier- und Halbtrockenrasen.
Ein wesentliches Ergebnis des Projektes ist der Erhalt der typischen Artengemeinschaften der Kalk-Halbtrockenrasen und eine deutliche Verbesserung der Habitatstrukturen trotz der Umstellung von einer Schafhutung auf eine extensive Ganzjahresweide mit Megaherbivoren. Bei einer Umstellung eines vormals traditionellen Nutzungsregimes auf alternative Bewirtschaftungsformen wird von einigen Autoren generell ein Verlust von Arten befürchtet oder nachgewiesen (u.a. Fischer & Wipf 2002). Wie auch bei der Umstellung einer Mahdnutzung auf die Beweidung mit Megaherbivoren (Heckrinder und Przewalski) im Wulfener Bruch (Mann & Tischew 2010a, b) konnten durch das hier vorgestellte Projekt diese Befürchtungen widerlegt werden. Im Gegensatz zu den Erfahrungen von Seifert et al. (2006) ist durch die ganzjährige extensive Beweidung mit Pferde-Robustrassen auch keine Verbrachung durch Vermeidung von Bereichen zur Futteraufnahme eingetreten. Vor allem die Streudecke konnte durch die Koniks sehr gut reduziert werden (siehe auch Strohwasser 2005). Vom Vermögen der Pferde(-artigen), qualitativ niedriger-wertiges Futter durch eine vermehrte Aufnahme zu kompensieren, berichten auch Duncan et al. (1990). Dadurch sind Pferde (oder auch Esel) im Gegensatz zu Wiederkäuern gut geeignet, die Vergrasung eines Halbtrockenrasens zurückzudrängen (siehe auch Süss & Schwabe 2007).
Eine ganzjährige Megaherbivoren-Beweidung wurde vor allem hinsichtlich des Erhalts der Orchideenvorkommen stark in Frage gestellt. In der Literatur gibt es zwar einige wenige Beispiele zum Erhalt orchideenreicher Halbtrockenrasen, die zumindest temporär mit Megaherbivoren beweidet werden (Beinlich et al. 2009). Ganzjährige Beweidungsprojekte auf trockenen, kalkhaltigen Orchideenstandorten sind uns jedoch nicht bekannt. Da der Bestand der Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) auf der hier behandelten Weidefläche bisher keinen Rückgang zeigt und zudem die Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum) erstmalig nach etwa 70 Jahren für das Gebiet wieder nachgewiesen wurde (Schroth 2013 mdl.), ist momentan vom Erfolg des Managements auszugehen.
Die extensive, ganzjährige Beweidung wirkt sich auch positiv auf die wertgebenden Brutvogelarten Heidelerche (Lullula arborea) und Grauammer (Emberiza calandra) aus, ein Ergebnis, das für die Heidelerche auch Öko & Plan (2012) auf ganzjährigen Rinder- und Pferdeweiden in der Oranienbaumer Heide sowie Brüne & Stumpf (2004) für mit Schafen, Ziegen und Rindern beweidete Heiden feststellten.
Aufgrund der positiven Ergebnisse wird auf der Projektfläche aktuell nicht die Notwendigkeit gesehen, mit mehreren Tierarten zu arbeiten (multi-species concept; u.a. Loucougaray et al. 2004).
5 Probleme und Lösungsansätze zur Akzeptanzförderung von großflächigen Beweidungsprojekten
„Jahrzehntelang das Militär, dann verbietet der Naturschutz die Flächennutzung als Naherholungsgebiet“ – so positionierten sich Teile der lokalen Öffentlichkeit zu Beginn gegen das Beweidungsprojekt. Die Naturschutzverbände hingegen hatten große Bedenken in Hinblick auf den Erhalt der Orchideenbestände unter dem ganzjährigen Beweidungsregime. Letztlich wurden in den intensiven Diskussionen zu Beginn des Projekts konstruktive Lösungen entwickelt: Weidedurchgänge an allen angeschnittenen Wanderwegen ermöglichen die Begehung, eine naturschutzfachliche Erfolgskontrolle untersucht die Effekte der Beweidung auf Flora und Fauna. Weiteres Resultat ist eine breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit, in deren Rahmen vor Ort Besucher betreut, Fachexkursionen und Führungen mit Schulklassen angeboten und Informationsmaterialien erstellt werden sowie eine Informationsplattform über Gebiet, Historie, Weidetiere, Flora, Fauna und FFH-Richtlinie informiert (Abb. 7).
Dank
Die wissenschaftliche Begleitung wird durch ELER Sachsen-Anhalt finanziert. Für ihr großes Engagement möchten wir uns zudem bei den Mitarbeiter(inne)n der Oberen und Unteren Naturschutzbehörde (insbesondere bei Maxi Boronczyk, Torsten Pietsch, Rainer Helms, Michael Krawetzke und Rolf Hausch), beim Arbeitskreis Heimische Orchideen Sachsen-Anhalt e.V. (insbesondere Frank Meysel), bei den Bewirtschaftern (Agrargesellschaft Großwilsdorf mbH, Agrar GmbH Crawinkel), dem Bundesforstbetrieb Mittelelbe, der Naturstiftung David, dem Naturpark Saale-Unstrut-Triasland und allen weiteren Beteiligten bedanken.
Literatur
Beinlich, B., Grawe, F., Köble, W., Mindermann, S. (2009): Was machen, wenn die Hüteschäfer fehlen? Alternative Wege zum Management von Kalk-Halbtrockenrasen – aufgezeigt an Fallbeispielen aus dem Kreis Höxter. Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 21, 21-42.
Bolz, R. (2005): Auswirkung der Pferdebeweidung auf naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume – faunistische Aspekte. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 125-130.
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2011): Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup.
Buttenschøn, R.M., Buttenschøn, J. (2001): Woodland development on open pastureland under cattle and horse grazing management. In: Gerken, B., Görner, M., Hrsg., Neue Modelle zu Maßnahmen der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern, Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung, Höxter, Natur- und Kulturlandschaft 4, 165-175.
Brüne, C., Stumpf, T. (2004): Beweidung von Heide- und Sandmagerrasenflächen durch Schafe und Ziegen. Arch. Tierz., Dummerstorf 47, 18-24 (Special Issue).
Cornelissen, P., Vulink, J.T. (2001): Effects of cattle and horses on vegetation structure. Are cattle and horses browers enough to stop development of shrubs and trees? In: Gerken, B., Görner, M., Hrsg., Neue Modelle zu Maßnahmen der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern. Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung, Höxter, Natur- und Kulturlandschaft 4, 189-197.
Duncan, P., Foose, T.J., Gordon, I.J., Gakahu, C.G., Lloyd, M. (1990): Comparative nutrient extraction from forages by grazing bovids and equids. A test of the nutritional model of equid/bovid competition and coexistence. Oecologia 8, 411-418.
Edwards, P.J., Hollis, S. (1982): The distribution of excreta on New Forest grassland used by cattle, ponies and deer. J. Appl. Ecol. 19, 953-964.
Elias, D., Mann, S., Tischew, S. (eingereicht): Ziegenstandweiden auf degradierten Trockenrasenstandorten im Unteren Saaletal – Auswirkungen auf Flora und Vegetation. Natur und Landschaft.
Felinks, B., Tischew, S., Lorenz, A., Osterloh, S., Krummhaar, B., Wenk, A., Poppe, P., Noack, J. (2012): Management von FFH-Offenlandlebensräumen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (1), 14-23.
Finck, P., Härdtle, W., Redecker, B., Riecken, U. (Hrsg. 2004): Weidelandschaften und Wildnisgebiete – vom Experiment zur Praxis. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78, 1-539.
Fischer, M. & Wipf, S. (2002): Effect of low-dintensity grazing on the species-rich vegetation of traditionally mown subalpine meadows. Biol. Conserv. 104, 1-11.
Freuck, M. (im Druck): Avifaunistische Untersuchungen eines Beweidungsprojektes im FFH-Gebiet „Tote Täler südwestlich Freyburg“. Apus 18 (2).
Hachtel, M., Schlüpmann, M., Thiesmeier, B., Weddeling, K. (2009): Methoden der Feldherpetologie. Supplement der Zeitschrift für Feldherpetologie 15, Laurenti, Bielefeld.
Klein, S. (2008): Konzept für das Monitoring von Orchideen in Sachsen-Anhalt. Berichte Arbeitskreis Heimische Orchideen 25 (1), 180-194.
Kleyer, M., Schröder, B., Biedermann, R., Rudner, M., Fritzsch, K., Kühner, A. (2004): Freie Beweidung mit geringer Besatzstärke und Fräsen als alternative Verfahren zur Pflege von Magerrasen. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78, 1-539.
LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (2010): Kartieranleitung zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, Teil Offenland. Stand 11.05.2010, 147S.
Lorenz, A., Tischew, S., Osterloh, S., Felinks, B. (im Druck): Konzept für maßnahmebegleitende, naturschutzfachliche Erfolgskontrollen in großen Projektgebieten. Naturschutz und Landschaftsplanung 45.
Loucougaray, G., Bonis, A., Bouzillé, J.-B. (2004): Effects of grazing by horses and/or cattle on the diversity of coastal grasslands in western France. Biol. Conserv. 116, 59-71.
Mann, S., Tischew, S. (2010a): Die Entwicklung von ehemaligen Ackerflächen unter extensiver Beweidung (Wulfener Bruch). Hercynia N.F. 43, 119-147.
–, Tischew, S. (2010b): Role of megaherbivores in restoration of species-rich grasslands on former arable land in floodplains. Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz 10, 7-15.
Öko & Plan (2012): Faunistische Untersuchungen, Teil Brutvögel, im Rahmen des Projektes: Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle von Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebenstypen im NATURA 2000-Gebiet Oranienbaumer Heide. ELER-Projekt an der Hochschule Anhalt, Bearbeitung: Axel Schonert, unveröff. Gutachten, Stand: 15.09.2012.
Poschlod, P., Bakker, J.P., Kahmen, S. (2005): Changing land use and its impact on biodiversity. Basic Appl. Ecol. 6, 93-98.
Riecken, U., Finck, P., Härdtle, W. (2004): Weidelandschaften und Wildnisgebiete: vom Experiment zur Praxis – eine Einführung. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78, 9-19.
Rosenthal, G., Schrautzer, J., Eichberg, C. (2012): Low-intesity grazing with domestic herbivores: A tool for maintaining and restoring plant diversity in temperate Europe. Tuexenia 32, 167-205.
Rühs, M., Hampicke, U., Schlauderer, R. (2005): Die Ökonomie tiergebundener Verfahren der Offenhaltung. Naturschutz und Landschaftsplanung 37, 325-335.
Schaich, H., Barthelmes, B. (2012): Management von Feuchtgrünland wiedervernässter Auen: Effekte von Beweidung und Mahd auf die Vegetationsentwicklung. Tuexenia 32, 207-231.
Schlumprecht, H., Waeber, G. (2003): Heuschrecken in Bayern. Ulmer, Stuttgart.
Seifert, C., Sperle, T., Raddatz, J., Mast, R. (2006): Dokumentation und Handreichung zur Biotoppflege mit Pferden. In: Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Hrsg., Naturschutzpraxis und Landschaftspflege 2, 1-63, Karlsruhe.
Strohwasser, R. (2005): Erfahrungen mit Pferdebeweidung in vier verschiedenen Projekten des Bayerischen Alpenvorlands. Laufener Seminarbeitr. 1/05, 125-130.
Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
Süss, K., Schwabe, A. (2007): Sheep versus donkey grazing or mixed treatment: results from a 4-year field experiment in Armerio-Festucetum trachyphyllae sand vegetation. Phytocoenologia 37, 135-160.
Anschrift der Verfasser(innen): Dipl.-Ing. (FH) Martina Köhler, B.Sc. Georg Hiller und Prof. Dr. Sabine Tischew, Hochschule Anhalt, Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung, Strenzfelder Allee 28, D-06406 Bernburg, E-Mail m.koehler@loel.hs-anhalt.de, g.hiller@loel.hs-anhalt.de und s.tischew@loel.hs-anhalt.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

![Abb. 1: Übersichtskarte der Weidefläche im NSG „Tote Täler“ und kerndichteanalytische Darstellung der Weidetieraktivität „Fressen“ im Zeitraum 2010 bis 2012. Die Klassengrenzen wurden nach geometrischen Intervallen definiert [Ortung/Hektar].](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20130826-127_gm4tsnbxgu4a-150x243.jpg)
![Abb. 2: Nach meteorologischen Jahreszeiten differenzierte kerndichteanalytische Darstellung der Weidetieraktivität „Fressen“ im Jahresverlauf 2011. Die Klassengrenzen wurden nach geometrischen Intervallen definiert [Ortung/Hektar]. Details zur Weidefläche siehe Abb. 1.](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20130826-128_gm4tsnbxgu4q-150x64.jpg)






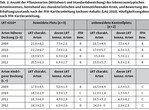

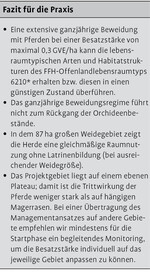
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.