Verfahrens- und Erfolgskontrolle von CEF-Maßnahmen in der saP
Abstracts
Ziel der hier dargestellten Untersuchung ist die Evaluierung und Methodenkritik von speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen (saP). Dabei wurden anerkannte Länderleitfäden ausgewertet und ein Controlling-Fragebogen erstellt.
Zudem wurden die Schutzmaßnahmen in Bezug auf Ihre Funktionserfüllung überprüft. Der Hauptfokus lag dabei auf den CEF- sowie den FCS-Maßnahmen. Abgeglichen wurde mit Soll- und Ist- sowie mit Mit- und Ohne-Vergleichen. So können aus der Abwägung zwischen dem Ausgangszustand dem Bestand und dem gewünschten Zielzustand eine Positiv-/Negativeinschätzung bezüglich der Funktionserfüllung abgegeben werden.
Um sinnvoll vergleichen zu können, wurde der Fokus auf drei Artengruppen gelegt: pionierbesiedelnde Amphibien, strukturgebundene Fledermäuse sowie die ökologische Gilde von Vögeln der halboffenen Kulturlandschaft.
Interessant sind diese Fragestellungen vor allem aus dem Grunde, dass der Eingriffsverursacher einen durchgängigen Erhalt streng geschützter Arten wahren muss. Dass dieses in der Praxis schwierig bis unmöglich ist, zeigt diese Arbeit. Eine Garantie auf vom Menschen schwer zu verstehende und komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen in einem ökologischen System lässt sich nur schwer geben. Das sollte aber nicht als Mangel von Wissen, sondern als systemimmanenter Faktor angesehen werden.
Measures to Guarantee Continuous Ecological Functionality in ‘Special assessments of Species Protection” in Germany – Control of procedure and success
The study aims to evaluate the process of the “special assessment of species protection”, which is the German system of EPS mitigation licensing. Several federal guidelines were analysed in order to compile a questionnaire for the controlling. Additionally, the study intended to survey the success of the measures on “Continuous Ecological Functionality” and the measures on “Favourable Conservation Status”. It compares past, present and target performances to find out if the aim could be reached. Only similar measures were selected, protecting three different chosen groups of animals. First group were amphibians of pioneer areas, second were certain bat species requiring special structures, and the third group was the ecological guild of birds occuring in semi-open cultural landscapes.
These questions are of particular interest since during the intervention the natural basis of the protected species has to be maintained by ensuring a functioning balance of nature, through the whole process. The results show that it is nearly impossible for planners to guarantee the complex coherences and interactions of ecological systems. But this is not due to a lack of knowledge but appears to be inherent to the system.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Mit der Neufassung des Gesetzes über Naturschutz und Landespflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) am 29.07.2009 wurde auf das Scheitern des Umweltgesetzbuches (UGB) reagiert. Sie löst die Erstfassung des BNatSchG von 1976 ab. Dabei verändern sich u.a. die Zuordnungen der Paragrafen für den besonderen Artenschutz von vormals §42 auf §§44 bis 47.
Inhaltlich hat sich mit der Neufassung gegenüber der letzten im Dezember 2007 verabschiedeten kleinen Novelle wenig verändert. Die Prüfung der Tötungs- und Störungsverbote sowie das Eingriffsverbot der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders und streng geschützten Arten bleiben bestehen und gehören seitdem zur üblichen Praxis in fast jedem neuen Bauvorhaben.
Demnach ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten zu fangen, zu verletzen oder zu töten, egal in welcher Entwicklungsform sie sich befinden. Das Gleiche gilt auch für ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (vgl. BNatSchG §44 Abs.1). Besteht also der Verdacht, dass besonders geschützte Arten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) oder der Vogelschutz-Richtlinie(VS-RL) durch einen geplanten Eingriff gestört oder beeinträchtigt werden könnten, so ist in jedem Einzelfall durch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) der Verbotsbestand nach oben genannten Paragrafen zu prüfen.
Ein Vorkommen einer solchen geschützten Art im Wirkraum des Vorhabens erfüllt aber nicht sofort den Verbotsbestand. Liegt durch den geplanten Eingriff keine Tötung sowie erhebliche Störung vor oder bleibt die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen, kann der Eingriff realisiert werden. Hilfreich können hier auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen (Continuos Ecological Functionality) sein (vgl. BNatSchG §44 Abs. 1). Diese Maßnahmen finden vor dem eigentlichen Eingriff statt und sollen einen Ersatz für die geplante Zerstörung des Lebensraumes (Fortpflanzungs- oder Ruhestätte) bieten. Wichtig ist hierbei, dass zu jedem Zeitpunkt eine gleich bleibende ökologische Funktion, also keine qualitative oder quantitative Verschlechterung/Beeinträchtigung der zu schützenden Art, gewährleistet ist (LANA 2006).
Gerade diese rechtlich harte Verbindlichkeit des unmittelbaren handlungsbezogenen Verbotes wirft bei der ausführenden Planung oft Probleme auf. Die meist komplexen und dynamischen Ökosysteme, bestehend aus einer Vielzahl von verschiedenen nicht abschätzbaren natürlichen Zusammenhängen und Faktoren, machen es schwer, gesicherte Einschätzungen abzugeben. Prognosen werden vor allem dann komplex, wenn Rahmenbedingungen und die Zahl/Regeln der anzuwendenden Gesetze nicht vollkommen bekannt sind oder viele relevante Neben- und Fernwirkungen dieses offene System beeinflussen. Auch besteht immer die Gefahr von plötzlichen Systemsprüngen oder Einbrüchen (Bifurkationen), die im Grunde nicht vorhersehbar sind (Jessel 2002).
Methodisch schätzt und interpretiert man die Populationen und deren Effekträume (Wirkungsanalyse), um sie dann in einen Zusammenhang mit den schädlichen Eingriffsfaktoren zu bringen (Wirkungsprognose). Daraus lassen sich dann die passenden (Gegen-)Maßnahmen ableiten (Bewertung und Entscheidung). Auch wenn die mittlerweile schon umfangreiche Rechtsprechung und Literatur gewisse Anforderungen geklärt hat (siehe z.B. EuGH, Urteil vom 15.03.2012 – C-340/10; BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9A14/07; BVerwG, Urteil vom 14.07. 2011 – 9A12/10; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 11.08.2009 – 11 S 58/08), liegt der Verdacht nahe, dass die Realität den rechtlich theoretischen Ansprüchen nicht gerecht wird. Die Frage ist also, ob sich der lückenlose Erhalt der ökologischen Funktion ohne den Verlust an Qualität oder Quantität überhaupt garantieren lässt?
Die nachfolgende Arbeit greift diesen Sachverhalt auf und versucht, mit folgender Fragestellung die Umsetzung und das Verfahren von einzelnen Bauvorhaben zu bewerten:
(1) eine Qualitätsprüfung des Planungsverfahrens von saPs auf Grundlage aktueller Literatur und Leitfäden (Verfahrenskontrolle),
(2) das Gegenüberstellen aller Verfahrenskontrollen, um übliche Stärken sowie Schwächen darzulegen,
(3) eine Auswertung der Umsetzung von Maßnahmen in saPs nach Umfang, Qualität und weiterführenden Pflege in Bezug auf heutige anerkannte Standards und verbindlicher Regelwerke (Erfolgskontrolle),
(4) das Auswerten aller Funktionskontrollen, um allgemeine Stärken und Schwächen abzuleiten,
(5) die Erarbeitung von Ansätzen für Planungshinweise bei zukünftigen Planungen.
Aufgrund des zeitlich engen Rahmens konnten acht Vorhaben genauer untersucht und ausgewertet werden. Bei der Auswahl der Projekte und der Maßnahmen wurde auf eine möglichst homogene Auswahl mit gleichen Artengruppen (Pionieramphibien, Auswahl an strukturgebundenen Fledermäusen und die ökologische Gilde der Vögel halboffener Kulturlandschaften) geachtet. So haben z.B. Maßnahmen zum Schutz von Pionieramphibien und deren Habitate ähnliche strukturelle, quantitative und qualitative Ansprüche, was eine bestmögliche Vergleichbarkeit untereinander garantiert.
Eine statistische Validität ist mit einer so geringen Zahl an untersuchten Projekten allerdings nicht gegeben. Diese Arbeit kann somit nur gewisse Trends aufweisen und einen groben Überblick über die Planungsrealität schaffen.
2 Verfahrenskontrolle
2.1 Methode
Die Kontrolle des Verfahrens beschreibt die Qualität der Arbeit in Bezug auf die allgemein üblichen Standards und verbindlichen Regeln. Gerade das BVerwG hat durch seine Rechtsprechung der vergangenen Jahre gezeigt, dass viele Planfeststellungsbeschlüsse in Bezug auf den Artenschutz „formell mangelhaft“ ausgearbeitet wurden (Lieber 2012).
Sind alle wichtigen Aspekte und Abläufe der saP enthalten und ausreichend tief beschrieben? Wurde die Rechtsprechung beachtet? Sind die Bestandsaufnahmen älter als fünf Jahre und besteht somit keine Rechtssicherheit mehr? Das sind Fragen, die hier beantwortet werden sollen. Grundlage zur Bewertung bildet eine Auswahl der aktuellen Leitfäden zur Erstellung einer saP sowie die aktuelle Literatur und Forschungsvorhaben (vgl. HMUELV 2011, Runge 2009, STMI 2011). Da in dieser Arbeit ein besonderer Fokus auf der Bewertung der Maßnahmen liegt, werden diese gesondert betrachtet und sind nicht in ihrem Prüfschritt (Prüfung der Störung) eingebettet.
Die Verfahrensprüfung erfolgt nach der in Tab. 1 dargestellten Fragenmatrix. Die Bewertung des Verfahrens geschieht in Anlehnung an das klassische Schulbewertungssystem in Deutschland. Jede Kategorie wird gesondert untersucht und dann nach Punkten bewertet, wenn die geforderte Fragestellung in ausreichender Qualität behandelt wurde. Die maximale zu erreichende Punktzahl ergibt sich aus den Kernpunkten und den ggf. vertiefenden Fragestellungen (siehe Tab. 1).
Um einen gewissen Mindeststandard einzuhalten, werden einige Kernpunkte als Ausschlusskriterien deklariert (z.B. gesamte Relevanzprüfung, Dimensionierung und zeitliche Aspekte der einzelnen Maßnahmen etc.). Sollten diese fehlen oder die Anforderungen nur mit mäßiger Qualität erfüllt sein, kann von einem Gesamterfolg nicht mehr ausgegangen werden, von Rechtssicherheit ganz zu schweigen.
2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
Folgende Aussagen können als Ergebnis der Verfahrenskontrolle getroffen werden:
(1) Von den acht untersuchten Projekten kann die Qualität von fünf Verfahren mit hoch, ein Verfahren mit mittel und zwei Verfahren mit gering bewertet werden. Die drei Verfahren, welche mit gering oder mit mittel bewertet wurden, haben ebenfalls den Mindeststandard in mindestens einem der Ausschlusskriterien nicht erreicht. Ein Planfeststellungsbeschluss hätte somit nicht ergehen dürfen.
(2) Einige der größten Schwächen zeigten sich im Prüfschritt „Prüfung der Störung/Zerstörung nach §44 BNatSchG“. Die betroffenen Arten wurden dabei in vielen Fällen ungenügend tief beschrieben. Es fehlten meist artspezifische Ansprüche, Phänotyp, Vorkommen, Biologie, Ökologie, Bedrohungen und Sensitivität, Erhaltungszustand (EU-Kommission 2007b) oder Angaben zur Mobilität. Dieses sind vermeidbare Fehler, da solche Angaben schnell in der Literatur oder im Internet zu finden sind. Weiter aufbauend wurden in den wenigsten Fällen Populationsgrößen bestimmt oder sinnvoll abgeschätzt. Daraufhin fehlten natürlich eine fundierte Bewertung des Bestandes der einzelnen Arten und eine sinnvolle Argumentationskette bis hin zur richtigen Bemessung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Das kann gerade bei strukturverbessernden Maßnahmen von Habitaten mit schon vorhandenem Besatz problematisch werden. Die Umsiedlung bzw. geleitete Einwanderung erhöht somit die Gesamtzahl der im Habitat vorhanden Individuen. Sind die Besatzstärken aber nicht genau geklärt, kann leicht der Schwellenwert einer Überbevölkerung (intraspezifische Konkurrenz) überschritten werden. Negativfolgen können mangelnde Nahrungsverfügbarkeit und erhöhtes Abwandererungsverhalten sein.
(3) Gerade bei Untersuchungen von betroffenen Vögeln wurden Effektdistanzen oder Fluchtdistanzen (BMVBS 2010) nur oberflächlich genutzt und behandelt. Verfügbare Leitfäden wie z.B. „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ wurden kaum genutzt.
(4) Auch in der nächsten Untersuchungskategorie „Mindestanforderungen an die Schutzmaßnahmen“ fanden sich Fehler. Teilweise wurde die quantitative Dimensionierung nicht richtig bemessen und die Kompensationsfläche war deutlich kleiner als die zerstörte. Dieser Umfang liegt unter dem geforderten Minimum des Ausgleichverhältnisses von 1:1 (EU-Kommission 2007a) nach EU-Leitfäden und den Ausführungen der LANA. Allgemein wurde die Bilanzierung der Kompensation in allen Planungen recht intransparent gehalten.
(5) Die Problematik des „Time lags“ wurde in jeder Planung beachtet und spiegelte sich auch im richtigen Zeitmanagement der einzelnen Maßnahmen wider.
(6) Eventualstrategien und/oder Monitoringkonzepte sind meist nur rudimentär beschrieben und folgen so gut wie nie wissenschaftlich anerkannten Standards (DIN EN ISO 14001 2004). Auch wenn diese Punkte bei Maßnahmen mit sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeiten eher unberücksichtigt bleiben können, ist das ein eher beunruhigendes Ergebnis.
3 Funktionskontrolle
3.1 Methode
Funktionskontrollen sind mehr als nur eine Aufnahme der aktuellen Situation mit anschließender Abschätzung und Bewertung. Vielmehr überprüfen sie die Wirkung der Maßnahmen auf die Schutzgüter, z.B. anhand der Bestandsentwicklung von Arten, der Ausprägung von Biotopen und Landschaftsausschnitten. Bei Erfolgskontrollen muss eine In-Beziehung-Setzung zu den Wirkfaktoren stattfinden, um kausale Zusammenhänge zu erkennen (Scherfose 2005). Aus diesem Grund werden Funktionskontrollen oft synonym für den Begriff „Wirkungskontrolle“ gebraucht. Es wird also kontrolliert, ob das CEF-Vorhaben den in der Planung definierten Zielzustand aufweist, oder auch welche Entwicklungsrichtung (positiv oder negativ zum geplanten Sollzustand) im Moment vorherrscht. Stellen sich in dem neu angelegten Feuchtgrünland auch die entsprechenden zu schützenden Arten ein? Oder bilden sich auf gewünschten Sukzessionsflächen unerwünschte Dominanzbestände? Je nach den Möglichkeiten und den vorherrschenden Verhältnissen definiert die Fachliteratur verschiedene Vorgehensweisen der Funktionskontrolle (Jessel 2006, Kriegbaum 1999). In dieser Untersuchung wurde zuerst die Bestandsaufnahme, danach der Vergleich mit Auswertung gemacht.
Bevorzugt wurden vor allem hier Soll- und Ist- sowie (wenn möglich) Mit- und Ohne-Vergleiche (siehe Abb. 1 und 2). Das bedeutet die Erfassung des Ist-Zustandes und die Beurteilung der Ergebnisse anhand eines angestrebten Ziel-Zustandes. Wobei bei CEF-Maßnahmen das Ziel vordefiniert ist. Die zerstörte Ruhe- oder Fortpflanzungsstätte muss mindestens mit der gleichen Qualität oder Quantität wiederhergestellt werden, bevor der eigentliche (Bau-)Eingriff startet, um einen „Time lag“ zu vermeiden. Der Ablauf der Untersuchung gliedert sich folgendermaßen: Sichtung der Bestandes (Vorher) und des angestrebten Zielzustandes (Soll-Zustand), beides wird nachrichtlich übernommen aus den Fachplanungen. Eine eigene Bestandsaufnahme vor Ort (Ist-Zustand) mit abschließendem Vergleich der drei Zustände mit Bewertung ist der nächste Prüfschritt.
3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
Folgende Ergebnisse konnten zur Funktionskontrolle festgestellt werden:
(1) Insgesamt gab es in den acht untersuchten Prüfungen 36 Schutzmaßnahmen (33 CEF-Maßnahmen und drei FCS-Maßnahmen, measures to ensure a „favorable conservation status“) für die ausgewählten Tiergruppen. Davon waren zwölf bei der Funktionskontrolle nicht messbar oder noch nicht ausgeführt. Von den 24 verbleibenden Maßnahmen wurden sieben nicht zeitgerecht ausgeführt oder zeigten eine schlechte Qualität. Die Sicherung der durchgängigen ökologischen Funktion des Naturhaushaltes war somit nicht gegeben.
(2) In Bezug auf den Schutz von Amphibien zeigt sich ein positives Bild. Alle sechs behandelten Maßnahmen wurden qualitativ sowie quantitativ richtig umgesetzt. Die Auswahl des Ersatzgebietes, die Dimensionierung der Fläche sowie der zeitliche Faktor haben die Anforderungen erfüllt. Allerdings hatten einige neu hergestellte Tümpel eine zu tiefe Gewässersohle. Gerade für Pionieramphibien ist es wichtig, dass die Gewässer im Sommer austrocknen. So können sich Prädatoren (z.B. Fische) nicht halten. Gerade hier sollten die strukturellen Anforderungen (vegetationsfreie Flachufer, geringe Wassertiefe etc.) besonders beachtet werden.
(3) Die in der Arbeit untersuchten Schutzmaßnahmen mit künstlichen Brutplätzen (Nistkästen) für Vögel zeigen ein zufriedenstellendes Ergebnis. Allerdings ist auch hier wieder besonders auf die strukturellen Anforderungen zu achten. Es reicht nicht, einfach irgendeinen Brutkasten an den nächstgelegenen Baum zu hängen. Einige Vögel bevorzugen bestimmte Bäume, das Einflugloch sollte nicht in der Hauptwindrichtung liegen, keine großen Äste sollten den Einflug blockieren usw. Hier zeigen sich in der Ausführung Schwächen. Gerade auch hinsichtlich der Thematik des Fehlbesatzes sollten hier Eventualstrategien ausgearbeitet werden.
(4) Die drei messbaren Maßnahmen speziell zum Schutz von Fledermäusen (Fledermauskästen) zeigen ebenfalls ein gutes Ergebnis. Zu beachten ist, dass gerade auch Baum- und Heckenpflanzungen Fledermäusen zugutekommen. Diese können sie als Leitstruktur und Nahrungshabitat nutzen. Eine Rodung kann somit negative Folgen für Fledermauspopulationen haben.
(5) Insgesamt wurden in der Untersuchung 36 Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. Die Nachprüfbarkeit ist hier grundsätzlich schwer, da diese meist während der eigentlichen Baumaßnahme eingehalten werden müssen. Somit lassen sich diese Maßnahmen für zukünftige Projekte noch nicht messen. Trotzdem wurden sie betrachtet, da sie ein wichtiger Baustein zum Schutz der Art sind und dadurch die Gesamtheit des Schutzkonzeptes verständlich bleibt.
4 Zusammenfassung allgemeiner Ergebnisse
Folgende allgemeine Aussagen und Erkenntnisse haben sich während der gesamten Untersuchung herausgestellt und können angenommen werden:
(1) Durchgängig wurden alle begutachteten Projekte von Fachbüros bearbeitet. Insgesamt wurden in dieser Untersuchung ca. 25 bis 30 Projekte gesichtet, daraus wurden die hier acht behandelten Projekte ausgewählt. In den meisten Verfahren ist die saP ein Fachbeitrag zum speziellen Artenschutz und wirkt nur zusammen mit den anderen naturschutzfachlichen Beiträgen (z.B. UVS, LBP usw.). Dabei konnte festgestellt werden, dass alle Beiträge von anerkannten Büros der Landschaftsarchitektur oder der Biologie übernommen wurden. Fachbeiträge, die von ähnlichen oder gar von berufsfremden Professionen verfasst wurden, gab es nicht. Dabei spielen wahrscheinlich die rechtlich harte Verbindlichkeit (gegenüber dem sonst eher beratenden Charakter unserer Profession) und die Gefahr einer Klage eine große Rolle, das planerische Niveau solcher Gutachten hochzuhalten.
(2) Die meisten Arbeiten wurden oberflächlich gut ausgearbeitet, jedoch fehlt in vielen Fällen die nötige Detailtiefe. Dank genutzter Leitfäden und einem gewissen vorherrschenden Grundwissen der Experten sind so gut wie alle saPs in Methode und Ausarbeitung in ausreichender Tiefe erfolgt. Allerdings fehlen gerade in Detailfragen die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen. Besonders bei schwierigen Fragen wie z.B. der Größenermittlung und der Bewertung von Populationen zeigen sich Wissenslücken bzw. die mangelnde Detailtiefe. In den meisten Fällen werden diese Fragen als nicht messbar (da z.B. Tiere zu mobil sind) beantwortet und übergangen. Welche Negativfolgen das haben kann, wurde oben schon ausgeführt.
(3) Tendenziell lässt sich ein Zusammenhang zwischen einem schlechten Verfahren und einer schlechten Ausführung erkennen. Die Verfahren mit einer „geringen“ oder „mittleren“ Bewertung weisen teilweise schlecht oder nicht ausgeführte Maßnahmen auf.
(4) Zudem stellt sich heraus, wie wichtig eine ökologische Baubegleitung für die Bauphase ist. Oft sind die Bauarbeiter kaum informiert über die Belange des Naturschutzes und deren „Spielregeln“. Hier kann eine entsprechende ökologische Begleitung helfen, Fehler zu vermeiden, gerade auch im Hinblick auf Negativentwicklungen (z.B. Vermeidungsmaßnahme erzielt nicht die gewünschte Wirkung). Diese stößt allerdings auch an ihre Grenze, insbesondere dann, wenn zuvor übersehene oder neu einwandernde Arten in der Bauphase erscheinen. Das BVerwG hat klargestellt: Die ökologische Baubegleitung kann das Verbot im kleinen Umfang (z.B. über Vermeidung) bewältigen (BVerwG, Urteil vom 12.08.2009 – 9A 64/07). Bei schwierigeren Situationen, gerade auch wenn eine Ausnahmegenehmigung nach §45 BNatSchG ausgestellt werden muss, stößt das Instrument allerdings an seine Grenzen (Lieber 2012). In der Realität sieht es wohl anders aus. Gerade dann, wenn der Sachverhalt so schwerwiegend wird, dass eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses ansteht, ist es fraglich, wie unabhängig eine Bauaufsicht dann noch ist. Die sprichwörtliche „Hand, die einen füttert, beißt man natürlich nicht“. Hier sind auch wieder die Behörden und die öffentliche Diskussion der Planer gefragt, sinnvolle Lösungen zu finden. Als Beispiel könnte die Aufsicht an Dritte abgegeben werden. Anbieten würden sich hier spezialisierte Büros, um eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren.
5 Fazit
Ziel dieser Untersuchung war die Verfahrenskontrolle von speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen (saP) sowie die Funktionskontrolle der dazugehörenden Schutzmaßnahmen. Um eine Vergleichbarkeit zu erlangen, wurden in den verschiedenen Projekten ähnliche Maßnahmen ausgewählt, die hauptsächlich drei Artengruppen betreffen.
Die Verfahrenskontrolle ergab, dass von den acht untersuchten Projekten fünf Verfahren qualitativ mit hoch, ein Verfahren mit mittel und zwei Verfahren mit gering bewertet werden können. Die meisten Schwächen zeigten sich vor allem in der Prüfung auf Störung und Zerstörung nach §44 BNatSchG sowie in den Anforderungen zur Gestaltung der Schutzmaßnahmen.
Die Funktionskontrolle wurde an insgesamt 36 Schutzmaßnahmen (33 CEF-Maßnahmen und 3 FCS-Maßnahmen) für die ausgewählten Tiergruppen untersucht. Davon waren zwölf bei der Funktionskontrolle nicht messbar oder noch nicht durchgeführt. Von den 24 verbleibenden Maßnahmen wurden sieben nicht zeitgerecht ausgeführt oder waren in einer schlechten Qualität. Das sind 29 % von der Gesamtmenge. Da der Gesetzgeber eine Erfolgsgarantie verlangt, ist dieses Ergebnis eher kritisch zu sehen. Hintergründe, warum so ein Ergebnis zustande kam, wurden hier nicht beleuchtet.
Literatur
BMVBS (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bonn.
Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Springer, Berlin, 3. Aufl.
Deutsches Institut für Normung (2004): Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001. Berlin.
Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. UTB, Ulmer, Stuttgart, 5. Aufl.
–, Weber H., Düll, R., Wirt, V., Werner, W., Paulissen, P. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Erich Goltze, Göttingen, 2. Aufl.
EU-Kommission (2007a): Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. o.O.
– (2007b): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. o.O.
Gebhard, J. (1997): Unsere Fledermäuse. Naturhistorisches Museum Basel, 4. Aufl.
HMUELV (2011): Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden.
Höll, N., Gerstner, H., Schelkle, E. (2009): Arten, Biotope, Landschaft, Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. LfU Baden Württemberg, Karlsruhe, 14. Aufl.
Jessel, B. (2006): Durchführungs- und Funktionskontrollen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – Stellung von Nachkontrollen innerhalb der Eingriffsregelung. BfN Skripten 182, 23-38.
–, Tobias, K. (2002): Ökologisch orientierte Planung. UTB, Ulmer, Stuttgart.
Jonsson, L. (1992): Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Kosmos, Stuttgart, 2. Aufl.
Kratsch, D. (2006): Rechtliche Grundlagen der Nachkontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung. BfN Skripten 182, 3-22.
Kriegbaum, H. (1999): Erfolgskontrollen des Naturschutzes in Bayern – eine Übersicht bisheriger Ergebnisse. LfU Bay. 150, 11-58.
Köppel, J., Peters, W., Wende, W. (2004): Eingriffsregelung Umweltverträglichkeitsprüfung FFH-Verträglichkeitsprüfung. Ulmer, Stuttgart.
LANA (1996a): Gutachten zur Methodik der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft, zur Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie von Ausgleichszahlungen. Band II. Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover, Stuttgart.
– (1996b): Gutachten zur Methodik der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft, zur Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie von Ausgleichszahlungen. Band III. Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover, Stuttgart.
– (2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. o.O.
LfU Nordrhein-Westfalen (2010): Kartieranleitung Biodiversitätsmonitoring NRW. o.O.
Lieber, T. (2012): Das Artenschutzrecht im Vollzug von Planfeststellungsbeschlüssen. Natur und Recht 34, 655-671.
Lüttmann, J. (2006): Analyse der Entwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an ausgewählten VDE-Projekten. BfN Skripten 182, 69-92.
Nentwig, W., Bacher, S., Brandl, R. (2009): Ökologie kompakt. Spektrum, Heidelberg, 2. Aufl.
Nöllert, A., Nöllert, C. (1992): Die Amphibien Europas. Kosmos, Stuttgart.
Quinger, B., Lang, A., Urban, R., Zintl, R. (2010): Vorgaben zur Bewertung der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (LRT 1340* bis 8340) in Bayern. LfU Bayern, Abt. 5, Augsburg.
Rudolf + Bacher, Jessel, B., U-Plan (2001): Erfolgskontrolle in der Eingriffsregelung. Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, Potsdam.
– (2002): Erfolgskontrolle in der Eingriffsregelung 2002 – Handlungsanleitung Biotopschutz nach § 32 BNatSchG und Eingriffsregelung. Schnittstellen, Anknüpfungspunkte, Spezifika. Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, Potsdam.
Runge, H., Simon, M., Widding, T., Louis W. (2009): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Hannover/Marburg.
Scherfose, V. (2005): Anforderungen an abiotische und biotische Erfolgskontrollen im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes. BfN Skripten 22, 183-193.
STMI Bayern (2011): Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP). Oberste Baubehörde, Bayerisches Staatsministerium des Inneren, München.
Anschrift des Verfassers: Ulrich Müller (M. Eng. Landschaftsplanung/Landschaftsarchitektur), Schäfflerstraße 8, D-85368 Moosburg, E-Mail info@muellerulrich.com.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



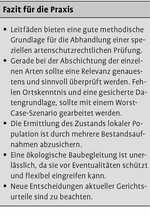
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.