Bürgerbeteiligung und internationale Verhandlungen
Abstracts
Die World Wide Views (WWViews) on Biodiversity sind ein globaler Diskussions- und Beratungsprozess, bei dem in Form von Bürgerkonferenzen strittige Fragen über Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt behandelt wurden. Ausgehend vom dänischen Technologierat (DBT) und dem Sekretariat des Abkommens zur Biologischen Vielfalt (CBD) haben am 15. September 2012 in 25 Ländern je etwa 100 Personen im Rahmen einer international streng standardisierten Veranstaltung über Fragen zur Biodiversität diskutiert. Die Auswahl der Teilnehmer sollte jeweils einen soziodemographischen Querschnitt der nationalen Bevölkerung abbilden. In vier Themenfeldern zur biologische Vielfalt sowie einer abschließenden Bewertungsrunde wurden sowohl international standardisierte Fragen diskutiert und abgestimmt als auch freie Vorschläge entwickelt. Der in diesem globalen Verfahren eingeforderte Anspruch der Zivilgesellschaft, rechtzeitig auch in komplexe internationale Verhandlungen zur Biodiversität einbezogen zu werden, wurde im Abschlussdokument der 11. Vertragsstaatenkonferenz der CBD aufgenommen. In diesem Beitrag werden Ergebnisse der deutschen WWViews dargestellt sowie das Format kritisch diskutiert.
Public Participation and International Negotiations – The ‘World Wide Views on Biodiversity’ in Germany
The WorldWideViews (WWViews) on Biodiversity are a global deliberation process. Using citizen conferences controversial questions are discussed on effective measures for the conservation of biodiversity. Initiated by the Danish Board of Technology (DBT) and the Secretary of the Convention on Biological Diversity (CBD) about 100 participants met on September 15th, 2012 in 25 different countries to discuss questions on biodiversity in a strongly standardised form, with the selection of participants reflecting the socio-demographic average of the national population. In four thematic sessions dealing with biodiversity as well as in a concluding session for the evaluation internationally standardised questions were discussed and voted for. In addition, free suggestions were developed. The demand of the civil society to be able to early participate also in complex international negotiations on biodiversity was included in the final documents of the 11th Conference of the Parties of the CBD. The paper presents results of the German WWViews, and it critically discusses the format.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Vor dem Hintergrund globaler Wandlungsprozesse in Umwelt, Gesellschaft und Politik rücken in der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“ (2011 bis 2020) biodiversitätsassoziierte Problemstellungen auch auf internationaler Ebene stärker als bisher in den Fokus.
Hierbei den Herausforderungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an der Gestaltung einer nachhaltigeren Politik aktiv gerecht zu werden, erfordert neuartige Herangehensweisen sowohl bei der Sensibilisierung für komplexe ökologische und sozio-ökonomische Zusammenhänge als auch bei der Beteiligung an der Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Erhaltung der Biodiversität. Der vorliegende Beitrag soll einen praktischen Versuch zum Umgang mit dieser Problematik vorstellen und diskutieren.
Das Verfehlen der bis 2010 zu erreichenden Biodiversitätsziele der Vereinten Nationen wird vor allem darauf zurückgeführt, dass die Erhaltung sowie die nachhaltige und gerechte Nutzung der biologischen Vielfalt unzureichend in den Entscheidungen verschiedener Sektoren verankert ist, sowohl international als auch national (Doyle et al. 2010, Mace et al. 2010, Sukopp et al. 2010). Daher wurde auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz (COP 10) des UN-Abkommens zur Biologischen Vielfalt (CBD) in Nagoya als erstes und wichtigstes Ziel für das Jahr 2020 in den sogenannten Aichi-Zielen formuliert, dass „Menschen den Wert von Biodiversität und Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung kennen“ (http:// http://www.cbd.int/sp/targets/ ). Für die Umsetzung dieses sowie der weiteren 19 Aichi-Ziele ist es nötig, dass Menschen diesen Zielen zustimmen und sich mit ihnen identifizieren.
Die Idee der World Wide Views (WWViews) on Biodiversity (http://biodiversity.wwviews.org/) geht daher von kritischen Fragen zu mit Biodiversität verbundenen Problemlagen aus, die auf der internationaler Ebene der UN-Konferenzen von Politikern verhandelt werden. Über diese Fragen sollte bereits im Vorfeld der entsprechenden Konferenz weltweit gleichzeitig an einem festgelegten Tag von stellvertretend ausgewählten Vertretern der Bevölkerung diskutiert und abgestimmt werden. Die Ergebnisse sollten als Bürgermeinung den verhandelnden Politikern, den Delegierten, zurückgespiegelt werden. Dieser Prozess hat zum ersten Mal vor der Klimarahmenkonferenz 2009 als WWViews on Global Warming stattgefunden (Rask et al. 2012). Die Folgeveranstaltung zur biologischen Vielfalt wurde vom Dänischen Technologierat (DBT) gemeinsam mit dem Sekretariat des Abkommens zur Biologischen Vielfalt (CBD) im Vorfeld der 11. Vertragsstaatenkonferenz (COP 11) der CBD initiiert. Insgesamt fanden am Samstag, 15. September 2012, weltweit 34 Bürgerkonferenzen in 25 Ländern statt, darunter auch in Deutschland (World Wide Views on Biodiversity 2012).
In Deutschland hat das Museum für Naturkunde Berlin gemeinsam mit einer großen Zahl weiterer Partner die nationale Bürgerkonferenz organisiert und durchgeführt. Die Veranstaltung war sowohl Teil des Wissenschaftsjahres des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Motto „Zukunftsprojekt Erde – wie wollen wir leben?“ als auch ein Beitrag zur aktuellen UN-Dekade zur Biologischen Vielfalt.
2 Methode
2.1 Vorbemerkungen
Die WWViews sind stark standardisiert. Ein vom Dänischen Technologierat entwickelter Leitfaden machte für alle Partner genaue Vorgaben und bildete die Grundlage für die Organisation der nationalen Veranstaltungen. Diese gingen von der Zusammensetzung der teilnehmenden Bürger (Alter, Geschlecht, Bildung, Wohnort) über die Bereitstellung von Informationsmaterialien bis hin zur Anordnung der Tische, an denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten. Auch die Themenfelder, der Fragenkatalog, die Art und Weise der Stimmenauszählung sowie die Öffentlichkeitsarbeit waren standardisiert.
Vorab wurden eine Broschüre und begleitende Filme erstellt, die den Teilnehmern die Möglichkeit geben sollten, sich umfassend über die Thematik zu informieren. Den Schwerpunkt bildeten dabei Fragen zur Bedeutung des Verlustes biologischer Vielfalt und zu Konfliktfeldern, die auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ebene aktuell diskutiert werden. Broschüre und Videos sind auch nach der WWViews-Konferenz verfügbar und können beispielsweise für Bildungszwecke verwendet werden ( http://www.wwviews-biodiversity.naturkundemuseum-berlin.de/ ).
2.2 Rekrutierung der Teilnehmenden
Um dem Kriterium zu genügen, einen soziodemographischen Querschnitt der Bevölkerung in Deutschland zu erreichen, wurde der Aufruf zur freiwilligen Teilnahme an der Veranstaltung über verschiedene Kanäle gestreut. Dazu wurden zwei komplementäre Methoden angewandt: Als Erstes wurde ein Online-Formular auf der Homepage des Museums für Naturkunde entwickelt, über das sich Interessierte direkt anmelden konnten. Der Link wurde über verschiedene Newsletter sowie über das „Berliner Fenster“, einen Nachrichten- und Werbemonitor in den Waggons der Berliner U-Bahn, verbreitet. Ergänzend wurde das Berliner Einwohnermeldeamt angeschrieben, um 2000 zufällig ausgewählte Adressen zu erhalten. Diese Personen wurden eingeladen, sich zu bewerben. Aufgrund des limitierten finanziellen Rahmens beschränkten sich die Organisatoren dabei vorwiegend auf den Berliner Raum.
Um das Teilnehmerpanel auf eine gewisse Ausgewogenheit hin zu prüfen, wurden alle Bewerberinnen und Bewerber gebeten, Angaben zu folgenden Rubriken zu machen: Kontaktdaten, Geschlecht, Alter, Größe der Stadt (Einwohnerzahl des aktuellen Wohnorts), letzter Schulabschluss, aktuelle Beschäftigung, Mitgliedschaft in einer Umweltschutzorganisation. Es meldeten sich über die beiden genannten Wege 127 Bewerberinnen und Bewerber, die alle eingeladen wurden, um eine ausreichende Anzahl an Teilnehmern am Tag der Konferenz zu gewährleisten.
2.3 Durchführung
Die Teilnehmer der deutschen Bürgerkonferenz zu den WWViews on Biodiversity kamen im Museum für Naturkunde in Berlin für einen ganzen Tag (9.30 bis 17.00 Uhr) zusammen. Der Ablauf sowie die Fragen gliederten sich in vier Themenfelder: (1) Einführung in die biologische Vielfalt, (2) Konflikte zwischen Schutzgebieten und landwirtschaftlicher Nutzung, (3) marine Biodiversität und (4) Gerechtigkeit sowie (5) eine Abschlussrunde. Die Informationsmaterialien und Fragen wurden von der Firma Biofaction (Österreich) in Abstimmung mit den Organisatoren der internationalen WWViews entwickelt und waren für alle Länder identisch (für Details s. Anhang 1 unter http://www.nul-online.de Service Downloads). Vor jedem Themenfeld wurde ein Film gezeigt, der in das Thema einführte. Anschließend wurden die Fragen zum jeweiligen Themenfeld vorgestellt. Die Diskutanten hatten anschließend 90 min Zeit, an jedem der 14 runden Tische in Kleingruppen zu je etwa acht Personen über die Fragen zu diskutieren. Am Ende eines Themenfelds beantwortete jeder Teilnehmer individuell die Fragen über ein Multiple-Choice-Verfahren (Fragen und Antwortmöglichkeiten siehe Anhang 2 unter http://www.nul-online.de Service Downloads).
Ergänzt wurde der Ablauf in Deutschland zum einen durch Experten, die nach den Filmen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung standen, sowie durch Tischkärtchen, die zusätzlich zu den standardisierten Fragebögen mit Freitext beschrieben werden konnten. Beide Ergänzungen gehörten nicht zum international standardisierten Ablauf.
2.4 Auswertung und Kommunikation der Ergebnisse
Die Ergebnisse der Abstimmung zu den einzelnen Fragen wurden unmittelbar nach Abschluss der Diskussion zum jeweiligen Themenfeld ausgezählt und vor Ort in eine digitale Datenbank eingegeben, die von den Organisatoren der internationalen WWViews bereitgestellt worden war. Die Ergebnisse waren bereits am Tag der Veranstaltung direkt nach der Dateneingabe online abrufbar und sind noch immer im Internet verfügbar.
Die interaktive Datenbank erlaubt hierbei, die weltweit zusammengefassten und mit Hilfe von Diagrammen visualisierten Antworten auf alle Fragen einzusehen, diese nach einzelnen beteiligten Ländern zu filtern sowie deren Ergebnisse mit denen verschiedener Ländergruppierungen (mit anderen Ländern, ganzen Kontinenten und dem globalen Voting) zu vergleichen (http://biodiversity.wwviews.org/the-results).
Eine englischsprachige Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse des weltweiten WWViews-Prozesses wurde durch den Dänischen Technologierat erarbeitet (WWViews on Biodiversity 2012).
3 Ergebnisse
3.1 Zusammensetzung der Teilnehmer
Von den letztlich 85 Teilnehmer(inne)n waren 50 weiblich und 35 männlich (Abb. 1), wobei der Schwerpunkt auf Personen mittleren Alters lag. Am stärksten vertreten waren Frauen in der Altersgruppe 36 bis 45 Jahre, wobei gerade in dieser Gruppe relativ wenige Männer vertreten waren.
Der überwiegende Teil (75 Personen) kam aus einer Großstadt, nämlich Berlin, nur zehn Personen kamen aus ländlichen Regionen oder Kleinstädten. Die meisten der Teilnehmenden haben ein Studium abgeschlossen (56 Personen), 14 Personen das Abitur, zehn die Oberschule; einer hat keinen Abschluss erreicht und vier haben keine Angaben gemacht. Beschäftigt waren 15 Teilnehmer als Schüler oder Student, sieben waren arbeitslos, vier Hausfrauen, 13 selbständig, 14 im öffentlichen Sektor, neun in der Industrie, zwei im Handel, zehn im Bildungsbereich, einer in Land- und Forstwirtschaft und sieben haben “Sonstiges“ angegeben. Mitglied in einer Naturschutzorganisation waren 63 Personen, 16 Personen haben angegeben, kein Mitglied zu sein und sechs Personen haben die Frage nicht beantwortet.
Die meisten Personen (63) hatten sich über das Internet angemeldet, nur jeweils neun Personen haben das Anmeldungsformular als Brief oder Fax geschickt und vier meldeten sich per E-Mail an.
3.2 Ergebnisse der Abstimmungen zu den Themenfeldern
Es werden ausgewählte Ergebnisse der deutschen Abstimmung im Vergleich zu den Ergebnissen der globalen Abstimmung dargestellt. International haben sich insgesamt 3014 Personen beteiligt, mit kleineren Schwankungen bei einzelnen Fragen. Von den Teilnehmern wurden die 28 % unter 25 als „Jugend“ bezeichnet; in Deutschland lag dieser Anteil bei knapp 10 %.
Die Fragen des ersten Themenfeldes befassten sich mit allgemeinen Kenntnissen zur Biodiversität. Die deutschen Teilnehmer haben sich selbst als gut oder sehr gut informiert eingeschätzt (Abb. 2). Sie äußerten sich jedoch durchschnittlich weniger besorgt in Bezug auf den Verlust von Biodiversität und sich daraus ergebende negative Folgen als der globale Durchschnitt („sehr besorgt“ 59 % zu 74 % global).
Das zweite Themenfeld befasste sich mit Landnutzungskonflikten, und zwar speziell mit der Flächenkonkurrenz zwischen Schutzgebieten und der Nutzung für wirtschaftliche Zwecke. Insgesamt haben die globalen Teilnehmer sich für die Einrichtung und Erhaltung von Schutzgebieten ausgesprochen, wobei die deutschen Teilnehmer weniger auf wirtschaftliche Ziele Rücksicht nehmen wollten als der globale Durchschnitt (Abb. 3).
Deutliche Unterschiede gab es allerdings bei der Beurteilung übergreifender Strategien: Während international stärker auf die Intensivierung der Landwirtschaft gesetzt wurde, um die Flächenkonkurrenz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu entschärfen, ging das Pendel bei deutschen Teilnehmern stärker hin zu veränderten Konsummustern (Abb. 4).
Ein ähnliches Muster ergab sich für den Schutz der Ozeane. Die deutschen Teilnehmer drängten stärker und schneller auf die Abschaffung der umweltschädlichen Subventionen als der globale Durchschnitt (Abb. 5). Global sehr einig hingegen war man sich in der Frage, ob ein neues internationales Abkommen zur Einrichtung von Meeresschutzgebieten im Hochseebereich getroffen werden soll (94 % Zustimmung der deutschen Teilnehmer und 90 % im globalen Durchschnitt).
Auf globaler Ebene stimmten tendenziell mehr Teilnehmer für eine Verschiebung der Kostenübernahme bei Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt durch Industrieländer, wobei sich die überwiegende Mehrheit für eine gemeinsame Übernahme der Kosten bekannte. Firmen und Verbraucher wurden nur von 20 % der deutschen bzw. 10 % der internationalen Teilnehmer als geeignete Adressaten benannt.
Nutzer bereits bestehender Sammlungen genetischer Ressourcen befinden sich meist in industrialisierten Ländern des Nordens, während die Herkünfte oft in weniger entwickelten Ländern des Südens liegen. Auf der CBD-Vertragsstaatenkonferenz 2010 in Nagoya wurde deshalb ein Protokoll verabschiedet, das als Kernelement Regelungen zum gerechten Vorteilsausgleich (ABS – Access and Benefit Sharing) beinhaltet. Die Frage, ob aus solchen Sammlungen resultierende Vorteile auch dann geteilt werden sollten, wenn die Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen sich bereits vor Inkrafttreten des Nagoya-Protokolls auf dem Territorium der Nutzerländer befanden, beantwortete die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer mit Ja (Abb. 6).
Nach einer generellen Einschätzung zu dem Verfahren der WWViews befragt, zeigte sich die Mehrheit der Teilnehmer zufrieden mit der Vorbereitung und den Informationsmaterialien. Allerdings stachen die deutschen Teilnehmer global damit heraus, dass sie die Aussichten auf eine politische Umsetzung der Ergebnisse am zurückhaltendsten beurteilten (Abb. 7).
3.3 Ergänzende Angaben auf den Tischkärtchen
Zusätzlich zur Beantwortung der Fragebögen (und den Anfragen der Begleitforscher) haben die Teilnehmer während der Veranstaltung 174 Tischkarten (DIN A6) beschrieben. Eine systematische Auswertung wird durch Kaufmann et al. erfolgen, basierend auf einer Diskursanalyse (zur Methode siehe Kaufmann & Hurtienne 2011); hier ist eine exemplarische Auswahl zusammengestellt, eine komplette Transkription ist in Anhang 3 (unter http://www.nul-online.de Service Downloads) einsehbar.
Für die einzelnen Themenfelder ließen sich einige wiederkehrende Motive erkennen. Im einleitenden Teil zur biologischen Vielfalt wurde darauf hingewiesen, dass auch ethische Dimensionen sowie Interessenkonflikte mit im Spiel sind, und eine Verbindung zum persönlichen Leben gezogen („egoistisches Denken abschalten“, „gesellschaftliche Kerninteressen krachen aneinander“, „…Respekt vor Natur, Tieren und den Mitmenschen als humanistisches Anliegen muss gefördert werden“, „Menschenrechte Generationen-übergreifend formulieren“, „Ist der Begriff ‚Biodiversität‘ wirklich allgemein und wertfrei gemeint? Oder steht nicht immer der Nutzen für den Menschen im Vordergrund?“).
Eine Reihe von Teilnehmern forderte verstärkte Bemühungen zur Bildung, sowohl in Kindergärten und Schulen als auch gesamtgesellschaftlich („Kinder müssen stärker begeistert werden“, „nur was man kennt, kann einem fehlen interessantes Projekt ist urban gardening; durch grünere Infrastruktur und dadurch direkte Konfrontation/Nutzung von Natur kann Bewusstsein und Wertschätzung entstehen“).
Beim Themenfeld „Landnutzungskonflikte“ wurden teilweise sehr konkrete Vorschläge eingebracht („Notwendigkeit stärkerer international institutionalisierter Verantwortung zur Koordination von Schutzgebieten; Rohstoffbörse verbieten; wissenschaftliche Unterstützung – insbesondere der landwirtschaftlichen Nutzung – zur Vermeidung von u.a. Überdüngung“, „Waren müssen zu ihrem ‚wahren‘ Preis verkauft werden, um Verbrauchern eine transparente Wahlgrundlage zu geben, ohne wettbewerbsverzerrende Subventionen und Niedriglöhne; kein Recht auf billiges Fleisch Preis sollte angepasst werden“, „Zielkonflikt Nahrungssicherung versus Biodiversitätsschutz ganzheitliche Sicht notwendig; kleinere Energiewirtschaft; kein Energiepflanzenanbau; andere Technologien (nutzen)“).
Die Kommentare der Teilnehmenden beim Themenfeld „marine Biodiversität“ zeigten auch eine weite Spannbreite von Vorschlägen zur Änderung persönlicher Konsummuster und reichten bis hin zur internationalen Fischereipolitik („Subventionen an Nachhaltigkeitsziele knüpfen“, „Erweiterungen der Schutzzonen von 250 auf 500 Meilen“, „Änderung des Konsumverhaltens: Einschränkung im Verbrauch; höhere Transparenz: MSC-Zertifizierung; ähnlich zur Fairtrade-Initiative bei Kaffee; gesetzliche Regelungen“, „Fischfarmen nicht mit Fangfisch füttern“, „Ernährungswissenschaftler sollten aufhören, Fisch als besonders gesund zu bewerben; Frontex sollte den Auftrag bekommen, illegale Fischerei vor Westafrika zu unterbinden, bei GEF sollte ein globaler Korallenrifffonds eingerichtet werden, in den alle Länder einzahlen“).
Beim Themenfeld zu „Kosten und Nutzen“ von biologischer Vielfalt, der auch speziell auf Maßnahmen zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls zu ABS einging, wurden neben unterschiedlichen Finanzierungsmodellen („keine Zahlungen über die Regierungen ( Korruption, Vetterwirtschaft)“, „globales Gremium zur Steuerung von finanziellen Beiträgen [für die Nutzung genetischer Ressourcen aus Hochseegebieten] UNO-Charta weiterentwickeln“, „Einfuhrzölle für genetische Diversität aus internationalen Gewässern, die in einen Biodiversitäts-Fond fließen“) auch die Ablehnung der Patentierung von Lebewesen („keine Patente auf Tiere und Pflanzen (Lebewesen))“ sowie der Zugang zu Informationen („Clearing-House-Mechanismen; Zugang aller zu Daten, Verfügbarmachung bzw. mehr Transparenz!“, „Geistige Eigentumsrechte gerechter zu verwalten“) aufgegriffen.
Die Rückmeldung der Teilnehmenden zum Prozess der WWViews fielen gemischt aus und reichten von Dankbarkeit („Danke“) über Verbesserungsvorschläge („einer vom BMU hätte hier sein müssen“, „bessere Schulung der Moderatoren + Entwicklung des ‚roten Fadens‘“, „mehr Beispiele bringen, Thesen formulieren, Konflikte konkret thematisieren regionale Fallbeispiele“) bis hin zu Unbehagen und völligen Ablehnung („Fachwissen fehlte, um sich wirklich sinnvoll äußern zu können unbefriedigend; habe verstanden, warum bestimmte Fragestellungen definitiv von Experten bearbeitet werden müssen; trotz Freude über Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung in jeder Runde ein gewisses Ohnmachtsgefühl“, „kontrovers diskutiert? – 14 Tische – eine Meinung, nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung“).
4 Diskussion
4.1 Zusammensetzung der Teilnehmer und Repräsentativität der Ergebnisse
Unter den deutschen Teilnehmern der WWViews-Veranstaltung waren vergleichsweise viele mit höherem Bildungsabschluss vertreten – sowohl im internationalen Vergleich als auch in Bezug auf Deutschland (Daten für 2010 von Statistischen Bundesamt 2012). Von den Teilnehmern haben 66 % ein Studium abgeschlossen, der Schnitt in Deutschland liegt bei 14 %. Der Anteil der „Jugend“ hingegen war repräsentativ, auch bundesweit sind nur 11 % der Bevölkerung in der Altersgruppe 15 bis 25 Jahre. Frauen waren insgesamt deutlich überrepräsentiert.
Der hohe Bildungsstand und das entsprechend hohe Reflektionsniveau erklären sicherlich auch die zurückhaltende Einschätzung politischer Wirksamkeit – die Teilnehmer aus Entwicklungs- und Schwellenländern waren etwas optimistischer, was einen möglichen Einfluss anging. Die deutschen Teilnehmer äußerten sich entsprechend auch kritisch zum WWViews-Prozess selbst, der sehr viele Vorgaben macht, und haben über die Tischkarten sehr viele eigene Ideen, Vorschläge und Anmerkungen eingebracht.
4.2 Ergebnisse der Abstimmung im internationalen Vergleich
Die deutschen Teilnehmer haben sich deutlicher für die Erhaltung der biologischen Vielfalt auch auf Kosten möglicher wirtschaftlicher Einschränkungen ausgesprochen als der globale Durchschnitt. Besonders sichtbar wurde das bei der Bewertung übergeordneter Strategien, bei denen sich die Deutschen eher für Konsumverzicht aussprachen als die Teilnehmer in Entwicklungsländern. Dabei ist zu bedenken, dass das Ausgangsniveau ein völlig anderes ist, da viele Entwicklungsländer noch mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse wie Nahrungsmittelsicherheit, Wasserdargebot oder Wohnraum und Bildung kämpfen. Deshalb ist klar nachvollziehbar, dass durch die meisten der dortigen Teilnehmenden keine Einschränkungen akzeptiert werden können, die das Ziel der Befriedigung dieser Grundbedürfnisse gefährdet.
Dass mehr für die Bildung und für die Verbesserung der Kenntnisse getan werden sollte, fand global Anklang. Bereits jetzt zeigen die Einschätzungen der Befragten eine Wahrnehmung der Erkenntnisse von Experten, dass Entwicklungsländer stärker unter den Folgen des Verlustes von Biodiversität leiden als Industrieländer. Im Zuge globaler Wandlungsprozesse, vor allem mit einem beschleunigten Fortschreiten der globalen Erwärmung, wird sich der Verlust von Biodiversität vor allem in Entwicklungsländern beschleunigen (CBD 2010, Sachs et al. 2009). Direkte und indirekte negative Auswirkungen wegfallender ökosystemarer Leistungen sollten daher verstärkt mithilfe geeigneter Bildungsmaßnahmen, wie beispielsweise deliberativer Prozesse, in den Fokus gerückt werden.
Die Teilnehmer in Entwicklungsländern fordern auch eine größere finanzielle Beteiligung der Industrieländer an der Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz von Biodiversität als diejenigen in Deutschland; allerdings sind diese Unterschiede innerhalb des Teilnehmerpanels nicht gravierend, die Übereinstimmung, dass alle Menschen ihren Beitrag leisten müssten, überwiegt sowohl in Deutschland als auch weltweit. Erstaunlich einig ist man sich, was den finanziellen Ausgleich für die Nutzung biologischer Ressourcen außerhalb der Souveränität der Länder angeht, nämlich im Hochseegebiet. Von deutschen Teilnehmern wurden auch konkrete Vorschläge für Lösungsansätze genannt, wie beispielsweise die Einrichtung eines Fonds oder die Weiterentwicklung der UN-Charta.
4.3 Eingang der Ergebnisse in die COP 11
Auf der 11. Vertragsstaatenkonferenz zur Konvention über die Biologische Vielfalt (CBD COP 11) gab es eine Reihe von Aktivitäten im Hinblick auf die WWViews on Biodiversity, es wurde sowohl ein high-level-Segment durchgeführt, auf dem dem Generalsekretär der CBD, Braulio Ferreira de Souza Dias, der internationale WWViews-Bericht überreicht wurde, als auch site-events zum Thema. Die WWViews finden sich auch in den Beschlüssen wieder, unter Kapitel D zur UN-Dekade zur biologischen Vielfalt, Absatz 24, wo die Länder aufgefordert sind, Maßnahmen zu ergreifen, um Biodiversität über partizipatives Planen, Wissensmanagement und Capacity Building, wie es beispielsweise mit den WWViews praktiziert wurde, zu fördern (CBD 2012) – im englischen Original: „Encourages Parties, relevant organizations and stakeholders to support and contribute to communication initiatives, such as the World Wide Views on Biodiversity, which combine the implementation of Strategic Goals A and E regarding mainstreaming of biodiversity, participatory planning, knowledge management and capacity-building.“
Angesichts der Vielzahl an Informationen und Eingaben, die vor und während der CBD-Konferenzen an die verhandelnden Delegierten der Vertragsstaatenländer herangetragen werden, belegt die Aufnahme des partizipativen Ansatzes in die Beschlusstexte die Wahrnehmung des Prozesses. Inwieweit die Länder die inhaltlichen und methodischen Anregungen tatsächlich aufgreifen werden, wird die weitere Entwicklung der internationalen Verhandlungen zeigen. Das Interesse an einer (modifizierten) Fortführung scheint beim Sekretariat der CBD groß zu sein; einige wie beispielsweise Michael Zschiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UFU) sehen die WWViews auch als Vorläufer eines globalen Bürgerparlaments (vgl. Vohland 2012).
4.4 Wurde eine breitere Öffentlichkeit erreicht?
Die deutschen Medien haben sehr verhalten auf das Thema reagiert. Die Pressemitteilungen wurden zwar von einer Reihe von online-Medien aufgegriffen (z.B. idw, Finanzen 100, Jura-Forum, uni-online, vbio) bzw. diese haben auch selbst berichtet [CSR-nachhaltig wirtschaften online ( http://www.forum-csr.net ), Webportal zur Pflanzenforschung ( http://www.pflanzenforschung.de/journal/aktuelles/buergerkonferenz-zur-biodiversitaet ), Bild der Wissenschaft ( http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/316858.html )]. Aber nur der Tagesspiegel hat einen selbst verfassten Bericht abgedruckt (Der Tagesspiegel, 18.09.2012) und das Deutschlandradio Kultur hat im Radiofeuilleton über eine sich am 15.10.2012 im Museum für Naturkunde Berlin anschließende Podiumsdiskussion zur Reflektion der Ergebnisse berichtet (Vohland 2012).
Eine Erklärung für ein geringes Medieninteresse an der speziellen Veranstaltung, aber auch an den Ergebnissen der CBD COP 11 insgesamt, kann durchaus in der starken Konkurrenz durch andere Themen liegen, wie beispielsweise die Energiewende. Es kann aber auch darin begründet sein, dass es bei der COP 11 vorrangig um die Umsetzung der auf der COP 10 beschlossenen Ziele ging, also vor allem um die Aushandlung der Verpflichtungen für finanzielle Leistungen der Industrieländer für die Entwicklungsländer und um Details der möglichen Umsetzung.
4.5 Sind die WWViews ein wirksames Instrument der Beteiligung?
Die Bildung einer „globalen Bürgerschaft“ ist ein Prozess, der sicherlich durch die Nutzung moderner Kommunikationsmedien beschleunigt wird, aber trotzdem einer fundierten inhaltlichen Grundlage bedarf. Gerade die politischen Prozesse, die zur Erhaltung der biologischen Vielfalt führen sollen, werden als sehr komplex und für einfache Bürger schwierig nachvollziehbar eingeschätzt. Andererseits ist der Bezug von Biodiversität zum eigenen Leben und auch zu einem „gelungenen Leben“ sehr hoch (Eser et al. 2011) bzw. er sollte das nach Experteneinschätzungen sein.
Ziel der WWViews ist es, durch eine ergebnisoffene Diskussion der Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt die Ownership, das Mittragen von Entscheidungen, zu erhöhen. Aufgrund der starken Vorgaben der internationalen WWViews-Organisatoren und den mangelhaften Möglichkeiten, sich an der Entwicklung von Fragen und Informationsmaterialien und an der Ausarbeitung der auf der Konferenz zu diskutierenden Themen zu beteiligen, ist das noch nicht gelungen, und die Veranstaltung hatte den Charakter einer erweiterten Meinungsumfrage (vgl. auch Goldschmidt et al. 2012). Für das Anliegen einer globalen Partizipation ist die aktuelle Struktur und Ausgestaltung des Prozesses noch sehr top-down ausgerichtet.
Dennoch muss man den internationalen Veranstaltern zugutehalten, dass sie es geschafft haben, den Ansatz einer stärkeren Beteiligung der globalen Bevölkerung an Entscheidungen überhaupt so hoch auf die Agenda gebracht zu haben. Eine notwendige und wünschenswerte Weiterentwicklung der Methode ließe sich auf bekannte Verfahren und Kontakte, frühere Evaluierungen (Rask et al. 2012) sowie noch zu analysierende, aktuell durchgeführte begleitende Befragungen und vergleichende methodische Analysen (vgl. Knapp & Hauser 2011) aufbauen.
5 Ausblick
Das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis von deliberativen Verfahren wie den deutschen WWViews on Biodiversity lohnt sich nach einem kritischen Rückblick nur, wenn der Prozess verbessert und noch besser an politische Entscheidungsprozesse angebunden wird. Es wurde deutlich, dass ein großes Interesse bei den teilnehmenden Bürgern besteht, sich konstruktiv und frei auch an komplexen globalen Aushandlungsprozessen zu beteiligen. Allerdings war die Reaktion der Teilnehmer etwas ambivalent: Zum einen haben sie von einer einzelnen Veranstaltung einen großen Effekt erwartet, zum anderen drückten die Ergebnisse der Befragungen auch eine große Skepsis aus. Ein wichtiges Nebenziel künftiger WWViews wird also auch sein (müssen), Bürgerinnen und Bürgern die – wenngleich auch häufig unbefriedigenden – Abläufe der politischen Aushandlungsprozesse nahe zu bringen. Aktivitäten wie diese könnten einen wesentlichen Beitrag leisten, um hierauf hinzuwirken, wie es auch als Erwartungshaltung auf den Tischkärtchen formuliert wurde: „Ich erwarte zur Realisierung der Probleme der Biodiversität, dass in Deutschland das Primat der Politik wieder Einzug hält.“
Dank
Den Moderatoren sowie technischen und inhaltlichen Unterstützern der Veranstaltung sei namentlich gedankt: Juliane Röhner, Lisa Kluckert, Alexander Kroupa, Nora Lange, Dörte Badock, Oskar Neumann, Elke Herwick, Christoph Häuser, Lucie Nichelmann (MfN), Willem Warnecke, Mathias Kümmerle (Senckenberg Gesellschaft), Marion Mehring (ISOE), Christine Scholl (PIK), Franziska Sperfeld, Heike Müller, Fabian Stolpe (UFU), Sebastian Tilch, Carolin Kugel (UFZ), Cornelius Hemmer, Corinna Hölzer (GreenMediaNet), Sandra Lukatsch (ALTOP), Michael Glemnitz (ZALF), Georg Heiß (FU Berlin), Klaus Angerer (TU Berlin).
Für die finanzielle Unterstützung danken wir dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), den Organisatoren des Wissenschaftsjahres in den Forschungsmuseen in der Senckenberg-Gesellschaft, dem Leibniz-Verbund für Biodiversität, den Freunden und Förderern des Museums für Naturkunde Berlin e.V., dem Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung NeFo, der Volkswagen-Aktiengesellschaft über den Stifterverband der Deutschen Wissenschaft und dem Karlsruher Institut für Technologie.
Literatur
Convention on Biological Diversity (CBD, 2012): UNEP/CBD/COP/11/35, Decisions adopted by the conference of the parties to the Convention on Biological Diversity at its eleventh meeting (Hyderabad, India, 8-19 October 2012). http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/full/cop-11-dec-en.pdf.
Doyle, U., Vohland, K., Ott, K. (2010): Biodiversitätspolitik in Deutschland – Defizite und Herausforderungen. Natur und Landschaft 85, 308-314.
Eser, U., Neureuther, A.-K., Müller, A. (2011): Klugheit, Glück, Gerechtigkeit. Ethische Argumentationslinien in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Naturschutz und Biologische Vielfalt 107, 1-119.
Goldschmidt, R., Hennen, L., Knapp, M., Quendt, C., Brachatzek, N., Renn, O. (2012): Deliberating or voting? Results of the process evaluation of the German WWViews. In: Rask, M., Worthington R., Lammi M., Citizen participation in global environmental governance, Earthscan, London, New York, 89-106.
Kaufmann, G., Hurtienne, T. (2011): Inglehart’s World Value Survey and Q Methodology. Journal of Human Subjectivity 9, 41-68.
Knapp, M., Hauser, C (2011): Neue Impulse für die Diskussion um eine nachhaltige Klimapolitik – Globales Bürgerbeteiligungsprojekt WWViews. In: Banse, G., Janikowski, R., Kiepas, A., Hrsg., Nachhaltige Entwicklung – transnational, Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa, edition sigma, Berlin, 63-80.
Mace, G.M., Cramer, W., Díaz, S., Faith, D.P., Larigauderie, A., Prestre, P.L., Palmer, M., Perrings, C., Scholes, R.J., Walpole, M., Walther, B.A., Watson, J.E.M., Mooney, H.A. (2010). Biodiversity targets after 2010. Cosust 2,1-6.
Rask, M., Worthington, R., Lammi, M. (eds., 2012): Citizen Participation in Global Environmental Governance. Earthscan, London, New York, 1-302.
Sachs, J.D., Baillie, J.E.M., Sutherland, W.J., Armsworth, P.R., Ash, N., Beddington, J., Blackburn, T.M., Collen, B., Gardiner, B., Gaston, K.J., Godfray, H.C.J., Green, R.E., Harvey, P.H., House, B., Knapp, S., Kümpel, N.F., Macdonald, D.W., Mace, G.M., Mallet, J., Matthews, A., May, R.M., Petchey, O., Purvis, A., Roe, D., Safi, K., Turner, K., Walpole, M., Watson, R., Jones, K.E. (2009): Biodiversity Conservation and the Millennium Development Goals. Science 325,1502-1503.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD, 2010): Global Biodiversity Outlook 3, Montréal.
Statistisches Bundesamt (2012): DESTATIS. http://www.destatis.de/DE/Startseite.html
Sukopp, U., Neukirchen, M., Ackermann, W., Fuchs, D., Sachteleben, J., Schweiger, M. (2010): Bilanzierung der Indikatoren der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt: Wo steht Deutschland beim 2010-Ziel? Natur und Landschaft 85, 288-300.
Vohland, K. (2012): Bürgerbeteiligung an der COP? Kann das gehen? http://www.biodiversity.de/index.php/de/service-fuer-politik-ngos/aktuelles-news/3146-buergerbeteiligung-an-der-cop.
World Wide Views on Biodiversity (2012): From the world’s citizens to the biodiversity policymakers. Results Report in The Danish Board of Technology Foundation, http://biodiversity.wwviews.org/wp-content/uploads/2012/10/WWViewsResultsReport_WEB_FINAL.pdf.
Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Katrin Vohland, Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Generaldirektion, Invalidenstraße 43, D-10115 Berlin, E-Mail katrin.vohland@mfn-berlin.de; Dr. Martin Knapp, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlstraße 11, D-76133 Karlsruhe; Eva Patzschke, Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, D-10115 Berlin; Dr. Matthias Premke-Kraus, Leibniz-Verbund Biodiversität, c/o Leibniz-Gemeinschaft, Chausseestraße 111, D-10115 Berlin; Michael Zschiesche, Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V., Greifswalder Straße 4, D-10405 Berlin; Dr. Rene Zimmer, Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V., Greifswalder Straße 4, D-10405 Berlin; Dr. Jens Freitag, Genius, Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, D-10117 Berlin; Lena Herlitzius, Triple Helix DIALOG, Rosa-Menzer-Straße 14, D-01309 Dresden; Dr. Götz Kaufmann, Freie Universität Berlin, John F. Kennedy Institute for North American Studies, Department of Sociology, Lansstraße 7-9, D-14195 Berlin; Johannes Vogel, Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Generaldirektion, Invalidenstraße 43, D-10115 Berlin.
Anhänge unter http://www.nul-online.de Service Downloads: (1) Ablauf; (2) Fragen; (3) Transkription der Tischkarten.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen







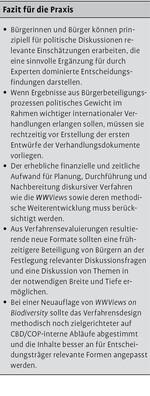
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.