Umweltbildung im Mystery-check
Abstracts
Mit Hilfe des in der Tourismusforschung häufig angewandten Mystery-checks wurden Umweltbildungseinrichtungen in Bayern auf ihr Angebot für Jugendliche überprüft. Basierend auf einer Literaturstudie und Empfehlungen pädagogischer Institutionen wurden als wesentliche Kriterien für die spezielle Eignung in diesem Zusammenhang das „Anknüpfen an die Interessen Jugendlicher“, die „Förderung von Eigenaktivität, Beteiligung oder Mitbestimmung“, der „Beitrag zur Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung“, die „Förderung sozialer Handlungskompetenzen“ sowie die „Auseinandersetzung mit Werten, Normen und eigenem Verhalten“ abgeleitet.
Von den 99 in der vorliegenden Arbeit untersuchten bayerischen Einrichtungen können 38 für Jugendliche geeignete bzw. sehr geeignete Angebote aufweisen, 61 Einrichtungen dagegen führen keine für diese Zielgruppe geeigneten Veranstaltungen im Programm. Damit müsste bei fast zwei Drittel der bayerischen Umweltbildungseinrichtungen das Angebot für Jugendliche verbessert werden.
Mystery Checks for Environmental Education – Analysis of out-of-school institutions for environmental education of teenagers in Bavaria
Using the method of mystery checks which has frequently been applied in tourism research the study investigates institutions for environmental education in Bavaria in terms of their offers for teenagers. Based on literature study and on recommendations of pedagogic institutions the following major criteria have been derived to identify the special qualification in this context: “links to the interests of teenagers”, “encouragement of self-initiative and participation”, “contribution to the development of identity and personality”, “promotion of social competence”, and “confrontation with values, standards and own behaviour”. From the 99 institutions investigated 38 are featuring suitable or very suitable offers for teenagers, 91 institutions do not include appropriate events in their programmes. This means that nearly two third of the institutions for environmental education in Bavaria should improve their offers for teenagers.
- Veröffentlicht am
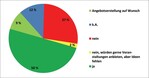
1 Einleitung
Umweltbildung gehört zu den gesetzlichen Aufgaben vieler Schutzgebiete und findet sich auch in der Aufgabenbeschreibung unterschiedlicher Bildungseinrichtungen wieder (Giesel et al. 2002). Unter Umweltbildung verstehen wir „die Vermittlung von Informationen, Methoden und Werten, um Menschen zur verantwortlichen Auseinandersetzung mit den Folgen ihres Tuns in der natürlichen, der bebauten und der sozialen Umwelt zu befähigen und zu umweltgerechtem Handeln und Verhalten zu bewegen“ (ANU 2003, 2). In der Literatur, bei den Veranstaltern und auf Fachtagungen wird ein problematisches Verhältnis der Jugendlichen gegenüber Umweltbildungsangeboten und dem Thema Umwelt beschrieben (vgl. Brickwedde et al. 2008, Lutz-Simon & Häusler 2006, Pröbstl et al. 2006). Verschiedene Autoren beschreiben u.a. ein beobachtetes Desinteresse, Motivationsschwierigkeiten und einen erschwerten Zugang zu den Jugendlichen (Hesse 1984, Kögel et al. 2000, Löwe 1992).
Auf der anderen Seite zeigt die Fachliteratur (Hurrelmann 2007), aber auch die praktische Erfahrung von Umweltpädagogen (Pröbstl et al. 2006, 4ff.), dass die Lebensphase „Jugend“ als etwas Eigenständiges zu behandeln ist.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die beobachtete Problemstellung und Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation auf ein allgemein geringes Interesse der Jugendlichen zurückzuführen ist (vgl. Krapp 1998) oder vielleicht auf die Art der Vermittlung und Defizite durch eine nicht zielgruppengerechte pädagogische Konzeption?
Dieser Frage soll im folgenden Beitrag am Beispiel der außerschulischen Umweltbildungsangebote in Bayern nachgegangen werden.
2 Herausforderungen der Zielgruppe „Jugendliche“
Aus soziologischer Sicht ist der Übergang vom Kind zum Jugendlichen nicht eindeutig zu definieren. Als Merkmale können die beginnende Ablösung von den Eltern bzw. primären Bezugspersonen und die gleichzeitig verstärkte Zuwendung zu Gleichaltrigen sowie der allmähliche Ausbau der Handlungsspielräume und die Erweiterung der Rollenvielfalt dienen (Hurrelmann 2007, 31). Typisch für diese Phase ist die Koexistenz von selbständigen und unselbständigen Handlungsbereichen. Dieser Übergang vom Kind zum Jugendlichen findet meist im Alter ab etwa zwölf Jahren statt. Ein weiteres Charakteristikum dieser Lebensphase ist die Sinn- und Orientierungssuche sowie die Identitätssuche. Dabei stehen Jugendliche im Spannungsverhältnis zwischen der Integration (d.h. dem Prozess der Übernahme verantwortlicher sozialer Rollen) einerseits und der Individuation (d.h. der Entwicklung einer einmaligen, unverwechselbaren Persönlichkeit) andererseits (Hurrelmann 2007, 30). Sie müssen eine Persönlichkeitsstruktur entwickeln, die flexibel gegenüber sich rasch ändernden sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen ist (Hurrelmann et al. 2006, 41). Eine weitere Herausforderung ist die Spannung zwischen der Selbstbestimmung und Selbständigkeit in soziokulturellen auf der einen Seite und der Unselbständigkeit in sozioökonomischen Lebensbereichen auf der Anderen. Der verzögerte Übertritt in den Erwerbssektor und die ökonomische Abhängigkeit stehen im Kontrast zu dem wachsenden Bedürfnis der Selbständigkeit in allen Lebensbereichen (Hurrelmann et al. 2006, 35).
Auf psychischer, emotionaler, kultureller und räumlicher Ebene findet die allmähliche Ablösung und Abgrenzung von den Eltern statt (Hurrelmann 2007, 118; Reinders 2006, 81). Parallel zur Distanzierung von den Eltern erfolgt schrittweise der Aufbau von Freundschaften, die ebenfalls Sozialisationsfunktion besitzen, da Partner- bzw. Lebensvorstellungen entwickelt werden (Hurrelmann 2007, 119; Reinders 2006, 81). Jugendliche orientieren sich verstärkt an Menschen mit ähnlichem Alter und aus ähnlichen Lebenswelten. Der Einfluss der Eltern auf alltägliche Verhaltensmuster, vor allem im Freizeitsektor, sinkt und die Jugendlichen lösen sich von den nicht freiwillig gewählten „Zwangsgruppen“ Familie und Schule, um mit der selbst gewählten Gruppe Gleichaltriger, der „Peer Group“, ihre Freizeit zu verbringen.
2 Bedeutung von Umweltaspekten für Jugendliche
Eine wichtige Grundlage für die Beurteilung von Einstellungen und Werten bei Jugendlichen liefert die in regelmäßigen Abständen erstellte Shell-Jugend-Studie (vgl. Shell Deutschland Holding 2006). Die geäußerte Angst vor Terroranschlägen (67 %), Umweltverschmutzung (61 %) und Krieg in Europa (51 %) spiegelt die Präsenz der Themen in den Medien wieder und dürfte nicht aus konkretem, direktem Anlass bei Jugendlichen entstehen. Der von nur 14 % gesehene Handlungsbedarf auf dem Sektor „Umweltschutz“ steht in extremem Gegensatz zu der von 61 % der Jugendlichen geäußerten Angst vor Umweltverschmutzung.
Anstatt „ideologischer Konzepte oder auch gesellschaftspolitischer Utopien“ ist Jugendlichen „die persönlich befriedigende Aktivität im eigenen Umfeld“ wichtig (Schneekloth 2006, 129f.). Der persönliche, fassbare Nutzen ist für ein mögliches Engagement ausschlaggebend. In Hilfsorganisationen, wie z.B. Greenpeace, engagieren sich daher nur 4 % (Schneekloth 2006, 126).
Die 15. Shell-Jugendstudie legt zwar dar, dass bei Jugendlichen die Begriffe „Umweltschutz“ bzw. „Umweltverschmutzung“ oder „Umweltbewusstsein“ präsent sind, sagt aber nichts über den Bezug Jugendlicher zur Umwelt und zur Natur oder über ihr genaueres Verständnis von Zusammenhängen und Hintergründen aus.
Ergänzende Hinweise liefert der „Jugendreport Natur ’06“ (Brämer 2006). Danach wissen Jugendliche nur unzureichend über alltägliche Naturerscheinungen Bescheid, ihr Interesse an Zusammenhängen in der Natur sinkt und sie haben im Gegensatz zu Erwachsenen deutlich weniger Bedarf an Naturnähe. Viele betrachten Natur als langweilig (Brämer 2006: 10). Eine bloße Bereitstellung von „Naturerfahrungsräumen“ reicht nicht zur „Renaturierung des Jugendlebens“ aus. Mit den bedrohlichen Seiten der Natur und der Notwendigkeit der Nutzung ist der Großteil der Jugendlichen noch nie in Berührung gekommen, was nach Brämer (2006, 59) nicht zu einem realistischen Naturbild bei der jungen Generation führen kann. Drei Aspekte hebt Brämer (2006) in diesem Zusammenhang besonders hervor:
Bambisyndrom: Jugendliche sind der Meinung, dass Natur einen hohen Wert besitzt, sie nicht nur wichtig, gut, schön und harmonisch, sondern auch verletzlich, bedroht und hilfsbedürftig ist. Die Natur muss geschützt werden, darf nicht verschmutzt und zerstört werden. Diese Einstellung grenzt den Menschen aus der Natur aus und beschränkt den Erlebnis-, Entdecker- und Bewegungsdrang Jugendlicher.
Wirtschafts-Tabu: Jugendlichen fehlt das Bewusstsein, dass Natur genutzt werden muss, damit alltägliche Konsumprodukte bereitgestellt werden können. Auf die Frage nach natürlichen Rohstoffen von alltäglichen Produkten kann ein Großteil nicht aufgeführt werden.
Weltbild-Parzellierung: Das Naturbild Jugendlicher besteht aus zueinander beziehungslosen Teilen. Naturerfahrungen, -einstellungen, Handlungen, Naturmoral und bevorzugte Freizeitaktivitäten beeinflussen sich gegenseitig sehr wenig. Das wird vor allem deutlich im hohen Wert, den Jugendliche der Natur zugestehen, und ihrem gleichzeitig geringen alltäglichen Naturumgang. Es gibt kaum einen Bezug zwischen Wert und Handeln.
Ein vergleichbares Umwelt- und Naturverständnis Jugendlicher zeigen auch die qualitativen Interviews der Universität Würzburg mit Jugendlichen zu deren Umwelt- und Naturverständnis und ihrer alltäglichen Lebenswelt (Straten & Zinn 2006, 39).
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass spezifische Umweltbildungsangebote grundsätzlich notwendig sind und bei Bildungseinrichtungen einen entsprechend hohen Stellenwert erhalten sollten.
3 Einrichtungen für außerschulische Umweltbildung
Träger der außerschulischen Umweltbildung sind Institutionen und Organisationen, die außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie der Hochschulen Umweltbildungsmaßnahmen anbieten (vgl. Giesel et al. 2002, 1). Darunter fallen grundsätzlich Umweltverbände und -initiativen sowie NGOs (wie z.B. Angebote des Bund Naturschutz), Naturschutz- und Umweltzentren, Umweltstationen, allgemeine Verbände und Vereine, Volkshochschulen, ausgewählte Behörden, Forschungseinrichtungen, Museen, Kammern, Bildungswerke, Stiftungen und Fördervereine, Akademien, Verbraucherzentralen, Kirchen, Wirtschaft und Gewerkschaften und Parteien (vgl. Giesel et al. 2002, 84f.). Den größten Anteil unter den Anbietern nehmen in Deutschland die Umweltverbände und vereine sowie die Umwelt- und Naturschutzzentren ein.
Bei der Auswahl von Anbietern von Umweltbildungsveranstaltungen wurden für die vorliegende Studie zunächst staatliche Einrichtungen erfasst, wie die Nationalparke (Bildungsauftrag siehe BNatSchG), die Bayerischen Staatsforsten (Bildungsauftrag siehe BayWaldG), Schutzgebiete mit Bildungsanliegen, wie die Naturparke (Bildungsanliegen siehe Verband Deutscher Naturparke e.V. 2005, S. 8, 9, 12), die Biosphärenreservate sowie die Angebote der großen Naturschutzverbände (Bund Naturschutz in Bayern e.V., Landesbund für Vogelschutz (LBV) bzw. Naturschutzbund Deutschland (NABU) und Deutscher Alpenverein e. V. (DAV)). Dabei wurden nur die landesweiten Angebote erfasst, Angebote von Kreis- und Ortsgruppen wurden nicht beachtet. Weiterhin wurden Angebote der vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit anerkannten Umweltstationen (vgl. http://www.umweltbildung.bayern.de, Stand 2007) sowie weiterer Bildungsstätten, Vereine, Infozentren und Zooschulen, welche in der Umweltzentren-Datenbank der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU; http://www.umweltbildung.de/umweltzentren.html, Stand 2007) aufgeführt sind, in die Untersuchung mit einbezogen.
Unberücksichtigt blieben Angebote von sonstigen Jugendverbänden, da der Schwerpunkt dieser Verbände nicht im Bereich der Umweltbildung liegt, sowie von Angeboten freiberuflicher Umweltpädagogen. Programme von Jugendherbergen und Schullandheimen wurden bei der Auswertung ebenfalls nicht berücksichtigt, da der Aufenthalt in Schullandheimen in Bayern in den 6. Klassen vorgesehen ist und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren selten zu Gast sind.
4 Methode
4.1 Mystery-research
Als Methode wurde die so genannte Mystery-research angewandt, die aus den USA stammt und seit Ende der 1980er Jahre auch in Deutschland Verbreitung findet (Pergandé & Stücken 2004, 205). Als „Mystery Customer Research“ werden Verfahren bezeichnet, bei denen die Forscher verdeckt, als normale „Kunden“ getarnt, fingierte Verkaufs- oder Beratungsgespräche durchführen und dabei detailliert die Abwicklung in Verkauf oder Beratung im Telefon- oder Online-Kontakt beobachten und festhalten. Die Methode ist daher aus wissenschaftlicher Sicht der verdeckten und teilhabenden Beobachtung zuzuordnen. Neben dem Einsatz im Personalbereich wird das so genannte Mystery-shopping, Mystery-calling bzw. der Mystery-check zunehmend auch im Rahmen des Qualitätsmanagements, dem Controlling, im Marketing und dem Vertrieb genutzt (Höhner & Schaper 2004, 36; Stücken 2003, 1).
Inzwischen findet das Instrument in den unterschiedlichsten Bereichen – vor allem bei der Optimierung von Serviceleistungen von der Krankenversicherung über Klinikleistungen bis hin zur Dienstleistung von Bibliotheken – eine breite Verwendung (Barth & Garbely 2009, Beyer 2010, Borfitz 2001, Hartmann et al. 2008). Insbesondere im touristischen Bereich werden mit dieser Methode Freundlichkeit, Fachkompetenz, Engagement und Informationsservice abgefragt (Deutscher Tourismusverband 2001). In der vorliegenden Studie wurde eine telefonische Anfrage bei 106 bayerischen Bildungseinrichtungen durchgeführt, bei der sich die Anruferin als Pädagogin ausgab, die ein Angebot für eine Schulklasse aus Schülern im Alter von 13 bis 15 Jahren buchen möchte. Die Stärken der Methode sind, dass
aus der Sicht des Kunden, d.h. der Schule bzw. der Jugendgruppe, die Erreichbarkeit und der Beratungsservice der Einrichtung mit überprüft werden kann,
die spontane Reaktion des telefonischen Ansprechpartners mit einbezogen werden kann, da im Gegensatz zur schriftlichen Anfrage die „Bedenkzeit“ entfällt,
die Art der Kontaktaufnahme und Überprüfung realitätsnah erfolgt.
Um den Ablauf der Gespräche vergleichbar zu machen, wurde ein Gesprächsleitfaden erstellt. Dabei wurden die Fragen in der Form formuliert, wie sie ein tatsächlicher Interessent stellen würde. Die Reihenfolge der Fragen wurde je nach Gesprächsverlauf flexibel gestaltet (Atteslander et al. 1991, 174ff.). Die erste Frage widmete sich zunächst immer dem Angebot für 13- bis 15jährige Jugendliche. Je nach Antwort folgten daraufhin detailliertere Fragen zu den Angeboten, wie Anzahl der Angebote, Dauer und Art der Veranstaltung sowie Fragen, die die Kompetenz der Einrichtungen bzw. das Interesse an der Zielgruppe Jugendliche klären sollten. Die entstehenden Kosten wurden nicht berücksichtigt.
Fragen, die gestellt wurden, um als potenzieller Interessent glaubwürdig zu wirken, flossen nicht in die Auswertung mit ein (z.B.: Wie lange im Voraus muss man sich anmelden?). Die Anforderung von Informationsmaterial bildete den Abschluss jedes Gesprächs. Zu jedem Telefonat wurde ein Gesprächsprotokoll angefertigt.
4.2 Auswertung von Informationsmaterial
Eine weitere Informationsquelle für die Umweltbildungsveranstaltungen bildete das bei den Telefongesprächen angeforderte Informationsmaterial. Dieses lieferte ergänzende Informationen, da bei den Telefonaten oft nicht das gesamte Angebot detailliert vorgestellt werden konnte. Gleichzeitig sollte auch das Angebot der Einrichtungen erfasst werden, die telefonisch keine Auskunft geben konnten oder sich nicht die Zeit dazu nahmen, aber mit Informationsmaterial dienen konnten. Die Programme wurden entweder per Post zugeschickt oder waren im Internet vorzufinden. Insgesamt wurden 106 Umweltbildungseinrichtungen in Bayern kontaktiert und 99 in die Studie mit einbezogen.
4.3 Indikatoren und Kriterien für die Auswertung
4.3.1 Telefonische Anfrage und Beratung
Für die Auswertung der Informationen (Gespräche, Informationsmaterial) musste eine eigene Methode entwickelt werden. Hierzu wurden Indikatoren und spezifische Kriterien festgelegt und die Ergebnisse dementsprechend ausgewertet. Beim Indikator „Erreichbarkeit der Einrichtungen“ wurden entsprechend der Versuche, die Institution zu erreichen, folgende Kriterien gebildet: War es trotz fünf Anrufversuchen nicht möglich, die Einrichtung zu erreichen, wurde diese als „nicht erreicht“ eingestuft. Mäßige Erreichbarkeit wurde zwischen zwei und fünf Anrufversuchen vergeben. Eine gute Erreichbarkeit war bei einem Anrufversuch bzw. bei einem Rückruf nach Hinterlassen der Telefonnummer gegeben.
Für die „Qualität der Auskunft“ wurden folgende Kriterien definiert: Eine „hohe Qualität“ liegt vor, wenn eine detaillierte Beschreibung der Angebote möglich war; eine „mäßige Qualität“ wurde vergeben, wenn eine knappe Auskunft mit Verweis auf Infomaterial, die Homepage oder andere Informationsquellen erfolgte; eine „geringe Qualität“ liegt vor, wenn keine Auskunft möglich war, da der zuständige Ansprechpartner nicht verfügbar war.
Der Indikator „Vorhandensein von Angeboten für Jugendliche“ bezieht sich auf die Selbsteinschätzung durch die Bildungseinrichtung. Hier konnte unterschieden werden zwischen Einrichtungen, die davon ausgehen, ein solches Angebot zu haben, jenen, die ein solches zusammenstellen können, und Institutionen, die keine entsprechenden Angebote haben.
4.3.2 Bewertung der Angebotseignung für die Zielgruppe der Jugendlichen
In einem zweiten Schritt wurden dann die von den Einrichtungen vorgeschlagenen Angebote (Art, Dauer und Anzahl der Angebote) auf ihre Eignung hin überprüft. Dabei wurde auch das zugesandte Informationsmaterial mit einbezogen. Abschließend wurde auch die „fachliche Kompetenz der Veranstalter“ mit einbezogen und überprüft, über welche Qualifikation die mit der Aufgabe betrauten Personen verfügen.
Methodisch dienen die „Orientierungshilfe zur außerschulischen Jugendbildung“ (SLFS 2002, 3ff.) sowie Konzepte des Landeskuratoriums für außerschulische Jugendbildung (2005, 8) als Basis für die Bewertung. Danach soll Bildung in der Jugendarbeit nicht nur auf eine kognitive Wissensvermittlung abzielen, sondern darüber hinaus auf „die Herausbildung von mehr Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Eigeninitiative“ und „die aktive demokratische Teilhabe an gesellschaftlicher Entwicklung“ (SLFS 2002, 2). Außerschulische Jugendbildung soll zudem dazu beitragen, dass sich Jugendliche mit ihren eigenen und den gesellschaftlichen Lebensbedingungen ihres Umfeldes, mit unterschiedlichen Normen und Werten verschiedener gesellschaftlicher Bereiche und mit verschiedenen Lebenszielen und entwürfen auseinander setzen und kritisch darüber nachdenken (SLFS 2002; 3). Dieses ist dann gegeben, wenn die Angebote einen Bezug zum Lebensweltbereich der Jugendlichen haben und die Programme die Bedürfnisse Jugendlicher berücksichtigen (Hurrelmann 2007, 26-28; Straten & Zinn 2006, 43).
Eine weitere Aufgabe der außerschulischen Jugendbildung ist die Motivation und Vermittlung von Fähigkeiten zur aktiven Teilnahme am Prozess des gesellschaftlichen Lebens sowie zu dessen bewusster Mitgestaltung und zur Verantwortungsübernahme (vgl. Hurrelmann et al 2006, 35). Diese Aspekte wurden daher in den Mittelpunkt der Bewertung der Angebote gestellt. Weitere wichtige Zielsetzungen, wie die Freiwilligkeit und die Offenheit, wurden nicht mit einbezogen, weil bei schulischen Bildungsfahrten die Freiwilligkeit nicht gegeben ist bzw. nicht untersucht werden kann. Auch die Offenheit ist hier nicht in die Bewertung eingegangen, weil alle betrachteten Einrichtungen offene Angebote, d.h. unabhängig von sozialer Herkunft, Religionszugehörigkeit, Nationalität und Geschlecht anbieten.
Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Bewertung diejenigen Angebote für Jugendliche als besonders geeignet eingestuft, die folgende Zielsetzungen verfolgen:
die Förderung von Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Eigeninitiative u.a. durch partizipative Konzepte, bei denen eigene Vorstellungen eingebracht werden können;
den Zuwachs an sozialen Handlungskompetenzen wie Teamfähigkeit, Kooperation, Motivation, Konfliktfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit (z.B. durch Teamtraining, Gruppenarbeit, Rollenspiele) und auf Vertiefung der sozialen Bindung zu Gleichaltrigen;
die Auseinandersetzung mit Werten und Normen sowie dem eigenem Verhalten und eigenen Einstellungen;
die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung [wie Erwerb und Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenzen, die Individuation zu einer selbständigen, selbstverantwortlichen und selbstwirksamen, gesunden Persönlichkeit (Zufellato & Habiba Kreszmeier 2007, 118) (z.B. realistische Projekte mit sichtbarem Erfolg; Erlebnispädagogik; das Austesten von Grenzen und Risiken als Beitrag zum Erwerb von Selbständigkeit und Selbstsicherheit).
Aus diesem Grund haben Angebote aus dem erlebnispädagogischen Bereich, umsetzungsorientierte Projekte (z.B. Umweltbaustellen), Rollenspiele, Projektarbeit (vgl. Pfleger 2009) eine besondere Eignung. Umgekehrt haben vor diesem Hintergrund Vorträge, Filme, Führungen, Lehrpfade als alleiniges Angebot eine geringe Bedeutung im Hinblick auf die oben genannten Ziele.
5 Ergebnisse
5.1 Erreichbarkeit und Qualität der Beratung
Im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Einrichtungen kann den kontaktierten Umweltbildungsstellen ein „gutes Zeugnis“ ausgestellt werden. Von 106 angerufenen Bildungseinrichtungen waren 68 % bereits beim ersten Versuch erreichbar, weitere 25 % beim zweiten bis fünften Versuch. Nur 7 % mussten aufgrund mangelhafter Erreichbarkeit ausgeschlossen werden. Darüber hinaus waren 87 % der telefonischen Ansprechpartner bei den Bildungseinrichtungen freundlich und aufgeschlossen. Mehr als 67 % nahmen sich auch mehr als zehn Minuten Zeit für die Beratung.
Im Hinblick auf die Qualität der Auskunft zeigt sich Verbesserungspotenzial, da nur ein Drittel (36 %) der „hohen Qualität“ zugeordnet werden konnte. Knapp 50 % der Auskünfte zu den Programmen hatten eine „mittlere Qualität“. Rund 15 % konnten keine näheren Angaben machen.
Das Vorhandensein von Angeboten für Jugendliche bezieht sich auf die Selbsteinschätzung durch die Bildungseinrichtung beim Anruf. Wie Abb. 1 zeigt, können 29 % der befragten Einrichtungen kein Angebot für Jugendliche anbieten, 2 % davon würden gerne etwas für diese Zielgruppe machen, bräuchten aber Ideen für ein Konzept. Immerhin 50 % geben an, mindestens eine passende Veranstaltung im Programm zu führen. Insgesamt 9 % der Einrichtungen haben kein Angebot für Jugendliche im Programm, würden aber auf Wunsch eines erstellen.
Es ist demnach bei 58 von 99 Einrichtungen (d.h. 59 %) möglich, mit Jugendlichen eine Umweltbildungsveranstaltung zu besuchen. Bemerkenswert ist, dass viele Institutionen, die kein Angebot für Jugendliche im Programm führen, laut Profilbeschreibung auch diese Zielgruppe grundsätzlich berücksichtigen wollen. Von 54 Einrichtungen, die das Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ tragen, bieten erstaunlicherweise auch knapp 40 % keine Angebote für Jugendliche an, weitere 5 % konnten nicht erreicht werden.
Von den 58 Einrichtungen, die im Telefonat angaben, ein entsprechendes Angebot zu führen bzw. zu erstellen, sandten 33 Einrichtungen (57 %) Informationsmaterial zu, 19 (33 %) verwiesen auf Informationen im Internet, vier (7 %) gaben an, kein Informationsmaterial anbieten zu können und zwei Einrichtungen (3 %) sandten das Material nicht zu, obwohl sie es telefonisch zugesagt hatten.
Von 52 Einrichtungen standen Informationsmaterialien zur Auswertung zur Verfügung. Zwei davon führten kein Angebot im Programm, womit letztendlich das Angebot von 50 Einrichtungen zur Auswertung blieb.
5.2 Struktur und Inhalte der Angebote für Jugendliche
Von den 50 Einrichtungen, die über Angebote für Jugendliche verfügen, werden insgesamt 414 verschiedene Angebote für diese Zielgruppe bereitgehalten.
Im Hinblick auf die Dauer der Angebote dominieren halbtägige bis ganztägige Angebote. Nur 22 % sind Mehrtagesprogramme.
Jeweils 27 Einrichtungen (54 %) arbeiten mit den Vermittlungstypen Projektarbeit, Workshop bzw. Gruppenlernen und mit naturerlebnisorientierten Elementen (d.h. persönlicher Erfahrung von Natur) (Abb. 2). Erlebnispädagogische Methoden, die eher auf die persönliche Herausforderung fokussiert sind, wenden 26 Einrichtungen (52 %) an, Forschungstätigkeiten, Untersuchungen oder Experimente 25 (50 %), Führungen im klassischen Stil, Exkursionen mit Vortrag ohne erwähnenswerte Beteiligung der Teilnehmer und den Besuch eines Lehrpfads bieten 16 Einrichtungen (32 %) an. 15 Veranstalter (30 %) arbeiten mit interaktiven Ausstellungen, Rallyes und Lernparcours. Umsetzungsorientierte Projekte (Umweltbaustellen zählen hierbei zu diesen Projekten mit „Ernstcharakter“, da Aufforstungen oder Sanierungen von Landschaftsschäden wesentlicher Teil des Programms sind) bieten 13 Institutionen (26 %). Vorträge, Referate, Filmvorführungen oder Ausstellungen (nicht interaktiv) sind bei fünf (10 %) und Rollen- bzw. Planspiele nur bei drei Veranstaltern (6 %) im Angebot.
Wie bei Umweltbildungseinrichtungen zu erwarten, ist das Thema Naturlebensräume, Pflanzen und Tiere bei 41 von 50 Einrichtungen (82 %) Spitzenreiter, gefolgt von künstlerischen oder handwerklichen Aktionen, die gut die Hälfte mit 26 Einrichtungen (52 %) anbieten (Abb. 3). Natur, wie z.B. beim Wandern oder Klettern, als „Kulisse“ erleben, kann man bei 21 Veranstaltern (42 %) und 17 (34 %) haben Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit (Lebensstile, Energie, Müll/Recycling, Klima, Ressourcen) im Angebot. Ernährung und Gesundheit thematisieren 14 Institutionen (28 %), Boden/Geologie sowie Sozialkompetenz, Teamtraining und Persönlichkeitsentwicklung jeweils 13 (26 %). Zwölf Einrichtungen (24 %) führen Veranstaltungen zum Thema Orientierung mit Kompass/Karte oder GPS, elf (22 %) vermitteln naturnahes Leben oder Leben in der Wildnis, neun Einrichtungen (18 %) arbeiten mit den Themen Naturschutz/Landschaftspflege und acht (16 %) gehen durch Mikroskopieren auf die Details der Natur ein. Angebote rund um die Musik bieten fünf Veranstalter (10 %) an, Technik/Bionik/GIS drei (6 %), Naturkosmetik zwei (4 %) und Astronomie eine Einrichtung (2 %).
Das eingesetzte Personal ist qualifiziert und setzt sich zu jeweils einem Drittel aus ausgebildeten Pädagogen (insbesondere Sozial-, Umwelt-, Erlebnispädagogen) und naturwissenschaftlich ausgebildeten Personen (Naturwissenschaftler, Förster, Mitarbeiter des Naturparks, Nationalparkführer, Ranger) zusammen (jeweils 34 %). Betreuung durch Praktikanten oder Teilnehmer am freiwilligen, ökologischen Jahr erfolgt nur in 6 % der Fälle. Sonstige Referenten und Honorarkräfte umfassen 18 %. Keine Angaben liegen für 8 % vor.
5.3 Bewertung der Angebote für Jugendliche
Insgesamt wurden 414 Angebote entsprechend den eingangs dargestellten Kriterien bewertet. Die nachstehenden Prozentangaben beziehen sich auf diese Anzahl.
Wie eingangs dargestellt, sollen Angebote für Jugendliche einen Bezug zu den Themen und Interessen der Jugendlichen aufweisen. Hier ergab sich, dass knapp zwei Drittel der Angebote dieses nicht leisten (243 Angebote, 59 %). Nur ein knappes Drittel kann diesen Anspruch erfüllen. Die restlichen 11 % enthalten immerhin Bezug zu Alltagsthemen. Geeignete Programme sind z.B. solche mit starker sozialer Komponente oder Angebote, die beim Interesse für neue Medien und GPS anknüpfen.
Im Hinblick auf das Kriterium der Selbständigkeit, Selbst- und Mitbestimmung ergab sich ein positiveres Bild. Immerhin werden bei rund zwei Drittel aller Veranstaltungen die Teilnehmer weitgehend mit einbezogen. Nur bei 12 % der Angebote (wie bei Vorträgen, Führungen oder Ausstellungen) haben die Teilnehmer keine Gelegenheit, selbst aktiv zu werden oder über die Veranstaltung mitzubestimmen. Bei einem Viertel ist nur teilweise eine Beteiligung vorgesehen.
Im Hinblick auf die Förderung sozialer Kompetenzen als weiteres wichtiges Ziel der Umweltbildung für Jugendliche zeigt sich, dass nur wenige Angebote diesen Anspruch voll erfüllen. Hier tragen rund zwei Drittel nicht oder nur unwesentlich zur Förderung sozialer Kompetenzen bei. 18 % der Angebote können dieses Erfordernis erfüllen (75 Angebote). Dieses sind vor allem die Veranstaltungen, die spezielle Kooperations- und Kommunikationstraining-Programme integrieren. Weitere 63 Angebote (15 %) kommen diesem Auftrag z.B. durch intensive Gruppenarbeit weitgehend nach. Hier werden die sozialen Kompetenzen im Gegensatz zu den speziellen Teamtrainings begleitend vermittelt.
Eine Auseinandersetzung mit Werten, Normen und dem eigenen Verhalten soll ebenfalls durch geeignete Angebote für die Umweltbildung für Jugendliche gefördert werden. Hier zeigt die Auswertung, dass diese Ausrichtung eher zu den Ausnahmen gehört. Nur 59 Veranstaltungsangebote (14 %) fordern aktiv eine Auseinandersetzung heraus, zeigen Handlungsalternativen auf oder lassen diese von den Teilnehmern erarbeiten. Bei weiteren 51 Veranstaltungen (13 %) setzen sich die Teilnehmer aktiv mit Werten, Normen und ihrem eigenen Verhalten auseinander, indem sie alternative Handlungsweisen einüben oder sich aktiv damit beschäftigen. Hier sind die Umweltbaustellen, aber auch Rollenspiele, die Verhaltensoptionen veranschaulichen, beispielhafte Angebote.
Insgesamt können 27 % der Angebote diesem Anspruch ganz oder teilweise gerecht werden. 64 % ermöglichen die Auseinandersetzung mit Werten und Normen und dem eigenen Verhalten nicht, 9 % nur sehr eingeschränkt.
Ein ähnlich kritisches Bild ergibt sich bezogen auf die gewünschte Förderung der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung. Über die Hälfte der Veranstaltungen (226) trägt nicht zur Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher bei. 69 Veranstaltungen (17 %) sind dafür kaum geeignet oder können allenfalls einen geringen Beitrag leisten. In 29 Veranstaltungen (7 %) werden die Entwicklung von Identität und Persönlichkeit gefördert, 90 Veranstaltungen (22 %) leisten hierzu einen besonderen Beitrag. Voraussetzung ist hier, dass die Jugendlichen sich bzw. ihre Fähigkeiten darstellen können und nicht passiv „Umweltbildung konsumieren“.
Die zusammenfassende Bewertung aller Angebote, unter dem Blickwinkel ihrer Eignung für Jugendliche nach den eingangs vorgestellten Kriterien, spiegelt die bereits genannten Kritikpunkte wider (Abb. 4).
Werden die in der Literatur als unabdingbar formulierten Anforderungen, wie das „Anknüpfen an Interessen Jugendlicher“, die „Förderung von Eigenaktivität, Beteiligung oder Mitbestimmung“, der „Beitrag zur Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung“, die „Förderung sozialer Handlungskompetenzen“ sowie die „Auseinandersetzung mit Werten, Normen und eigenem Verhalten“, gemeinsam abgefragt, dann zeigt sich, dass von den 414 Angeboten in Bayern für Jugendliche über die Hälfte der angebotenen Programme (224 Angebote), eigentlich nicht für Jugendliche geeignet sind. Weitere 10 % (d.h. 42 Angebote) sind nur bedingt geeignet. Das bedeutet, dass nur 148 Veranstaltungen den Anforderungen aus wissenschaftlicher und pädagogischer Sicht genügen. Davon sind 44 Veranstaltungen (11 %) für Jugendliche geeignet und ein Viertel des Gesamtangebotes (104 Veranstaltungen) für Jugendliche sehr gut geeignet.
Die Einrichtungen mit dem Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ wurden abschließend gesondert betrachtet. Dabei zeigte sich, dass bei diesen 170 Veranstaltungen ebenfalls mehr als die Hälfte nicht speziell für Jugendliche geeignet waren. Weitere 26 (9 %) sind nur bedingt geeignet. 40 Angebote (13 %) werden als geeignet bewertet und 68 (22 %) als sehr geeignet. Diese zusätzliche Auswertung zeigt, dass die vorgelegte Problemstellung sich auch bei den besonders qualifizierten Anbietern wieder findet.
6 Diskussion
Die Ergebnisse sind eindeutig: Ein spezifisches Programm für Jugendliche, ausgerichtet an ihren Bedürfnissen und ihrer Lebenssituation, ist eher selten und mehr als die Hälfte der Angebote eher ungeeignet, also z.B. eher ein Kinderprogramm oder eines für Erwachsene. Abschließend soll daher diskutiert werden, welche Konsequenzen aus diesen Ergebnissen gezogen werden könnten:
Service bei Buchung und Beratung verbessern
Zunächst könnte man die Ergebnisse als Aufruf zur Qualitäts- und Serviceverbesserung verstehen. Abgesehen von den Inhalten zeigte der eingangs dargestellte Mystery-check bereits zahlreiche Defizite bei der Buchung. Die Qualität der Auskunft im Vorfeld ließe sich ebenso verbessern wie die Vorinformationen durch geeignete Materialien.
spezifische Angebote schaffen
Die Ergebnisse könnten weiterhin neue Anhaltspunkte für die Vergabe und Kontrolle des Qualitätssiegels „Umweltbildung.Bayern“ liefern. Immerhin hatten von 54 Einrichtungen, die dieses Qualitätssiegel tragen, knapp 40 % keine Angebote für Jugendliche im Programm, weitere 5 % konnten nach mehr als fünf Anrufversuchen nicht erreicht werden und mehr als die Hälfte der vorhandenen Angebote dieser besonders qualifizierten Einrichtungen für die Jugendlichen erfüllte die Eignungskriterien nicht.
Qualität bestehender Angebote sichern und verbessern
Qualitätsverbesserung ist in diesem Fall nicht einfach. Die Jugendlichen benötigen nicht nur, wie Brämer (2006) fordert, mehr Freiraum zum Selbstentdecken der Natur und weniger bevormundende Veranstaltungen, sondern auch Bezug zur eigenen Lebenswelt, die Chance, soziale Kompetenz zu erlernen, und bezogen auf die Umwelt konkrete Handlungsoptionen, die etwas beeinflussen und Erfolg sichtbar werden lassen. Ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang auch gesellschaftspolitische Aspekte. Es kommt also darauf an, Angebote zu entwickeln, die es erlauben, in der Gruppe Natur aktiv zu erleben, Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und dabei auch ein stückweit auf sich selbst gestellt zu sein bzw. selbst zu gestalten. Dabei sind auch neue Wege zu gehen. Umweltbildung in Verbindung mit Geo-caching, Citizen science (oder einfacher ausgedrückt Laienmonitoring mit Apps zur Erkennung von Arten), Natursport mit Rollenspielen zum Anlagenbau, ein Energy-camp mit Solarkochen zur Selbstversorgung sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie dieser Herausforderung konkret begegnet wird bzw. werden könnte.
Umweltbildung für Jugendliche – aussteigen oder aktiv werden?
Betrachtet man die einschlägige Literatur, dann ließe sich das Thema auch noch grundsätzlicher diskutieren. Wie dargestellt, ist das zentrale Thema der Jugendphase die eigene Identitätsfindung. Straten & Zinn (2006) sehen diese als Grundvoraussetzung für ein „Umwelt-Bewusst-Sein“ und plädieren dafür, dass die Identitätsfindung in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Umweltbildung kann sich ihrer Meinung nach „allenfalls daran versuchen, zu dieser Bewusstwerdung einen kleinen Beitrag zu leisten“; die Autoren sehen Grenzen in den Möglichkeiten der Umweltbildung.
Umweltbildung für Jugendliche ist schwierig, sie konkurriert mit der Identitätsfindung der gesellschaftlichen und sexuellen Entwicklung. Eine Reaktion auf die vorliegenden Ergebnisse könnte daher sein, in dieser Lebensphase auf Umweltbildungsangebote tendenziell zu verzichten, bevor die Angebote ungeeignet und demotivierend sind. Diesen Weg sind, wie die Studie ebenfalls zeigt, bereits viele Institutionen gegangen, indem sie keine Angebote im Programm haben.
Aus unserer Sicht sollten die Ergebnisse – übrigens nicht nur in Bayern – aber eher als Aufforderung verstanden werden, die angebotenen Programme kritisch zu überdenken. Umweltbildung für Jugendliche darf kein Ausnahmeangebot einiger weniger Einrichtungen sein oder werden. Umweltbildung für Jugendliche muss als eigenständige Aufgabe mit hoher gesellschaftlicher und politischer Relevanz gesehen werden. Über die bereits genannten Herausforderungen hinaus geht es hier auch um Wege aus dem Fatalismus, der Politikverdrossenheit und Verdrängungsstrategien, wie der Abgabe von Verantwortung an übergeordnete Instanzen. Dieses gilt umso mehr, als der Jugendliche nicht nur seine Identität sucht, sondern auch seine Rolle in der Gemeinschaft und der Gesellschaft finden muss. Hierzu kann Umweltbildung einen ganz entscheidenden Beitrag leisten.
Literatur
ANU Bayern (o.J.): Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung in Bayern. http://www.umweltbildung-in-bayern.de/Umweltbildung/position.html, Stand: 10.11.2007.
Atteslander, P., Bender, C., Cromm, J., Grabow, B., Zipp, G. (1991): Methoden der empirischen Sozialforschung. 6. Aufl. Walter de Gruyter, Berlin.
Barth, R. Garbely, K., Kieser, (2009): Mystery Shopping als Bewertungsmethodeder Dienstleistungsqualität von Bibliotheken. http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2009/651/pdf/Barth-Robert_Garbely-Karin_Kieser_Marita_5. 6.2009_Carl-Zeiss-Saal_09.00_Mystery_Shopping.pdf, gesehen am 10.1.2011, 14 S.
Beyer, I. (2010): Check-up Kliniken in NRW – ein Kosten- und Leistungsvergleich inklusive Mystery Studie „ Ausländische Patienten“. Grin Verlag, Norderstedt, 25 S.
Borfitz, D. (2001): Is a „Mystery Shopper“ Lurking in your Waiting Room? Medical Economics 78 (10), 63-70
Brämer, R. (2006): Natur obskur. Wie Jugendliche heute Natur erfahren. oekom, München.
Brickwedde, F., Bittner, A., Geissinger, K. (Hrsg., 2008): Aus der virtuellen Welt in die Natur. Wie kann Umweltbildung die Jugendlichen erreichen? 15. Pfingstsymposium der Freunde und Förderer des Zentrums für Umwelt und Kultur Benediktbeuern e.V.
BANU (Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Umwelt- und Naturschutz, 2003): Leitlinien zur Natur- und Umweltbildung für das 21. Jahrhundert. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Laufen/Salzach.
Deutscher Tourismusverband (2001): Touristische Angebotsgruppe „Deutsche Nationalparke“. Endbericht. Bonn, 200 S.
Gehrke, S. (2007): Umsetzung der Agenda 21 in der außerschulischen Jugendarbeit – am Beispiel von Umweltschutzprojekten der Weltverbände WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) & WOSM (World Organization of the Scout Movement) seit 1992. mensch & buch, Berlin.
Gensicke, T. (2006): Zeitgeist und Wertorientierungen. In: Shell Deutschland Holding, Hrsg., Jugend 2006, Eine pragmatische Generation unter Druck, Fischer, Frankfurt am Main, 169-202.
Giesel, K.D., Haan, G. de, Rode, H. (2002): Umweltbildung in Deutschland. Stand und Trends im außerschulischen Bereich. Springer, Berlin/Heidelberg.
Hartmann, K., Hodek, J.-M., Greiner, W., Flöttmann, A. (2008): Mystery Shopping in der Gesetzlichen Krankenversicherung – Einsatz von Testkäufern zur Qualitätssicherung. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 97 (2), 124-143.
Höhner, J., Schaper, C. (2004): Vom Kundenfrust zur Kundenlust. Mystery Research als Instrument zur Messung der Servicequalität am Point-of-Sale. Planung & Analyse 31,
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


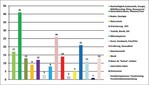
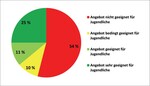
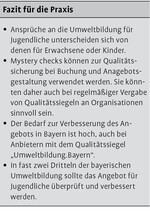
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.