Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen Betrachtungen in Theorie und Praxis
Abstracts
Aufgrund der bislang fehlenden Legaldefinition drängt es sich auf, eine naturschutzfachliche Konkretisierung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten anhand der Bedeutung und Funktion bestimmter Habitate für das Paarungs-/Fortpflanzungsverhalten oder als Rast-/Ruhebereich für Tierarten vorzunehmen. Dieses erfolgt vor dem Hintergrund, dass bereits die faunistische Erhebung und Auswertung durch die „Brille“ der Rechtsnorm zielgerichtet stattfinden muss, um letztendlich bei der Genehmigung von Vorhaben auftretende Fragen naturschutzfachlich adäquat beantworten zu können.
Dieser Beitrag stellt beispielhaft die rechtliche Situation, die faunistischen Kartiermöglichkeiten und die sich daraus ergebenden naturschutzfachlichen Konsequenzen dar. Aus dieser Gegenüberstellung ergeben sich Differenzen, für die Lösungen vorgeschlagen werden. Hierzu wird in diesem ersten Teil des Beitrags für Vögel naturschutzfachlich anhand der artengruppenspezifisch abweichenden Besonderheiten der Rechtsbegriff der Fortpflanzungsstätte und der Ruhestätte ausgefüllt sowie beispielhaft anhand ausgewählter Arten die für diese Arten fachlich übliche Methode der Erfassung dargestellt. Für diese Beispielarten wird der nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG rechtlich zu prüfende Begriff der „Beschädigung/Zerstörung“ durch Funktionsverlust naturschutzfachlich ausgefüllt und diskutiert. Dieses erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der letzten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes.
Breeding Sites and Resting Places in Theory and Practice of Species Protection. Legal Base, Annotations and Suggestions – Part I: Birds
So far there has not been a legal definition for breeding sites and resting places in the context of species protection. From a nature conservation point of view the study intends to substantiate these terms using the importance and function of certain habitats for the mating/ reproduction and for the resting of animal species. In this context, the faunistic inventories and analyses have already to consider legal definitions in order to provide adequate answers for questions arising during approval procedure.
Using examples the study describes the legal situation, the options for the collection of faunistic data and the resulting valuation from a nature conservation point of view.
In this first part the paper uses the example of birds and illustrates the specific characteristics of breeding sites and resting places. It also presents the common method of detecting the bird species.
The process of derogation will be necessary if the continuous ecological functionality of the site might be affected adversely. For these examples the term “deterioration” of breeding sites and resting places is discussed and defined, particularly in view of the last decisions of the Federal Administrative Court.
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
Die ständige Weiterentwicklung des Naturschutzrechts durch Gesetze und Rechtsprechung stellt nicht nur Juristen häufig vor neue Fragestellungen. Ein Beispiel hierfür bildet das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot des §44 Abs.1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wonach es untersagt ist, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu zerstören. Die Aussageinhalte der gutachterlichen Fachbeiträge müssen dieser Entwicklung ständig angepasst werden. Die Methoden der Kartierung bleiben jedoch annähernd unverändert. Juristische Anforderungen und naturschutzfachliche Beurteilungsmaßstäbe werden in diesem Beitrag dargestellt und Lösungsmöglichkeiten für die Praxis angeboten.
2 Begriff, Abgrenzung und Prüfstufen der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
2.1 Vorbemerkung
Eine Definition, was genau unter den Begriff der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte fällt, findet sich weder in den nationalen Vorschriften noch in den ursprünglichen Regelungen der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie. Hieraus ergibt sich das erste große Problem: Kommt es bei der Bestimmung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte auf einen lokal fest bestimmbaren Punkt an (Nest, Baum etc.) oder fällt auch das Umfeld, das für eine erfolgreiche Arterhaltung erforderlich ist, unter diesen Begriff?
Nach der Konkretisierung des §44 Abs. 3 BNatSchG durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hat die Prüfung dieses Verbotstatbestandes bei nach §15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft zweistufig zu erfolgen (siehe BVerwG 9A 39/07, Urteil vom 18.03.2009, Rn. 65, A44 Ratingen – Velbert). Auf der ersten Stufe ist zu überprüfen, ob eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der besonders oder streng geschützten Arten innerhalb des relevanten Untersuchungsraumes liegt und durch das Vorhaben beschädigt oder zerstört wird. Erst auf der zweiten Stufe, im Rahmen des § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG, muss geklärt werden, ob die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin erfüllt wird.
2.2 Definition und Abgrenzung
Innerhalb der EU-Richtlinien und Leitfäden, die diesen zweistufigen Prüfungsaufbau nicht kennen, ist ersichtlich, dass die Kommission von einem funktionsbezogenen Verständnis des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeht, wobei artspezifischen Ansprüchen und Verhaltensweisen Rechnung getragen werden soll. Erklärtes Ziel ist es, die ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. So benennt der EU-Leitfaden (Europäische Kommission 2007) zum strengen Schutzsystem als Beispiel für mögliche Fortpflanzungsstätten Bereiche, die für die Balz, die Paarung, den Nestbau, den Ort der Eiablage und -entwicklung oder die Nachwuchspflege benötigt werden (EU-Leitfaden zum strengen Schutzsystem, II.3.4b Rn. 58). Als Beispiele für Ruhestätten werden Bereiche benannt, die für das Überleben eines Tieres oder einer Gruppe von Tieren während einer nicht aktiven Phase (z.B. Schlaf, Versteck, Mauser, Überwinterung) erforderlich sind (EU-Leitfaden zum strengen Schutzsystem, II.3.4b Rn. 59). Würde man dieser weiten Auslegung des Begriffes folgen, wäre die ökologische Funktion bereits bei der Bestimmung, ob eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte vorliegt und durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, zu berücksichtigen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in den letzten Jahren versucht, den weitläufigen Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu konkretisieren und räumlich zu begrenzen. So soll der Schutz des Verbotstatbestandes nicht dem gesamten Lebensraum der geschützten Art zuteilwerden, sondern nur selektiv den ausdrücklich bezeichneten Lebensstätten, die durch bestimmte Funktionen für die jeweilige Art geprägt sind (z.B. Nest, Höhle) (siehe BVerwG 9 A 73/07, Urteil vom 13.05.2009, Rn. 90, A 4 Kerpen – Düren). Diese enge räumliche Begrenzung des Begriffs der Lebensstätte ist nach Ansicht des Gerichtes, trotz abweichender Auslegung im genannten EU-Leitfaden, auch EU-rechtskonform, da der funktionsbezogenen Zielrichtung des Schutzes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Bundesnaturschutzgesetz durch die Ergänzung der Verbotstatbestände in §44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG Rechnung getragen werde (vergleiche: BVerwG 9 A 39/07, Urteil vom 18.03.2009, Rn. 67 ff., A 44 Ratingen – Velbert). Das deutsche Recht hat also für die Berücksichtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte mit §44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG eine eigenständige Regelung getroffen. Die Folge hieraus ist, dass die Erhaltung der Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte erst auf der zweiten Prüfungsstufe erfolgen darf. Diese Vorgehensweise wurde bei allen dem Bundesverwaltungsgericht bislang vorgelegenen Fällen immer bestätigt.
Sachverständige haben bei dieser juristisch geforderten engen Auslegung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte in der Regel Schwierigkeiten, den Ort der Fortpflanzungs- und Ruhestätte punktgenau festzulegen (Verhältnismäßigkeit des Kartieraufwandes, Möglichkeiten der Kartiermethoden) und alle im Umfeld für die Erfüllung der Funktion als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte biologisch notwendigen Parameter unberücksichtigt zu lassen. Dieses wird im vorliegenden Beitrag bei der Darstellung der Kartiermethoden näher erläutert.
2.3 Prüfstufen
Die für Vorhabenträger tätigen Sachverständigen sollten sich bei ihrer Bewertung an dem von den Gerichten verfolgten zweistufigen Prüfungsmodell orientieren. Es verbleibt im Rahmen dieses Prüfungsmodells noch ein gewisser gutachterlicher Einschätzungsspielraum.
Stufe 1: Wird durch das Vorhaben eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört (§44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)? Bestimmung und Untersuchungsaufwand
Die Frage, ob im konkreten Fall eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vorliegt, stellt nach Aussage der Rechtsprechung in erster Linie eine naturschutzfachliche Frage dar, die je nach den Verhaltensweisen der Arten unterschiedlich beurteilt werden kann (siehe BVerwG 9 A 73/07, Urteil vom 13.05.2009, Rn. 91, A 4 Kerpen – Düren). Dieses ist der Anknüpfungspunkt für den gutachterlichen Einschätzungsspielraum.
An diesem Punkt stehen die Sachverständigen häufig vor der ersten Problematik: Wie werden Rechtsnormen und ihre gerichtliche Auslegung in naturschutzfachliche und naturwissenschaftliche Begrifflichkeiten übersetzt? Wie müssen die notwendigen Untersuchungen ausgestaltet bzw. durchgeführt werden, um die Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer besonders geschützten Art bestimmen und lokalisieren zu können?
Gleichzeitig soll auch der Zeit- und Kostenaufwand in einem für den Vorhabenträger vertretbaren Rahmen gehalten und so dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genüge getan werden. Die Grenze der Verhältnismäßigkeit zu ziehen, obliegt dem Vorhabensträger, der sich bei seiner Einschätzung aber häufig an der Aussage des von ihm beauftragten Sachverständigen orientiert.
Erforderlich, aber auch ausreichend ist nach Aussage des Bundesverwaltungsgerichts eine am Maßstab praktischer Vernunft ausgerichtete Prüfung, wobei Art und Umfang, Methode und Untersuchungstiefe maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten des Einzelfalls abhängen sollen (siehe BVerwG 9 A 14/07, Urteil vom 09.07.2008, Rn. 57, 59, Bad Oeynhausen). Regelmäßig sollen sie sich aber aus zwei wesentlichen Quellen speisen: Der Bestandserfassung vor Ort sowie der Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse und Fachliteratur, die sich wechselseitig ergänzen können (siehe BVerwG 9 A 14/07, Urteil vom 09.07.2008, Rn. 59, Bad Oeynhausen). So ist es bei entsprechender naturschutzfachlich begründeter Darlegung auch zulässig, aus allgemeinen Erkenntnissen zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprüchen und dafür erforderlichen Vegetationsstrukturen hinreichend sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bestimmter Arten vorzunehmen. Die Arbeit mit Hilfsmitteln wie Prognosewahrscheinlichkeiten, Schätzungen und in Fällen verbleibender Erkenntnislücken einer „worst-case-Betrachtung“ ist ebenfalls anerkannt und rechtlich zulässig (siehe hierzu genauer BVerwG 9A 14/07, Urteil vom 09.07.2008, Rn. 63, Bad Oeynhausen).
Durch das Zusammenspiel dieser genannten Möglichkeiten sollte im Ergebnis der Sachverständige nachvollziehbar und gemäß naturschutzfachlicher Standards hinreichend begründet bestimmen, ob eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte beschädigt oder zerstört wird.
Stufe 2: Erhaltung der ökologischen Funktion der Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang (§44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG)
Ist eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte betroffen, muss in einer zweiten Stufe überprüft werden, welche Auswirkungen das auf die ökologische Funktion der Lebensstätte für die sie nutzenden Tiere hat (siehe BVerwG 9 A 39/07, Urteil vom 18.03.2009, Rn. 65, A 44 Ratingen – Velbert). Wird die Funktion der Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt, liegt gemäß §44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG ein Verstoß gegen das Verbot des §44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG nicht vor. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden, §44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG, um die Verwirklichung des Tatbestandes zu verhindern.
Funktionserhalt
Nach Aussage des Bundesverwaltungsgerichts ist ein voller Funktionserhalt, wie ihn §44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG voraussetzt, nicht schon dann gegeben, wenn der Eingriff keine messbaren Auswirkungen auf die Reproduktionsbedingungen bzw. Rückzugsmöglichkeiten der lokalen Population als Ganzer hat, sondern erst dann, wenn für die mit ihren konkreten Lebensstätten betroffenen Exemplare einer Art die von der Lebensstätte wahrgenommene Funktion vollständig erhalten bleibt, also z.B. dem in einem Brutrevier ansässigen Vogelpaar weitere geeignete Nistplätze in seinem Revier zur Verfügung stehen oder durch Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen Bruch bereitgestellt werden (siehe BVerwG 9 A 39/07, Urteil vom 18.03.2009, Rn. 67, A 44 Ratingen – Velbert).
Räumlicher Zusammenhang
Der Fokus ist bei der Bewertung des Funktionserhalts auf die konkreten Individuen, deren Fortpflanzungs- und Ruhestätte beeinträchtigt werden, zu richten. Nur wenn sie im räumlichen Zusammenhang weiterhin ausreichend Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorfinden, kann der Verbotstatbestand verneint werden.
Bei der Festlegung des räumlichen Zusammenhanges ist von den Sachverständigen in der Regel eine populationsökologische Bewertung gefordert. Dabei ist zu beachten, dass der räumliche Zusammenhang nicht zwingend mit der Ausbreitung der lokalen Population, deren Bestimmung für §44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG gefordert wird, übereinstimmen muss.
Hier ergibt sich eine weitere Schwierigkeit: Die räumliche Ausdehnung der faunistischen Erhebungen orientieren sich üblicherweise an dem Eingriffsstandort (z.B. Straßentrasse mit nahem Umfeld). Daher liegen meist keine Kartierergebnisse über die Existenz von Arten bzw. den Grad der noch freien Fortpflanzungs- und Ruhestätten im ggf. darüber hinaus gehenden räumlichen Zusammenhang vor. Dieses muss dann gutachterlich abgeschätzt werden.
Bei der Bewertung des Erhalts der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt werden. Diese bestehen oftmals in einer Aufwertung bereits vorhandener oder Neuanlage geeigneter Habitatflächen. In diesen Fällen ist von einem Erhalt der Funktion dann zu sprechen, wenn die Maßnahmenfläche entsprechend dem artspezifischen Aktionsradius für die betroffene Art erreichbar ist (so Kratsch in Schumacher & Fischer-Hüftle, §44 Rn.73). Im Regelfall nicht ausreichend ist, dass potenziell geeignete Ersatzlebensräume außerhalb des Vorhabengebietes vorhanden sind (keine Aufwertung oder Neuanlage), da davon auszugehen ist, dass diese schon von der betreffenden Art genutzt werden und ohne gezielte Aufwertungsmaßnahmen keine höhere Siedlungsdichte zu erreichen ist (Kratsch in Schumacher & Fischer-Hüftle, §44 Rn.70).
Kommt der Sachverständige anhand der oben genannten Kriterien zu dem Ergebnis, dass die ökologische Funktion der durch das Vorhaben beschädigten oder zerstörten Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, kann er im Ergebnis die Verwirklichung des §44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG verneinen.
Im Folgenden wird beispielhaft für die Vögel, insbesondere für Kiebitz (Vanellus vanellus) und Schwarzstorch (Ciconia nigra), Fortpflanzungs- und Ruhestätte, deren Erfassung und deren mögliche Beeinträchtigung dargestellt und auf den naturschutzfachlich abzuleitenden räumlichen Zusammenhang eingegangen.
3 Beispielhafte Betrachtung der Vögel
3.1 Hintergründe
Das BNatSchG hat bereits in seiner Änderung aus dem Jahre 2007 den Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte in den Verbotstatbestand (damals §42 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) aufgenommen, wobei sich der Gesetzgeber enger an den Wortlaut des Artikels 12 der FFH-Richtlinie angelehnt hat. Diese verbietet jede Beschädigung oder Vernichtung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der nach Anhang IV geschützten Arten. Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie sollte von der Regelung des Verbotstatbestandes mit abgedeckt werden, obwohl dieser konkret nur von der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfernung von Nestern spricht. Die Vogelschutzrichtlinie selbst geht damit von einem räumlich stärker begrenzten Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte aus als die FFH-Richtlinie, wohingegen der Gesetzgeber in seiner Formulierung des Verbotstatbestandes den weitergehenden Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte gewählt hat. In seiner Begründung zur Änderung des BNatSchG 2007 (BT-DRS. 16/5100) geht er davon aus, dass unter den Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte auch die in Artikel 5 Vogelschutzrichtlinie erwähnten „Nester“ zu fassen seien.
Erkennbar ist also das Ziel, für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie eine einheitliche Regelung zu finden. Es ist jedoch nicht eindeutig, ob sich aus der Herkunft der gesetzlichen Regelung aus Artikel 5 Vogelschutzrichtlinie ableiten lässt, dass sich die Fortpflanzungsstätte bei Vögeln allein auf das Nest beschränken soll, oder ob der Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner Möglichkeiten diese Formulierung so gewählt hat, um die Vorgaben der EU-Regelung strenger zu fassen und auch der Funktionalität des Nestes eine eigene Bedeutung einzuräumen. Dieses hätte zur Folge, dass bei Vogelarten, deren Fortpflanzungsgeschehen sich nicht allein auf das Nest beschränken lässt, auch die um das Nest befindliche Umgebung, soweit sie für die Fortpflanzung erforderlich ist, in den Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte einzubeziehen wäre. Gleiches würde gelten, wenn ein Nest erst dann seine Nestfunktion erfüllen kann, wenn es sich in einer bestimmten Umgebung befindet. Die oben bereits erwähnte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hat diesen Ansatz bislang aber nicht verfolgt, sondern auch für unterschiedliche Vogelarten zu einer eher räumlich eng begrenzten Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- und Ruhestätte tendiert und für deren Definition meist auf das Nest zurückgegriffen. Diese Vereinfachung erscheint aus naturschutzfachlicher Sicht bei der Vielzahl der unterschiedlichen Verhaltensweisen der Vogelarten besonders schwierig.
Bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung sind grundsätzlich alle wildlebenden europäischen Vogelarten (im Raum der EU mehr als 500 Brutvogelarten, Burfield & van Bommel 2004) mit unterschiedlichster Verhaltensökologie und unterschiedlichster Habitat- und Raumnutzung zu betrachten. Zudem handelt es sich bei Vögeln um Arten, die eine sehr starke Dynamik in ihrem räumlichen und zeitlichen Auftreten zeigen. Pauschale Aussagen oder Richtwerte sind damit für diese Tiergruppe nicht möglich, was sich alleine schon bei der Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte zeigt.
So ist beispielsweise bei der Betrachtung des räumlichen Zusammenhangs im Rahmen des §44 Abs. 4 S. 2 BNatSchG im Hinblick auf die ausgeprägte Mobilität sowie dem ausgeprägten Zugverhalten bei vielen Arten, aber auch dem Dismigrationsverhalten von Standvogelarten (Berthold 2012, Gatter 2000), davon auszugehen, dass im mitteleuropäischen Raum ein „räumlicher Zusammenhang“ auch über größere Entfernungen gewährleistet sein kann. Dieses muss jedoch art- und situationsspezifisch betrachtet und begründet werden.
Die folgenden Darstellungen zu den Vögeln besitzen daher in erster Linie exemplarischen Charakter. Sie können und sollen darüber hinaus jedoch ebenfalls als Grundlage dienen, welche fachlichen Rahmenbedingungen bei Vögeln im Rahmen artenschutzrechtlicher Betrachtungen in Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu Grunde zu legen sind.
3.2 Fachliche Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bei Vögeln
Bei der Beschreibung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte muss bei Vögeln aufgrund der im Regelfall stark ausgeprägten räumlichen Dynamik grundsätzlich zwischen der Fortpflanzungsstätte und der Ruhestätte unterschieden werden.
Naturschutzfachlich ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte grundsätzlich nicht alleine durch eine „räumliche Komponente“ zu beschreiben, sondern letztlich auch über ihre Funktion (in diesem Falle „Fortpflanzung“, „Ruhen“) zu definieren, die erfolgreich gewährleistet sein muss (Cody 1985, Tischler 1984).
Die Ruhestätte ist dabei einerseits durch ihre Struktur selbst inklusive des dazu gehörigen strukturellen Umfeldes gekennzeichnet (z.B. Schlafbäume, Kirchtürme, Schlafplätze, Rastplätze und -gewässer). Ihre Funktion erfüllt eine Ruhestätte jedoch erst durch eine regelmäßige und kontinuierliche Nutzung der Arten über längere Zeiträume hinweg. Sporadisch oder kurzfristig genutzte Rast- oder Ruheplätze fallen nicht hierunter.
Als Fortpflanzungsstätte gilt in erster Linie der Bereich der Neststandorte, Brutplätze oder Brutkolonien, darüber hinaus aber aus naturschutzfachlicher Sicht eigentlich auch regelmäßig genutzte Balzplätze, Paarungsgebiete etc., und somit bestimmte Strukturen, soweit diese für die Fortpflanzung unabdingbar und damit für die Funktion der Fortpflanzungsstätte notwendig sind. Denn nur dort, wo Fortpflanzung funktionieren kann, befindet sich auch eine Fortpflanzungsstätte.
Da in diesem Zusammenhang häufig unterschiedliche Begriffe benutzt werden, werden die relevanten und naturschutzfachlich eingeführten Begriffe vorab gemäß ornithologischer Standardwerke (Bergmann 1987, Bezzel & Prinzinger 1990, Schildmacher 1982) definiert:
Nest: eigentliche vom Vogel erbaute Struktur, in der die Eier gelegt und ausbrütet werden.
Niststätte: Struktur, in oder auf die das Nest gebaut wird (z.B. Baum, Busch, Bodensenke, Röhricht- oder Staudenhalme).
Revier: von der Vogelart mehrjährig genutzter, aktiv und regelmäßig verteidigter Bereich. Kann in „Brutrevier“ und „Nahrungsrevier“ unterteilt sein. Ein „Nahrungsrevier“ gilt jedoch nur dann im engeren Sinne als zum „Revier“ gehörig“, wenn es regelmäßig verteidigt wird. Ist das nicht der Fall, handelt es sich um den Nahrungs- oder Jagdraum, der von mehreren Paaren genutzt werden kann. Im Hinblick auf die Fortpflanzung ist nur das „Brutrevier“ von Belang.
Revierzentrum: Zentrum des Reviers, im Regelfall Bereich um das Nest.
Fortpflanzungsstätte: Strukturen und Bereiche, die eine direkte und unverzichtbare funktionale Bedeutung für die Fortpflanzung des Vogels haben.
Habitat: allgemein Raum, in dem das Tier lebt. Zwar auch räumlich abzugrenzender, letztlich aber funktional zu betrachtender Bereich des von der Art genutzten Lebensraumes bzw. der Lebensraumkomponenten. Kann in räumliche bzw. funktionale Teilhabitate getrennt werden, vor allem das Nahrungshabitat und das Nisthabitat.
Während bei Brutvögeln bei jeder Art grundsätzlich mit einem Vorkommen von Fortpflanzungsstätten im Untersuchungsraum zu rechnen ist, sind Ruhestätten in der Regel nur bei bestimmten Arten und speziellen Gebieten (insbesondere bei Rastvögeln auf dem Durchzug oder im Winterquartier) zu berücksichtigen. Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung sind in der Praxis vor allem die Fortpflanzungsstätten zu betrachten. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher im Wesentlichen auf Fortpflanzungsstätten von Brutvögeln.
Als kleinste Einheit für die Fortpflanzungsstätte kann bei manchen Arten das nesttragende Gehölz (z.B. Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla) oder der Nistbaum (z.B. Kohlmeise Parus major) genannt werden. Es ist aber nicht zwangsläufig jeder Baum oder jede Hecke als Fortpflanzungsstätte dieser Arten anzusehen, sondern nur solche, die die artspezifisch geeigneten Strukturen für die entsprechende Nestanlage zur Verfügung stellen. So können z.B. die meisten Großvogelarten nur Bäume ab einer gewissen Größe und in spezieller Ausprägung (z.B. weit ausladendes Altholz für die Horstanlage) nutzen oder manche heckenbrütenden Kleinvogelarten nur dichtes oder stacheliges Gebüsch.
Darüber hinaus ist bei vielen Arten die Eignung als Fortpflanzungsstätte erst dann gegeben, wenn das nähere Umfeld – unabhängig vom Nahrungshabitat – zusätzlich entsprechende Strukturen aufweist. Das gilt z.B. für die meisten Brutvogelarten des Waldinneren, insbesondere größere Horst- und Höhlenbrüter (z.B. Habicht Accipiter gentilis oder Mittelspecht Dendrocopus medius). Hier wird das Nest nur dann auf einem geeigneten Horst- oder in einem Höhlenbaum angelegt, wenn um diesen Baum herum Waldstrukturen in einer gewissen Dimensionierung vorhanden sind. Befindet sich hingegen ein von der Struktur her geeigneter Horst- oder Höhlenbaum im Offenland oder am Waldrand, wird dieser trotzdem nicht von diesen Arten besiedelt und genutzt. Dieser Baum kann dann trotz seiner strukturellen Eignung naturschutzfachlich nicht als Fortpflanzungsstätte für diese Arten bezeichnet werden. Das impliziert, dass das Umfeld, soweit notwendig, zur Fortpflanzungsstätte zu rechnen ist, da ansonsten ihre Funktion als solche nicht gegeben ist.
Analoges gilt für die Ruhestätte. Als kleinste Einheit kann eine Hecke (z.B. Schlafplatz für Feldsperlinge Passer montanus) oder eine Baumreihe (z.B. Schlafplatz Rotmilan Milvus milvus) gelten. Im Regelfall ist jedoch auch hier das benötigte strukturelle Umfeld zu berücksichtigen. Dieses betrifft in Mitteleuropa vor allem Offenland und Gewässer als typische Rasthabitate durchziehender und überwinternder Vogelarten. Im Fall des Offenlandes ist eine Ruhestätte (z.B. für Kiebitz Vanellus vanellus oder Gänse Anser spp.) funktional als solche nur dann geeignet, wenn sie weiträumig offen und übersichtlich gelegen ist. Ähnliches gilt für Rastgewässer, für die zusätzlich zu ihrer Ausprägung (Größe, Tiefe, Form) auch die Ausstattung des angrenzenden Uferbereichs maßgeblich sein kann. Wird dieser verändert (z.B. durch Gehölzaufwuchs), kann das Gewässer für einige Arten seine Attraktivität und damit seine Funktion als Ruhestätte verlieren, auch wenn es als Gewässer selbst vorhanden bleibt.
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist das strukturelle Umfeld somit immer dann mit zur Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu rechnen, wenn dessen Veränderung zu einem Funktionsverlust der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte führt. Die naturschutzfachlich nachvollziehbare Mitbetrachtung des strukturellen Umfeldes kann bei der Anwendung der derzeitigen Rechtsprechung nicht vollzogen werden, denn diese tendiert zu einer engen Auslegung. Hier ist es erforderlich, eine Lösung zu erarbeiten, die rechtlich und fachlich richtig ist.
3.3 Methodische Erfassungsgrundlagen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Wie oben dargestellt, muss die Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte immer art- und situationsspezifisch erfolgen. Dazu sind im Regelfall Parameter zu ermitteln, im Rahmen einer Auswirkungsanalyse nachvollziehbar zu diskutieren und im Hinblick auf ein mögliches Eintreten eines Verbotstatbestandes zu bewerten. Bei Brutvögeln sind die folgenden Punkte zu betrachten:
Nest (bei Großvögeln Horst): Wird es mehrjährig genutzt oder alljährlich neu gebaut? Sofern es zumindest regelmäßig mehrjährig genutzt und nicht ständig neu gebaut wird, ist es grundsätzlich als Fortpflanzungsstätte zu betrachten, auch wenn es außerhalb der Brutzeit nicht benutzt wird. Denn auch zu dieser Zeit besitzt es eine bestimmte Funktion, so dass dessen Zerstörung auch außerhalb der Brutzeit einen Verbotstatbestand darstellt.
Niststätte: Es sind drei Aspekte zu betrachten: (1) Wird sie mehrjährig genutzt oder alljährlich gewechselt? Sofern sie mehrjährig genutzt wird, s. Nest. (2) Werden spezielle (Sonder-)Strukturen (z.B. Baumhöhlen) benötigt oder ein breites Spektrum an Strukturen genutzt? Wenn es sich um spezielle Ausprägungen von Strukturen handelt, die in der näheren Umgebung nicht vorhanden sind und zur Anlage des Nestes unbedingt benötigt werden, sind sie als Bestandteil der Fortpflanzungsstätte zu betrachten. Das gilt z.B. für einen Höhlenbaum, der nur von jüngeren und schwach dimensionierten Bäumen umgeben ist. Wird dieser gefällt, ist im betroffenen Revier kein Ersatz vorhanden. Sind dort jedoch viele weitere Höhlenbäume vorhanden, führt der Verlust von einem einzigen Höhlenbaum nicht zwangsläufig zu einem Funktionsverlust (und damit zur Aufgabe des Reviers), da die Art in der Lage ist, auf andere Höhlenbäume auszuweichen (sofern diese nicht bereits besetzt sind). (3) Ist die strukturelle Ausprägung der näheren Umgebung für die Anlage von Fortpflanzungs- und Ruhestätten relevant oder nicht? Für die meisten Arten ist davon auszugehen, dass das engere oder auch weitere Umfeld um die eigentliche Niststätte eine entsprechend geeignete Struktur aufweisen muss, damit überhaupt eine Nutzung als Fortpflanzungsstätte erfolgt. Im engeren Umfeld ist dies vor allem durch mikro- bzw. mesoklimatische Aspekte, im weiteren Umfeld vor allem durch Aspekte wie Schutz vor Feinden, Sichtschutz sowie An- und Abflugmöglichkeiten bedingt (Bergmann 1987, Bezzel & Prinzinger 1990). Diese Abhängigkeiten werden durch die Habitatwahl der Arten offensichtlich. So kommen z.B. viele Waldvogelarten im baum- bzw. mit Gehölz bestandenen Offenland – trotz Vorhandensein von „Niststätten“ (Baum, Hecke) – nicht vor, weil die strukturelle Umgebung nicht „stimmt“. Ebenso meiden viele Offenlandarten wie z.B. Kiebitz die Nähe von Wäldern und größeren Gehölzen, weil die Umgebung der Niststätte die Funktion dort nicht erfüllt. An diesen Stellen ist dann mit einem Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht zu rechnen.
Revierzentrum: Für Arten, bei denen das strukturelle Umfeld um die Niststätte von Bedeutung ist, ist somit das Revierzentrum auf seine strukturellen Bestandteile näher zu untersuchen. Hier muss geprüft werden, ob dieses enger oder weiter zu fassen ist. Bei manchen Arten sind zudem ggf. Wechselhorste (z.B. Rotmilan Milvus milvus, Schwarzstorch Ciconia nigra) oder mehrere Höhlenbäume (Schwarzspecht Dryocopus martius) erforderlich, auch wenn je Jahr nur eine einzige Niststätte benötigt wird. Fehlen hier aber weitere geeignete Höhlenbäume, kann das Revier aufgegeben werden, da die Funktion (hier Verbund mehrerer Höhlenbäume) nicht mehr gewährleistet ist (z.B. Blume 1996, Janssen et al. 2004).
Revier: Da bei der Betrachtung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte deren Funktion und deren zukünftige Verfügbarkeit der entscheidende Punkt darstellt, ist die Frage nach der Reviertreue einer Art oder eines Individuums sekundär und in diesem Zusammenhang vernachlässigbar. Dieses ist insbesondere daher anzunehmen, da – mit Ausnahme weniger langlebiger Arten – bei den meisten Vogelarten die Reviere im Laufe weniger Jahre immer wieder von anderen Vogelindividuen besetzt werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich um brutplatztreue, reviertreue Arten oder um Arten mit wechselnden Revieren handelt.
Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, dass beim Nachweis einer Art die entsprechende Funktion an dieser Stelle gegeben und das auch zukünftig zu gewährleisten ist. Der Nachweis einer Art bzw. eines Reviers ist daher immer stellvertretend für das Vorhandensein einer Fortpflanzungsstätte zu sehen, die im Bereich der nachgewiesenen Stelle anzunehmen ist.
Bei den vorhergehend dargestellten Grundlagen handelt es sich um fachlich korrekte, aber theoretische Näherungen. Zwar sind die erwähnten Punkte durch viele intensive Untersuchungen belegt und auch zusammenfassend dokumentiert (z.B. Bauer et al. 2005, Glutz von Blotzheim et al. 1966-1997). In den meisten Fällen sind hierzu jedoch spezielle, sehr intensive und zeitaufwändige Nachforschungen erforderlich, die in der Eingriffsplanung meist nicht gefordert werden können (vgl. Urteil des BVerwG vom 17.01.2007 – 9 A 20.05 – zur Westumfahrung Halle, „Halle-Urteil“). Somit stellt sich die Frage, was üblicherweise im Rahmen der Eingriffsplanung bzw. für die Artenschutzprüfung sinnvoll kartiert und erfasst wird.
Gängiges Verfahren und anerkannter Stand der Wissenschaft sind Kartierungen gemäß den Methodenstandards des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) (Südbeck et al. 2005). Hier sind – abhängig vom Arteninventar und Lebensraum – Anzahl der Begehungen, Erfassungsintensität, geeignete Zeiträume sowie Kriterien zur Einstufung als „Revier“ oder „Paar“ als „Stand der Technik“ verbindlich genannt. Ziel hierbei ist die flächendeckende Erfassung aller planungsrelevanten Arten auf der Basis einer Revierkartierung, wie sie in der Freilandornithologie üblich ist und den fachlich anerkannten Standard darstellt.
Da es sich hierbei jedoch um keine autökologischen Spezialuntersuchungen handelt, werden dabei nur im Ausnahmefall Nester oder Niststätten erfasst (z.B. bei Groß- und Greifvögeln oder Großvogel-Kolonien wie Graureiher und Kormoran). Ansonsten (z.B. bei Offenland-Singvogelarten) werden hier „nur“ Reviere ermittelt und räumlich lokalisiert, wobei die Lokalisierung als „idealisierter Reviermittelpunkt“ zu verstehen ist. In der Praxis bedeutet dies, dass der Kartierer die einzelnen Beobachtungen während der Kartierungsgänge auf Karten überträgt und die Beobachtungen während einer Kartierungsperiode überlagert und in Verbindung mit der vorhandenen Lebensraumstruktur ein Revierzentrum „idealisiert“ abgrenzt. Dieses ist nicht etwa eine fehlerhaft Darstellung, sondern eine Unschärfe, die der Methode geschuldet ist.
Das bedeutet, dass in den meisten Fällen anhand vorhandener „idealisierter Reviere“ die genaue Lage des Nestes als zentraler Bestandteil der Fortpflanzungsstätte nicht exakt bestimmbar ist. Jedoch kann sicher geschlossen werden, dass sich die Fortpflanzungsstätte mit Sicherheit im Umfeld dieses Fundpunktes befinden muss. Aus dieser methodischen Unschärfe heraus muss daher im konservativen Ansatz das Umfeld dieses Fundpunktes bei der Eingriffsbeurteilung mit berücksichtigt werden.
Die oben dargelegte Problematik, ob als rechtliche Beurteilungsgrundlage der Fortpflanzungsstätte nur das Nest, die Niststätte oder auch deren Umfeld zu betrachten ist, ist daher alleine aus den dargestellten methodischen Rahmenbedingungen in den meisten Fällen im Rahmen der Kartierung nicht zu klären, da sich das in der Praxis – mit wenigen Ausnahmen – gar nicht unterscheiden lässt. Dieses stellt aber trotz möglicher Unschärfe bei den Kartierungen kein fachliches Problem und somit auch keinen Planungsfehler dar, weil bei den meisten Arten davon auszugehen ist, dass das strukturelle Umfeld in artspezifisch gebotenen Grenzen mit zu berücksichtigen ist (s.o.). Die übliche Weise der Datenerfassung von Brutvögeln mittels einer Revierkartierung ist somit in der bisher praktizierten Form geeignet, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu bewerten.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung eine Prognose für die Zukunft zu erstellen ist, die auf aktuellen Kartierungsergebnissen beruht. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Dynamik von Vogelarten ist jedoch bekannt, dass in vielen Fällen die Lage des konkreten Niststandortes kleinräumig variiert und darüber hinaus im Laufe der Jahre immer wieder andere Individuen der Population dieses Revier nutzen, da die meisten Vogelarten in freier Natur recht kurzlebig sind. Nur in Ausnahmefällen wird derselbe Standort somit von denselben Individuen über viele Jahre hinweg genutzt (z.B. Schwarzstorch Ciconia nigra, Seeadler Haliaeetus albicilla oder Großer Brachvogel Numenius arquata). Daher spielt es in der Praxis auch aus diesen Gründen keine Rolle, ob nur das Nest, die Niststätte oder das relevante Umfeld als Fortpflanzungsstätte zu betrachten ist, weil alleine die Funktion des Raumes im Hinblick auf eine Fortpflanzungsstätte der jeweiligen Art als Beurteilungsgröße zu Grunde gelegt werden kann und muss. Dieses wird jedoch wiederum durch das kartierte „idealisierte Revierzentrum“ (inkl. seiner Unschärfe) realistisch abgebildet und ist auch aus diesem Grund im Regelfall als Maß für die Beeinträchtigung der hier betroffenen Fortpflanzungsstätte zu nehmen.
3.4 Kollision mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
Das Bundesverwaltungsgericht hat, wie oben bereits beschrieben, versucht, die Weitläufigkeit der im Rahmen des Verbotstatbestandes des §44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG zu beachtenden Strukturen zu begrenzen. Zwar beschreibt es die Fortpflanzungs- und Ruhestätten ebenfalls als „Lebensstätten, die durch bestimmte Funktionen geprägt sind“ (BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, 9 A 3/06 „Hessisch Lichtenau“), beschränkt den Schutz jedoch auf den als Ort der Fortpflanzung oder Ruhe dienenden Gegenstand. Es kommt dadurch in seinen letzten Entscheidungen zu einer räumlich engen Auslegung des Begriffes der Fortpflanzungsstätte (Nest, Höhlenbaum) und bezieht den räumlichen Zusammenhang im Rahmen einer funktionalen Betrachtung erst bei der Prüfung des §44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG mit ein. Diese Vorgehensweise steht erkennbar mit den oben erläuterten naturschutzfachlichen Einschätzungen, die bereits bei der Bestimmung der Fortpflanzungsstätte einen funktionalen Bezug (z.B. zur weiteren Umgebung) sehen, nicht im Einklang.
Einigkeit besteht dahingehend, dass die Fortpflanzungs- und Ruhestätten artspezifisch und in Abhängigkeit von der lokalen Situation und Ausprägung zu bestimmen sind. So gilt im Hinblick auf brutplatztreue Arten nicht nur das aktuell besetzte, sondern auch das regelmäßig genutzte Nest, selbst während der winterlichen Abwesenheit, als Fortpflanzungsstätte, wenn eine regelmäßig wiederkehrende Nutzung zu erwarten ist. Bei Arten, die ihr Nest jährlich wechseln oder neu anlegen, ist die Bewertung mit Bezug zum betroffenen Revier vorzunehmen.
Da die Brutvögel eine sehr große Vielfalt an Fortpflanzungsstätten nutzen, können diese anhand der beiden folgenden Beispiele jedoch nur annähernd beschrieben werden. Diese artspezifischen Betrachtungen können jedoch beispielhaft verdeutlichen, anhand welcher methodischen und fachlichen Grundlage die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten ermittelt werden können.
3.5 Beispiel Schwarzstorch
3.5.1 Naturschutzfachliche Bewertung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine große Schreitvogelart, die meist in großen, zusammenhängenden und störungsarmen Waldflächen brütet, sofern im näheren und weiteren Umfeld ein ausreichendes Angebot an naturnahen Bächen, Fließgewässer-Auen und Feuchtgrünland anzutreffen ist, wo er seine Nahrung findet. Eine weitere wesentliche Voraussetzung für die Etablierung eines Reviers bzw. eine Brut ist das Vorhandensein großer, alter Laubbäume mit weit ausladender Krone, die den üblicherweise sehr großen und langjährig genutzten Horst tragen können (Hormann in HGON 2000, Janssen et al. 2004). In Hessen gibt es gegenwärtig etwa 100 bis 120 Reviere (Stübing et al. 2010), von denen jedoch nicht alle besetzt sind. Trotz starker Zunahme während der letzten beiden Jahrzehnte wird der Schwarzstorch aufgrund seiner naturbedingten Seltenheit und großer Störungsanfälligkeit in der Roten Liste Hessen als „gefährdet“ (Kategorie 3) geführt (Kreuziger et al. 2006). Im Hinblick auf die Fortpflanzungsstätten sind beim Schwarzstorch folgende fachlichen Rahmenbedingungen zu Grunde zu legen:
Das Nest besteht aus einem langjährig genutzten, sehr großen Horst. Dieser kann nur auf einem stark dimensionierten Baum mit weit ausladender Krone, der die Niststätte darstellt, angelegt werden. Da der Horst langjährig genutzt wird, gilt das auch für den Horstbaum als Niststätte.
Da der Schwarzstorch sehr störungsempfindlich und heimlich ist, wird der Horst jedoch nur dann genutzt, wenn die Umgebung des Horstes ebenfalls aus älterem und reich strukturiertem Wald besteht. Ist das nicht mehr gegeben, verliert der bisherige Horst seine Funktion als Fortpflanzungsstätte. Er wird nicht mehr genutzt und das Revier mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgegeben.
Daher ist bei dieser Art aus naturschutzfachlicher Sicht auch der Bereich zur Fortpflanzungsstätte zu rechnen, der strukturell nicht verändert werden darf, da der Horst ansonsten seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Dieses betrifft in Abhängigkeit von der lokalen Ausprägung des Waldes einen Radius von mindestens 100m, ggf. bis zu 300m um den Horstbaum (Janssen et al. 2004, Runge et al. 2009).
Sollen hier die Zerstörungen der Fortpflanzungsstätte mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, sollte sogar die forstwirtschaftliche Nutzung im relevanten Umfeld ruhen, solange der Horst und das dazu gehörige Revier bestehen.
3.5.2 Erfassungsmethode
Wie bei vielen Vogelarten kann auch im Fall des Schwarzstorches die Brutvogelerfassung – je nach methodischem Ansatz – in ihrer Genauigkeit zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führen. Gemäß Methodenstandards sind drei Zählungen zwischen Anfang April und Ende Juni vorgesehen, bei denen eine Revierkartierung mittels der Beobachtung und Analyse der Flugbewegungen (vor allem Balz- und Nahrungsflüge) erfolgt (Südbeck et al. 2005). In den meisten Fällen lassen sich damit zwar besetzte Reviere (bzw. Bruten) mit Sicherheit nachweisen, das Revierzentrum – oder gar der konkrete Niststandort (Horst) – in den meisten Fällen jedoch nicht. Daher ist eine Revierkartierung in manchen Fällen nicht ausreichend, um mögliche Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsstätte prognostizieren zu können. Dieses kann nur mittels einer ergänzenden Horstsuche durchgeführt werden.
Jedoch ist es nicht bei allen Eingriffen zwingend notwendig, die genaue Lage des Horstes – und somit den Bereich der Fortpflanzungsstätte – genau verorten zu können. Das ist nur notwendig, wenn es bei einem Eingriff zu physischen Beeinträchtigungen oder Störungen im Umfeld des Revierzentrums kommen kann. Bei Betrachtung anderer Wirkfaktoren, die die Fortpflanzungsstätte nicht beeinträchtigen können (z.B. Vogelschlag an Windenergieanlagen in der weiteren Umgebung), ist die Kenntnis der Revierzentren hingegen ausreichend. Die entsprechenden Kartierungsmodalitäten sind daher beim Schwarzstorch an die Art und räumliche Lage der jeweiligen Planungen und den daraus resultierenden Wirkräumen anzupassen.
Je nach Aufwand ist demnach die genaue Bestimmung der Lage der Fortpflanzungsstätte punktgenau möglich.
3.5.3 Kollision mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
Wollte man die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes unreflektiert übernehmen, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass nur der Schwarzstorch-Horst selbst die Fortpflanzungsstätte der Art d
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



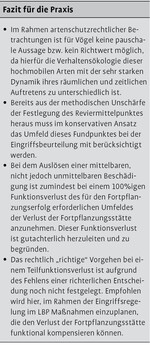
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.