Bücher
Weidelandschaften
Ein Naturführer der etwas anderen Art: „Wilde Weiden zwischen Nord- und Ostsee“ stellt 20 Weideprojekte im Bundesland Schleswig-Holstein vor. Hinschauen erwünscht: Hier beweisen engagierte Betriebe und Initiativen, wie eine extensive Landwirtschaft mit kleinen Herden von Rindern und Pferden landschaftlich attraktive Weidelandschaften prägt und eine reiche Biodiversität fördert.
- Veröffentlicht am
24 Autor(inn)en haben daran mitgewirkt. Große Tiere üben seit jeher eine Faszination auf uns aus, schreibt Uwe Diercking zum Einstieg – ein Besuch in den beschriebenen Weidelandschaften macht das stets aufs Neue deutlich, erweckt immer wieder ein wenig den Eindruck der Serengeti. Mit jeweils einer Karte mit Parkplatz und Wanderweg, einer mehrseitigen Gebietsbeschreibung, einer Informationsseite und einem zusätzlichen Hintergrundtext verbindet der Band Ausflugstipps mit tief gehenden Informationen. Ein interessantes Konzept der Umweltbildung – und die gezeigten Beispiele beweisen: So kooperieren Landwirtschaft und Naturschutz erfolgreich.
Wilde Weiden zwischen Nord- und Ostsee. Ein Naturführer. Herausgegeben vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. 256 Seiten mit zahlreichen farbigen Fotos und Kartenausschnitten. Broschiert. 14,95€. Verlagsgruppe Husum, Husum 2011. ISBN 978-3-89876-556-5.
Windkraft und Vögel
Unter dem Titel „Windkraft – Vögel – Lebensräume“ werden die Ergebnisse einer siebenjährigen Untersuchung über die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Brut- und Rastvögel im Landkreis Aurich (Ostfriesland) vorgestellt. Berücksichtigt wurden zwei Windparks, von denen einer während der Untersuchung gebaut wurde, so dass Vorher-Nachher-Vergleiche möglich waren.
Es zeigte sich wie bei vielen anderen Untersuchungen, dass Gastvögel empfindlicher reagieren als Brutvögel. Bei Brutvögeln gab es nur beim Kiebitz signifikante Rückgänge, die innerhalb des Windparks deutlicher ausfielen. Entfernungsbezogene Auswirkungen erbrachten eine Meidung im Nahbereich von 100m bei Kiebitz und Wiesenpieper. Für Uferschnepfe, Großen Brachvogel und Feldlerche deutet sich eine solche Meidung an. Unter den Gastvögeln war der Kiebitz mit einer signifikanten Meidung von 200 m am empfindlichsten. Weitere Arten, wie Star, Buchfink und Wacholderdrossel, mieden den Bereich bis 100m.
Die sehr umfangreichen Untersuchungen und Auswertungen berücksichtigten auch den Einfluss der landwirtschaftlichen Nutzung und der Gehölzstrukturen. Für ausgewählte Arten wurden Habitatmodelle berechnet, mit deren Hilfe die Vorkommenswahrscheinlichkeit dieser Arten in den Windparks und den Referenzflächen ermittelt werden konnte. Deutlich wurde, dass die Habitatqualität die Auswirkungen von Windkraftanlagen deutlich übertrifft.
Solche verhältnismäßig langen Untersuchungszeiträume sind in Mitteleuropa (leider) noch die große Ausnahme, obwohl der Erkenntnisgewinn erheblich ist. So konnten die Autoren zeigen, dass bei Kiebitz und Feldlerche erst nach einem langjährigen Untersuchungszeitraum eine verstärkte Meidung auftrat, die bis zu einem vollständigen Verschwinden in einem Windpark führte. Die Autoren unterbreiten auch Vorschläge für künftige Untersuchungen (Bruterfolg, Wiederkehr- und Neuansiedlungsrate mit individuellen Mar-kierungen, Korrelation zwischen Kollisionsverlusten und Flugaktivitäten im Rotorbereich).
Diese grundlegende Studie sollte für alle zur Pflichtlektüre gehören, die sich mit dem Thema befassen. Trotz des relativ hohen Preises ist dem Buch eine weite Verbreitung zu wünschen, damit die emotional stark vorbelastete Diskussion zum Thema Vögel und Windkraft auf einer sachlichen Basis geführt werden kann.
Klaus Handke
Windkraft – Vögel – Lebensräume. Ergebnisse einer siebenjährigen Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen und Habitatparametern auf Wiesenvögel. Von Hanjo Steinborn, Marc Reichenbach und Hanna Timmermann. 344 Seiten mit 101 Tabellen und 197 überwiegend farbigen Abbildungen. Gebunden. 68,– €. Books on Demand, Norderstedt 2012. ISBN 978-3-8423-8255-8.
Böden und Klima
Zwei Buchtitel greifen das aktuelle Thema der Klimarelevanz von Böden unter dem Einfluss des nutzenden Menschen auf – eine Materie, für die Politik und Verwaltung dringend klare Handlungsempfehlungen benötigen. Doch so einfach ist es nicht: Böden sind hoch komplexe ökologische Systeme und die wissenschaftliche Erkenntnis über die Funktionsmechanismen steckt gerade auch in Bezug auf den Kohlenstoffhaushalt der Böden in vielen Punkten noch in den Kinderschuhen. Doch die beiden Titel liefern zumindest wichtige Puzzlesteine zum Verständnis:
KTBL und vTI haben 48 Einzelbeiträge – Vorträge und Poster – einer gemeinsamen Tagung zusammengestellt. Sie geben einen guten Überblick, an welchen Themen in Bezug auf die Emissionen aus Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung derzeit in Deutschland geforscht wird und welche Ergebnisse hierbei resultierten. Dabei geht es um grundlegende, die Emission beeinflussende Faktoren, um Methoden und Ergebnisse zur Abschätzung der Emissionsquantität von Kohlendioxid, Methan, Lachgas, Ammoniak und Stickstoffoxiden sowie Strategien und praktische Lösungsansätze zur Emissionsminderung. Der Band bietet somit einen aktuellen und breiten Überblick. Es fehlt indes leider eine praxisbezogene Zusammenschau der Ergebnisse aus den beschriebenen Einzelbausteinen – aber vielleicht sind die Kenntnisse dafür auch einfach noch zu bruchstückhaft.
Eine solche Zusammenschau hingegen versucht der Titel „Soil Carbon in Sensitive European Ecosystems“ in elf Kapiteln unterschiedlicher Autoren, am Schluss als Summary unter dem Motto „From science to land management“ noch einmal gut zusammengefasst. Dabei fokussiert der Band mit mehr ökosystemarem Ansatz auf mediterrane Wälder und Agrarökosysteme, Gebirge und Heiden als besonders sensitive Schlüssel-Ökosysteme. Das Buch gliedert sich in drei Teile: Es versucht eine Zusammenführung der Kenntnisse über Treibhausgas-Dynamik in empfindlichen Ökosystemen; es zeigt die Prozesse auf, welche zu Veränderungen in der Kohlenstoff-Speicherfunktion von Böden führen; und es entwirft ein Monitoring-System, um Treibhausgase im Boden im Kontext anderer Kohlenstoffpools in terrestrischen Ökosystemen zu erfassen.
So gesehen ergänzen sich beide Bücher wegen ihrer Unterschiede. Mögen sie die Wissenschaft anspornen, mit erhöhtem Einsatz an den drängenden Fragen der Klimarelevanz von Bodennutzungen und ihrer Beeinflussbarkeit zu forschen. Die Praxis wartet darauf – so soll die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU verstärkt an Zielen des Klimaschutzes orientiert sein. Gerade hier bedarf es eines engen Austausches zwischen Forschung und Kommission bzw. Verwaltungen.
Eckhard Jedicke
Emissionen landwirtschaftlich genutzter Böden. KTBL-/vTI-Tagung vom 8. bis 10. Dezember 2010 im Bildungszentrum Kloster Banz in Bad Staffelstein. Herausgegeben vom KTBL. KTBL-Schrift 483. 380 Seiten. Kartoniert. 25,–€ plus Porto. Bezug: KTBL, Bartningstraße 49, 64289 Darmstadt, E-Mail vertrieb@ktbl.de, Internet http://www.ktbl.de. ISBN 978-3-941583-45-0.
Soil Carbon in Sensitive European Ecosystems. From Science to Land Management. Herausgegeben von Robert Jandl, Mirco Rodeghiero und Mats Olsson. 284 Seiten. Gebunden. 75,– €. Wiley-Blackwell, Chichester/UK 2011. ISBN 978-1-119-97001-9.
BNatSchG neu
Erstmals gelten mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz 2010 bundesweit einheitliche, direkt anwendbare Vollregelungen. Andererseits haben die Länder die Möglichkeit, davon in gewissen Grenzen abzuweichen. Ein neuer, so genannter „Berliner Kommentar“, herausgegeben von Walter Frenz und Hans-Jürgen Müggenborg und bearbeitet von 23 Fachleuten mit dem individuellen Hintergrund als Anwälte, Verbandsjuristen, Ministerialbeamte, Hochschullehrer und Richter, bringt Licht in die aktuelle Lage: Auf rund 1300 Dünndruck-Seiten, noch halbwegs handlich, bietet der Band einen guten und komprimierten Überblick mit Stand von Februar 2011. Das BNatSchG wird paragraphenweise abgehandelt, wobei die landesrechtlichen Abweichungen in Fußnoten bei den jeweiligen Einzelvorschriften aufgeführt sind. Somit ist ein rascher Zugang zu den Inhalten sowohl über die konkrete Fundstelle im Gesetz als auch über das sehr gut differenzierte Stichwortverzeichnis, 29 Seiten stark, schnell und einfach möglich.
BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz. Kommentar. Herausgegeben von Walter Frenz und Hans-Jürgen Müggenborg. Gebunden. LVIII + 1281 Seiten. 138,–€. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011. ISBN 978-3-503-12665-1.
Tierische Sprache
Einen Sack Flöhe zu hüten oder einen Busch voller Hasen zu beaufsichtigen – keine leichte Aufgabe. Gleiches gilt für die eierlegende Wollmilchsau, Synonym für jemanden, der etwas Unmögliches schaffen soll, indem er eine Vielzahl an Dingen gleichzeitig erfüllen soll. Vielleicht hilft es dabei, wieselflink zu sein oder mittels „Vogel-Strauß-Technik“ etwas auszusitzen – und mit etwas Glück fliegt einem ja auch mal eine gebratene Taube in den Mund. Wenn da nicht der innere Schweinhund wäre, die täglichen Aufgaben anzugehen. Kein wissenschaftliches Buch, aber unterhaltsam für alle, die sich mit Tieren beschäftigen: Welches sind tierische Redensarten und Begriffe, woher stammen sie? Ein Pons-Bändchen versammelt rund 320 Aussprüche und illustriert unterhaltsam, „wie die Tiere in die deutsche Sprache kamen“.
Wo liegt der Hund begraben? Wie die Tiere in die deutsche Sprache kamen. Von Michael Krumm. 127 Seiten. Kartoniert. 9,95€. Pons GmbH, Stuttgart 2010. ISBN 978-3-12-010030-0.
Europäisches Umweltrecht
Wer das europäische Umweltrecht berücksichtigt, ist nicht nur besser, sondern auch früher informiert. Unter dieser Prämisse hat Klaus Meßerschmidt auf 1000 Dünndruck-Seiten eine geraffte Gesamtdarstellung publiziert. Denn es bilde den Maßstab des nationalen Umweltrechts, es eröffne den Zugang zum Umweltrecht aller EU-Mitgliedstaaten und es ermögliche Prognosen über die künftige Entwicklung des nationalen Umweltrechts. Der Band ist keine schlichte Reproduktion der ohnehin im Internet nachzulesenden europäischen Quellen, sondern eine systematische und kritische Kommentierung: Einführend werden Grundprobleme des Umweltrechts beschrieben, es folgt das Primärrecht mit Grundlagen und Grenzen, Zielen und Prinzipien, europäischem und internationalem Umweltrecht, Instrumenten, Akteuren und Entwicklungsrichtung des europäischen Umweltrechts. Im Allgemeinen Teil des Sekundärrechts handelt der Autor UVP, Umweltinformation, IVU-Richtlinie, Öko-Audit-Verordnung und Umwelthaftung ab, im Besonderen Teil Naturschutz-, Gewässerschutz-, Luftreinhalte-, Klimaschutz-, Lärmschutz-, Abfall-, Chemikalien- und Gentechnikrecht. Auf 15 Seiten erleichtert das Sachverzeichnis den direkten Zugang zu den relevanten Rechtsstellen.
Europäisches Umweltrecht. Von Klaus Meßerschmidt. Juristische Kurz-Lehrbücher. 1007 Seiten. Kartoniert. 64,–€. Verlag C.H. Beck, München 2011. ISBN 978-3-406-59878-4.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


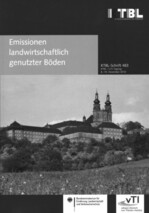
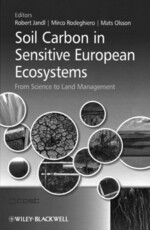

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.