Alternierend spät gemähte Altgrasstreifen fördern die Wirbellosenfauna in Auenwiesen
Abstracts
Im hessischen NSG „Kühkopf-Knoblochsaue“ wurde zwischen 2006 und 2008 auf zehn Grünlandflächen der Einfluss von später und unterbliebener Mahd auf Altgrasstreifen untersucht. Die eingesetzten Methoden waren standardisierte Käscherfänge, halbquantitative Untersuchungen von Tag- und Dickkopffaltern und Heuschrecken sowie Handfänge. Neben den genannten Tiergruppen wurden Wanzen, Rüssel- und Blattkäfer sowie Libellen untersucht. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines integrativen Nutzungskonzeptes zur Förderung einer auentypischen Wirbellosenfauna.
Die Untersuchungen zeigen bei fast allen Tiergruppen, dass Arten- und Individuenzahlen nach der Mahd in den Altgrasstreifen höher sind als in den regelmäßig im Juni gemähten Flächen. Dieser Effekt trat bereits im ersten Untersuchungsjahr auf. Besonders deutlich wurde dieser Effekt im Jahr 2008, als alle Grünlandflächen fast zeitgleich in der zweiten Junihälfte gemäht wurden. Lediglich einige Feldheuschrecken zeigen keine Bevorzugung der ungenutzten Flächen bzw. sind sogar in den regelmäßig genutzten Flächen häufiger. Auch bei den Blattkäfern sind die Unterschiede zwischen den Nutzungsvarianten nur gering.
Besonders effektiv sind Altgrasstreifen in den kräuterreichen Beständen, wenn die umgebenden Flächen früh im Juni gemäht werden. Je Grünlandfläche sollte mindestens ein Altgrasstreifen stehen bleiben und im nächsten Jahr regulär mitgenutzt werden.
Late Mowed Stripes of Grassland Promote Invertebrates in Floodplain Meadows – Results from the nature reserve “Kühkopf-Knoblochsaue”
In the Hessian nature reserve “Kühkopf-Knoblochsaue” the influence of late or omitted mowing of stripes of older grassland was investigated on ten grassland sites between 2006 and 2008. The methods applied were standardized catches with dip nets, semi-quantitative inventories of butterflies and grasshoppers as well as hand catches. Beside these species groups the mapping included bugs, leaf beetles, weevils and dragonflies. The investigation aimed to develop an integrative land use concept for the promotion of a site-typical invertebrate fauna.
Nearly all groups of animals showed higher numbers of species and individuals after the late mowing compared to the stripes which were regularly mowed in June. This effect was already observed in the first year and became particularly apparent in the year 2008 when all grassland sites were mowed nearly at the same time in the second half of June. Only a few species of grasshoppers did not prefer the unused sites or even were more frequent on the regularly mowed sites. The leaf beetles also showed only little differences between the different intensities of land use. The late mowed stripes of grassland are particularly effective in herb-rich stands when the surrounding sites are mowed in early June. For each grassland site at least one stripe of older grass should be left over and be mowed together with the grassland in the following year.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Auenwiesen gehören aufgrund tiefgreifender Eingriffe in die hydrologischen Verhältnisse der Flüsse und der Auen sowie einer deutlichen Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung zu den am stärksten bedrohten Lebensräumen in Deutschland (Riecken et al. 2006) und in Europa (Joyce & Wade 1998). Die europaweiten drastischen Rückgänge artenreicher Auenwiesenbestände führten auch zur Aufnahme der Stromtalauenwiesen des Verbandes Cnidion (Brenndolden-Wiesen), die in Deutschland z.B. entlang von Donau, Rhein und Elbe anzutreffen sind, in den Anhang I der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG). Wie in anderen Auengebieten auch, erreichten am hessischen Oberrhein die Grünlandverluste zu Beginn der 1980er Jahre stellenweise bis zu 90 % der ursprünglich vorhandenen Bestände (Böger 1991, Krug 1997). Insbesondere die artenreichen, subkontinental getönten Stromtalwiesen waren als Folge dieser Entwicklung damals nur noch in kleinflächigen und isolierten Restbeständen anzutreffen (Bissels et al. 2004, Donath et al. 2003).
Die naturschutzfachliche Besonderheit der Stromtalwiesen ergibt sich aus dem Vorkommen zahlreicher typischer Pflanzenarten mit subkontinentaler Verbreitung, die nicht nur national (Korneck et al. 1996), sondern auch international als gefährdet eingestuft werden (Schnittler & Günther 1999). Darunter befinden sich Arten wie Arabis nemorensis (Flachschotige Gänsekresse), Cnidium dubium (Brenndolde), Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie) und Viola pumila (Niedriges Veilchen). Diese hohe naturschutzfachliche Wertigkeit war Anlass mehrerer erfolgreicher Renaturierungsprojekte zur Wiederansiedlung von artenreichen Stromtalwiesen mittels Mahdgutübertragung (Donath et al. 2006, 2007, 2009; Hölzel et al. 2003, 2006).
Neben der floristischen Bedeutung ergibt sich der hohe naturschutzfachliche Wert der Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein aber auch aus ihrer hohen faunistischen Diversität (Abb. 1). So konnten dort innerhalb von drei Jahren über 600 Arten an Tag- und Dickkopffaltern, Widderchen, Heuschrecken, Laufkäfern, Rüsselkäfern, Blattkäfern und Wanzen dokumentiert werden (Hölzel et al. 2006). Das Vorkommen von alleine 34 % der für Hessen nachgewiesenen Laufkäferarten, 37 % der Heuschreckenarten und 31 % der Tag- und Dickkopffalter- sowie Widderchenarten konnte belegt werden. Im Rahmen dieser Untersuchungen ist auch ein starker negativer Effekt einer großflächigen Mahd der Grünlandbestände im Juni auf Tagfalter, Laubheuschrecken sowie seltene phytophage Käfer und Wanzen festgestellt worden (Hölzel et al. 2006).
Daher war ein Ziel der Untersuchungen im Rahmen des DBU-Projektes „Handlungskonzept für die floristische und faunistische Aufwertung artenarmer Auenwiesen“ (2006 bis 2009), ein integriertes Nutzungskonzept zur Förderung einer auentypischen Wirbellosenfauna durch spät gemulchte oder nur alle zwei Jahre gemähte Wiesenstreifen zu entwickeln. Das Konzept sollte einfach durchzuführen sein und weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen als Heuwiesen ermöglichen.
Untersuchungen zu den Auswirkungen von Altgrasstreifen in mitteleuropäischen Auenwiesen fehlen bisher völlig und sind auch in anderen Grünlandbeständen nur selten durchgeführt worden (z.B. Bornholdt et al. 1997, Gigon et al. 2010, Kiechle et al. 1994, Luick et al. 1993, Müller & Bosshard 2010).
Daher leiteten insbesondere folgende für den Naturschutz relevante Fragestellungen die faunistischen Untersuchungen:
Kann durch die Einrichtung später oder alle zwei Jahre gemähter Wiesenstreifen eine faunistische Aufwertung der Stromtalwiesenbestände stattfinden?
Welches der angewandten Mahdregime ist besonders geeignet, diese faunistische Aufwertung der Bestände zu erreichen?
Welche Artengruppen der Wirbellosen reagieren besonders positiv auf die angewandten Mahdregime?
2 Material und Methoden
2.1 Untersuchungsgebiet
Das Projektgebiet ist das größte hessische Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsaue“, welches sich am hessischen Oberrhein ca. 35km südwestlich von Frankfurt a. M. befindet. Standörtlich prägend für das Gebiet ist ein im Jahresgang scharfer Wechsel zwischen Wasserüberschuss und starker Austrocknung. Auf mehrwöchige, in manchen Jahren (z.B. 1999, 2001) auch mehrmonatige Überstauung tiefliegender Bereiche im Frühjahr und Frühsommer durch direkte Überflutung rheinseits (Rezentaue) oder durch aufsteigendes Grundwasser landseits des Winterdeichs (Altaue) folgt in der Regel während der Sommermonate eine von Wassermangel geprägte Periode (Bissels et al. 2005). Dies ist zum einen Folge der geringen mittleren Jahresniederschläge von 550 bis 600 mm (Müller-Westermeier 1999), zum andern bedingen die hohen Tongehalte (>50 %; Burmeier et al. 2010) bei Austrocknung einen rapiden Abfall des Gehalts an pflanzenverfügbarem Wasser. Eine ausführliche Beschreibung des Untersuchungsgebietes findet sich bei Baumgärtel et al. (2002) und Hölzel et al. (2006).
2.2 Probeflächen
Als Kriterium für die Auswahl der Probeflächen ging insbesondere die naturschutzfachliche Wertigkeit aus floristischer Sicht ein. Als Bewertungskriterium wurde die Einstufung der Wiesenbestände in der FFH-Grundatenerhebung gewählt (RP Darmstadt 2005), so dass sechs Probeflächen in Beständen der FFH-Lebensraumtypen Brenndoldenauenwiesen (6440) und mageren Flachlandmähwiesen (6510) angelegt wurden. Darüber hinaus wurden auch vier Probeflächen in floristisch artenärmeren Beständen angelegt. Damit sollte untersucht werden, ob sich die Effekte spät gemulchter oder alle zwei Jahre gemähter Altgrasstreifen in floristisch artenreichen und artenarmen Vegetationsbeständen unterscheiden. Da sich dafür und auch für den Einfluss der Lage der Probeflächen in den verschiedenen Lebensraumtypen in statistischen Voranalysen keine statistisch signifikanten Belege fanden, wurden diese Faktoren in den statistischen Analysen nicht weiter berücksichtigt.
Jede der zehn Probeflächen besteht aus drei Teilflächen mit je 500 m2, in der Regel 5m x 100 m, auf zwei Flächen auf Wunsch der Landwirte mit den Maßen 20 m x 25 m eingerichtet, die unterschiedlichem Nutzungsregime unterworfen wurden. Es wurden die Auswirkungen dreier Mahdvarianten auf die Wirbellosenfauna untersucht. Die Variante A diente als Kontrolle und wurde zu dem regulären Mahdtermin – aufgrund von Nutzungsauflagen frühestens ab 10. Juni – der umliegenden Grünlandbestände gemäht. Die Variante B wurde jährlich ab September gemulcht. Die Variante C wurde alle zwei Jahre zum regulären Mahdtermin gemäht, d.h. keine Mahd in den Jahren 2006 und 2008, aber Mahd zum Termin der Regelmahd im Jahr 2007.
Zwei Probeflächen wurden aufgrund ihrer extremen Artenarmut nur in den Jahren 2006 und 2007 untersucht. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der feuchten Witterung im Jahr 2007 nur auf vier der Probeflächen die Varianten A und C bereits im Juni gemäht wurden und auf den meisten anderen Grünlandbeständen die erste Mahd erst im August erfolgen konnte.
Entsprechend der vorherrschenden Wiesennutzung der Grünlandbestände innerhalb des NSG „Kühkopf-Knoblochsaue“ ist insbesondere der Aspekt des ersten Aufwuchses sehr stark von Gräsern dominiert. Im Gegensatz dazu steht das deutliche Hervortreten von Kräutern im Zweitaufwuchs der Bestände. Typische und häufige Aspektbildner der Probeflächen waren Achillea millefolium, Cirsium arvense, Lathyrus pratensis, Galium mollugo, Galium wirtgenii, Leucanthemum vulgare, Vicia cracca und auf einzelnen Flächen z.B. Dianthus carthusianorum, Salvia pratensis, Thalictrum flavum und Inula salicina.
2.3 Faunistische Erhebungen
Im Jahr 2006 erfolgte die Erstuntersuchung, die vor allem den Ausgangszustand und den Einfluss der Erstmahd dokumentiert. Ein deutlicher Effekt der Altgrasstreifen war erst im zweiten oder dritten Jahr zu erwarten, da die Entwicklungszeit vieler Insekten ein Jahr beträgt und so die unterlassene Mahd Tagfaltern oder Heuschrecken Entwicklungsmöglichkeiten gibt, die erst im Folgejahr nachweisbar sind.
Es wurden folgende Erfassungsmethoden angewendet:
Käscherfänge in der Vegetation: In allen Probeflächen (PF) wurde die Vegetation in den verschiedenen Versuchsvarianten an vier (2006/07) bzw. sechs Terminen (2008) von Mai bis August mit einem Streifnetz von 32cm Durchmesser mit 100 Käscherschlägen abgekäschert. Damit wurden Tag- und Dickkopffalter, Widderchen, Heuschrecken, Blatt- und Rüsselkäfer, Wanzen sowie Libellen erfasst.
halbquantitative Erfassung von Tag- und Dickkopffaltern, Heuschrecken und Libellen: Parallel zu den Käscherfängen wurde in den PF eine halbquantitative Häufigkeitsabschätzung aller Tag- und Dickkopffalter sowie Widderchen (6x), Heuschrecken (4x) und Libellen (6x) durchgeführt.
Handfänge: Außerdem fanden zusätzliche Handfänge statt. Aufgesammelt wurden alle erreichbaren Tiere (Heuschrecken, Rüsselkäfer, Wanzen sowie Libellen) entweder direkt mit dem Exhaustor oder mit der Hand. Die gefangenen Tiere wurden in Schraubdeckelgläser überführt, mit Essigäther bzw. Chloroform abgetötet und in 70- %igem Ethanol konserviert.
2.4 Datenanalyse
Die Signifikanz der Unterschiede zwischen den Individuen- und Artenzahlen der erfassten Wirbelosenfauna in den drei Mahdregimes wurde mit Hilfe des Tukey Tests, der im Anschluss einer signifikanten einfaktoriellen ANOVA (α=0,05) durchgeführt wurde, getestet. Unterschiede der Wirbelosenfauna zwischen den verschiedenen Mahdregimen der Untersuchungsflächen wurden mit dem Ordinationsverfahren der Nichtmetrischen Multidimensionalen Skalierung (NMS) analysiert (Leyer & Wesche 2007). Indikatorarten der Wirbellosenfauna für die betrachteten Mahdregime wurden mit der Indikator-Arten-Analyse (Indicator Species Analysis) bestimmt (Leyer & Wesche 2007). Bei diesem Verfahren wird für jede Art in Gruppen von Beprobungsflächen (hier gruppiert nach unterschiedlichen Mahdregimen) unter Verwendung von deren Häufigkeit und Frequenz in diesen Gruppen ein Indikatorwert berechnet. Dieser ist ein Maß dafür, wie gut das Vorkommen einer bestimmten Art eine Gruppe von Beprobungsflächen charakterisiert. Die NMS und Indikatorartenanalyse wurden mit dem Programm PC-Ord 5.09 durchgeführt (McCune & Mefford 1999), für alle weiteren statistischen Analysen wurde die Statistiksoftware STATISTICA 6.0 verwendet (Anonymus 2002).
3 Ergebnisse
3.1 Übersicht Arten- und Individuenzahlen
In den Untersuchungsjahren 2006 bis 2008 wurden in den zehn Probeflächen (PF) insgesamt 402 Arten der untersuchten Artengruppen erfasst. Dies waren 36 Tag-, Dickkopffalter- und Widderchen-, 21 Heuschrecken-, 23 Libellen-, 121 Rüsselkäfer-, 79 Blattkäfer- sowie 122 Wanzenarten.
Innerhalb der untersuchten PF ergeben sich hinsichtlich der Arten- und Individuenzahlen z.T. sehr deutliche Unterschiede. Grundlage für die Vergleiche sind die Untersuchungen der Jahre 2006 und 2007, da 2008 nicht mehr alle zehn PF untersucht wurden. So lagen die Artenzahlen für alle berücksichtigten Tiergruppen zwischen 106 und 178 Arten pro PF. Besonders artenreich sind einige der kräuterreichen PF. Eine andere artenreiche PF liegt an einem pflanzenartenreichen Graben und schließt außerdem an eine große, spät gemähte Fläche an. Möglicherweise beeinflusst dieses Umfeld die Artenzahlen auf dieser PF.
Faunistisch relativ artenarm sind PF, die sich durch eine hohe Gräserdominanz auszeichnen. Möglicherweise werden die Ergebnisse auch hier durch die Umgebung beeinflusst, da einige dieser artenarmen PF in Bereichen liegen, in denen großflächige Saumstrukturen bzw. Brachen fehlen. PF 8 und 9 sind auch botanisch artenarm. Diese beiden Flächen wurden deshalb 2008 aus dem Untersuchungsprogramm herausgenommen.
3.2 Gefährdete bzw. seltene Arten
Es wurden 69 in der BRD bzw. in Hessen seltene bzw. gefährdete Arten aus den Gruppen Tag- und Dickkopffalter sowie Widderchen, Heuschrecken, Rüssel- und Blattkäfer, Wanzen und Libellen gefunden. Die häufigsten bzw. verbreitetsten gefährdeten Arten sind Senfweißling (Leptidea sinapis), Lauchschrecke (Parapleurus alliaceus), Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar), Wiesengrashüpfer (Chorthippus dorsatus), der Rüsselkäfer Larinus turbinatus, die Netzwanze Tingis ampliata sowie die Bodenwanzen Dimorphoropterus spinolai, Tropidothorax leucopteus und Spilostethus saxatilis. Bei den Libellen sind u.a. Funde von Gemeiner Winterlibelle (Sympecma fusca), Südlicher Binsenjungfer (Lestes barbarus), Südlicher Mosaikjungfer (Aeshna affinis), Kleiner Königslibelle (Anax parthenope) und Asiatischer Keiljungfer (Gomphus flavipes) zu erwähnen.
3.3 Einfluss der verschiedenen Mahdregimes auf die Wirbellosenfauna
Deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Wirbellosenfauna der verschiedenen Streifen ergaben sich erst nach der Mahd. So zeigt auch die NMDS-Ordination (Abb. 2) für die erfasste Wirbellosenfauna der Jahre 2006 bis 2008 vor der Mahd keine Differenzierung zwischen den verschiedenen Mahdregimen (Abb. 2a, c, e). Dagegen treten, trotz starker individueller Unterschiede der Probeflächen, die differenzierenden Effekte der unterschiedlichen Mahdregime nach der großflächigen Regelmahd deutlich zu Tage (Abb. 2b, d, f). Im ersten Jahr der Untersuchungen (2006) setzt sich die Regelmahdvariante von den beiden in diesem Jahr nicht gemähten Varianten (Mulchmahd und zweijährige Mahd) ab. Im zweiten Jahr (2007) setzen sich die Flächen mit später Mulchmahd nur schwach von den Regelmahdflächen und den in diesem Jahr ebenfalls gemähten alternierenden Wiesenstreifen ab. Grund für diese geringe Differenzierung ist vermutlich die witterungsbedingt allgemein späte Mahd im Untersuchungsgebiet im Jahr 2007. Im dritten Untersuchungsjahr zeigt sich wiederum eine deutlich Differenzierung zwischen der Regelmahd und den beiden in diesem Jahr wiederum nicht gemähten Behandlungsvarianten.
Tag- und Dickkopffalter, Widderchen
Bei den Tag- und Dickkopffaltern sind im Jahr 2006 und 2008 nach der großflächigen Regelmahd höhere Arten- und Individuenzahlen als davor nachweisbar (Abb. 3a, 4a). Im Jahr 2007 ist der Trend vermutlich aufgrund der großflächig verspäteten Mahd umgekehrt, d.h. vor der Mahd sind höhere Arten- und Individuenzahlen als danach festzustellen.
Vergleicht man die Behandlungsvarianten vor der Regelmahd, so nehmen die durchschnittlichen Arten- und Individuenzahlen in allen drei Mahdregimen ähnliche Werte ein (Abb. 3a, 4a).
Nach der Regelmahd liegen die Individuenzahlen in allen Jahren in einem der jeweils nicht genutzten Bereiche (Varianten B und/oder C) höher als in dem von Regelmahd betroffenen Bereichen; in den Jahren 2006 und 2008 ist dieses Muster signifikant. In den Jahren 2007 und 2008 zeigt sich ein analoges Muster für die Artenzahlen, dies ist allerdings nur im Jahr 2008 signifikant, und im Jahr 2006 sind die Artenzahlen nach der Mahd im Bereich der Regelmahd sogar signifikant höher. Die Indikatoranalyse zeigt, dass Ochsenauge, Schwarzkolbiger Dickkopffalter und Schachbrett die jeweils nicht während der Vegetationsperiode gemähten Abschnitte bevorzugen (Tab. 1, Download unter http://www.nul-online.de Service, Download). Diese Analyse zeigt aber auch Präferenzen, die diesem allgemeinen Trend entgegenlaufen. So haben z.B. Goldene Acht und Admiral im Jahr 2006 ihren Vorkommensschwerpunkt auf den regulär gemähten Bereichen.
Heuschrecken
Hinsichtlich der durchschnittlichen Arten- und Individuenzahlen ergaben sich bei den Heuschrecken vor der Mahd deutlich geringere Werte als nach der Regelmahd (Abb. 3b, 4b). Wird diese großflächig sehr spät durchgeführt (2007), fehlen diese Unterschiede weitgehend. Bezüglich der Mahdvariante nach der Regelmahd ergibt sich ein zu den Tagfaltern analoges Muster, mit fast durchgehend höheren Werten in den im jeweiligen Jahr nicht genutzten Bereichen (Ausnahme: Individuenzahlen 2006) (Abb. 3b, 4b).
Diesem allgemeinen Trend steht wieder der Vorkommensschwerpunkt einiger Arten entgegen. So zeigen Feldheuschrecken, wie Gemeiner und Nachtigall-Grashüpfer (Chorphippus parallelus und C. biguttulus) sowie die Gemeine Dornschrecke (Tetrix undulata), eine deutliche Präferenz für die regelmäßig früh genutzten Flächen (vgl. auch Indikatorartenanalyse in Tab. 1, Download unter http://www.nul-online.de Service, Download). Die Indikatorartenanalyse zeigt aber auch, dass die Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar) als einzige der häufigeren Feldheuschrecken die nicht regulär gemähten Bereiche bevorzugt. Die Laubheuschrecken, z.B. Gemeine Sichelschrecke (Phanaroptera falcata), Langflüglige Schwertschrecke (Conocephalus discolor) und Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeseli), zeigen eine Präferenz für nicht der Regelmahd unterworfene Bereiche (Tab. 1, Download).
Auf Einzelartenniveau gab es bemerkenswerte Verschiebungen in der Präferenz der Mahdvarianten. So konnten von der Lauchschrecke im ersten Jahr die meisten Tiere in der Variante A festgestellt werden, im Jahr 2007 wurden sowohl in B als auch C höhere Individuenzahlen als in A nachgewiesen und im Jahr 2008 erreichte die Variante C die höchsten Werte.
Rüsselkäfer
In allen Untersuchungsjahren waren vor und nach der Regelmahd bei dieser Käfergruppe die Varianten B und C immer individuenreicher und meist auch artenreicher als die Variante A (Unterschiede signifikant im Jahr 2008; Abb. 3c, 4c). Dies gilt insbesondere für die Jahre 2006 und 2008 in denen die großflächige Regelmahd ab Mitte Juni stattfand. In den ungenutzten Flächen wurden mehr als doppelt so viele Arten und viermal mehr Individuen gefangen. Entsprechend besitzen die wenigen signifikanten Indikatorarten aus der Gruppe der Rüsselkäfer ihren Vorkommensschwerpunkt nur in den nicht gemähten Bereichen (Tab. 1, Download).
Blattkäfer
Bei dieser Käfergruppe sind die Unterschiede zwischen den Nutzungsvarianten hinsichtlich der durchschnittlichen Arten- und Individuenzahlen gering und nicht signifikant (Abb. 3d, 4d). Lediglich Variante C war 2008 deutlich individuenreicher. Dies liegt aber vor allem am Vorkommen einer Art (Labidostomis longimana) mit 80 Individuen in einer Parzelle. Auch auf Artebene zeigt sich entsprechend eine deutliche Bevorzugung der Altgrasstreifen durch einzelne Arten, wie z.B. Labidostomis longimana, Sphaeroderma testaceum und Cassida vibex (Tab. 1, Download).
Wanzen
Arten- und Individuenzahlen sind bei dieser Gruppe nach der großflächigen Regelmahd nur im Jahr 2006 deutlich höher als vor der Regelmahd (Abb. 3e, 4e). Die höheren Arten- und Individuenzahlen auf den nicht unter Regelmahd liegenden Teilflächen sind nur im Jahr 2008 signifikant. Diesem Muster entsprechend ergab die Indikatorartenanalyse Vorkommensschwerpunkte von einzelnen Wanzenarten nur für die nicht regulär genutzten Wiesenbereiche. Eine allgemeine Präferenz für diese Mahdvarianten haben vor allem fast alle Rhophalidae, z.B. Stictopleurus punctatonervosus und Cynidae, die zahlreichen Scutelleridae, wie Eurygaster maura, und die meisten Pentatomidae, wie Aelia acuminata, Holcostethus vernalis und Carpocoris fuscispinus (vgl. Tab. 1, Download).
Libellen
In den zwei Jahren mit großflächiger Regelmahd im Juni (2006/2008) sind auch bei dieser Artengruppe die höheren Arten- und Individuenzahlen auf den Untersuchungsflächen nach der Mahd nachzuweisen (Abb. 3f, 4f). Deutlich wird dann auch eine Präferenz der nicht genutzten Bereiche (vgl. Tab. 1, Download).
gefährdete Arten
Während Unterschiede in der Artenzahl zwischen den Mahdvarianten B und C und den Flächen, die der Regelmahd (Variante A) unterliegen, nur gering sind (Abb. 5), zeigen sich deutlich höhere Individuenzahlen auf den gemulchten bzw. nur alle zwei Jahre gemähten Flächen (Abb. 6). Insbesondere Heuschrecken und Wanzen weisen in den Altgrasstreifen deutlich höhere Individuenzahlen auf, wohingegen nur Blattkäfer in den Flächen mit Regelmahd häufiger vertreten sind (Abb. 6). Es ist darüberhinaus auffällig, dass Indikatorarten, die in den Roten Liste Deutschlands und Hessens geführt werden, fast ausnahmslos ihren Vorkommensschwerpunkt in den nicht der Regelmahd (Mahdvarianten B und/oder C) unterworfenen Flächen haben (Tab. 1, Download).
3.4 Zusammenfassende Betrachtung
Deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Wirbellosenfauna der verschiedenen Nutzungsvarianten ergaben sich erst nach der Mahd. Diese Effekte waren vor allem im ersten und dritten Untersuchungsjahr sichtbar, im Jahr 2007 traten sie, vermutlich aufgrund der witterungsbedingt allgemein späten Mahd im Untersuchungsgebiet, weniger deutlich hervor.
Bei fast allen Tiergruppen zeigt sich nach der Mahd bei Qualität und Quantität eine Bevorzugung der Altgrasstreifen. Lediglich bei den Blattkäfern sind die Unterschiede überwiegend gering. Auf Artebene zeigen nur einige Feldheuschreckenarten eine eindeutige Bevorzugung der Regelmahdflächen. Besonders deutlich war der „Altgrasstreifeneffekt“ im dritten Untersuchungsjahr in der Nutzungsvariante C, die 2007 regulär gemäht und 2006 und 2008 nicht genutzt worden ist. Da die reguläre Mahd im Jahr 2007 bereits im Juni großflächig stattfinden konnte, wiesen diese Flächen in der Folge bei den meisten Gruppen die höchsten Arten- und Individuenzahlen auf.
4 Diskussion
4.1 Naturschutzfachliche Bedeutung
Die Untersuchungen belegen die hohe Bedeutung der Auenwiesen für eine artenreiche Wirbellosenfauna, da diese sowohl eine hohe Artenvielfalt (insbesondere bei Rüsselkäfern, Blattkäfern und Wanzen) aufweisen als auch zahlreichen seltenen und gefährdeten Arten Lebensraum bieten. So sind 69 der Wirbellosenarten der untersuchten Gruppen in den hessischen bzw. bundesdeutschen Roten Listen als gefährdet bzw. selten eingestuft. Überregional bemerkenswert sind die individuenreichen Vorkommen der Lauchschrecke (Parapleurus alliaceus), des Rüsselkäfers Baris scolopacea, des Blattkäfers Longitarsus brisouti sowie der Wanzen Macrotylus herrichi, Strongylocoris atrocoeruleus, Peritrechus gracilicornis, Platyplax salicae, Ceraleptus gracilicornis, Coptosoma scutellatum, Ochetosthetus opacus, Tritomegas sexpunctatum und Eurygaster austriacum. Faunistisch bedeutsam ist auch die hohe floristische und strukturelle Diversität innerhalb und zwischen den Grünlandbeständen in den Auen, die sich wiederum in einer hohen faunistischen Vielfalt der untersuchten Probeflächen widerspiegelt (Hölzel et al. 2006).
4.2 Einfluss der Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der Altgrasstreifen
Während die Auswirkungen verschiedener Pflegemaßnahmen, wie Mahd (Bockwinkel 1988, Bornholdt 1991, Detzel 1984, Handke 1988, Morris 1978), Mulchen (Bornholdt 1991, Handke 1988), Beweidung (Bornholdt 1991, Hempel et al. 1971) und Feuer (Handke 1988) sowie die Anlage von Acker-Altgrasstreifen (Kubach & Hermann 1993) Gegenstand sehr vieler Untersuchungen war, finden sich zu den Auswirkungen von Altgrasstreifen in Grünlandbeständen nur wenige Untersuchungen (Bornholdt et al. 1997, Gigon et al. 2010, Kiechle et al. 1994, Luick et al. 1993, Müller & Bosshard 2010). In diesem Bereich wurden aber hauptsächlich die Auswirkungen von Gewässer-Altgrasstreifen auf die Fauna untersucht (Lorna et al. 2007, Sternberg & Sternberg 2004). Überwiegend zeigen diese Untersuchungen, dass sowohl eine regelmäßige Nutzung als auch Sukzession mit Verbuschung die Entwicklungsmöglichkeiten bestimmter Tiergruppen verschlechtern oder diese verhindern (Oppermann et al. 1987). So benötigen viele Laubheuschrecken, da sie ihre Eier in Pflanzenstängel ablegen (Detzel 1984), Wiesen mit hohem Bewuchs, während die meisten Laufkäferarten auf offene, niedrigwüchsige Pflanzenbestände angewiesen sind (Lorna et al. 2007). Wichtig ist auch, dass geeignete Habitate gleichmäßig und vernetzt in einer Landschaft verteilt sind. Dies ermöglicht Tierarten, beispielsweise durch Nahrungsmangel hervorgerufene lokale Aussterbeereignisse von Populationen durch Neubesiedelung zu kompensieren. Dies ist z.B. für Graswanzen (Bockwinkel 1988) und Kleinsäuger (Blab et al. 1989) beschrieben. Allerdings kann auch durch unsere Untersuchung bisher nur ein saisonaler Effekt belegt werden. Das würde bedeuten, dass die Dynamik der Wirbellosenzönosen wesentlich vom Umfeld bestimmt wird und nicht nur vom Mahdregime. Ob es wirklich einen dauerhaften Effekt gibt, ist nur nach wesentlich längerfristigen Untersuchungszeiträumen nachzuweisen.
Die bisher vorliegenden Untersuchungen belegen den positiven Effekt von Altgrasstreifen insbesondere für Ufer oder einzelne Tiergruppen wie Heuschrecken (Detzel 1984), Libellen (Sternberg & Sternberg 2004) und Kleinsäuger (Blab et al. 1989). So umfassend wie in vorliegender Untersuchung über mehrere Jahre und von sehr unterschiedlichen Tiergruppen wurde der positive Effekt von Altgrasstreifen im Grünland noch nicht belegt. Die dargestellten Untersuchungen zeigen auch, wie wichtig es ist, mehrere Jahre mit unterschiedlicher Witterung zu berücksichtigen. Vor allem im letzten Jahr 2008 mit fast gleichzeitiger früher Mahd fast aller Grünlandflächen im Untersuchungsgebiet machte sich der Altgrasstreifeneffekt bei nahezu allen Tiergruppen bemerkbar. Dabei zeigte es sich, dass diese Altgrasstreifen nicht nur Bedeutung für Tierarten haben, die sich dort aufgrund der unterbliebenen Mahd erfolgreich entwickeln können, sondern auch als Aufenthaltsort für Imagines z.B. bei ungünstiger Witterung. Dies betrifft neben den Libellen insbesondere die Tagfalter.
4.3 Vergleich mit anderen Untersuchungen
Die meisten Untersuchungsergebnisse liegen aus Streuwiesen in der Schweiz vor, die allerdings deutlich später gemäht werden als die Auenwiesen am Oberrhein (Gigon et al. 2010, Müller & Bosshard 2010). Dort werden in Grünlandbeständen zur Förderung von Wirbellosen einige 100 m2 große ungemähte Streifen angelegt, die jährlich seitwärts verschoben werden (sog. „Ried-Rotationsbrachen“). Es wird eine Breite von mindestens 10 m und eine Länge von 35 bis 50 m empfohlen. Allerdings ist die Lage der Streifen für jedes Jahr festgelegt. Die Untersuchungen in diesem Projekt belegen wie am Oberrhein im Vergleich zu den gemähten Wiesen günstigere Überwinterungsbedingungen für Insekten und Spinnen sowie gefährdete Arten. Eine Förderung wurde u.a. für Heuschrecken, Wanzen, Zikaden, Blatt- und Kurzflügelkäfer, Feldwespen und Tagfalter aufgezeigt (Gigon et al. 2010, Müller & Bosshard 2010). Ein positiver Effekt von zweijährigen Brachephasen in Streuwiesen ist darüber hinaus für einzelne Wirbellosengruppen nachgewiesen (Bräu & Nunner 2003, Cattin et al. 2003).
4.4 Empfehlungen für das künftige Management
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse am Oberrhein belegen für die meisten untersuchten Tierarten und -gruppen positive Effekte der Altgrasstreifen. Allerdings macht sich der Altgrasstreifeneffekt nur dann deutlich bemerkbar, wenn die übrigen Grünlandflächen im Juni gemäht werden. Sollte witterungsbedingt wie 2007 die Mahd erst im Juli/August erfolgen, ist das Stehenlassen von Altgrasstreifen nicht erforderlich. Das erfordert Flexibilität bei der Konzeption eines Altgrasstreifenprogramms.
Außerdem wurde in den Untersuchungen deutlich, dass sich der „Altgrasstreifeneffekt“ erwartungsgemäß besonders deutlich in den kräuterreichen Wiesen bemerkbar macht.
Je Wiesenfläche sollte vom Landwirt mindestens ein Altgrasstreifen mit einer Breite von 5 bis 10 m und einer Mindestlänge von 50 m stehen gelassen werden. Alternativ wäre analog zu den Empfehlungen von Gigon et al. (2010) auch ein Flächenanteil von 5 bis 10 % möglich. Diese Flächen sollten ein Jahr nicht gemäht werden, dann aber im darauf folgenden Jahr wieder regulär mit genutzt werden (entspricht Mahdregime C). Um keine Verschiebungen in der Pflanzenartenzusammensetzung oder gar Gehölzaufwuchs zu fördern, muss die Lage der Altgrasstreifen von Jahr zu Jahr wechseln. Die Altgrasstreifen sollten vor allem in kräuterreichen Grünlandbeständen angelegt werden sowie in Flächen ohne Brachestrukturen im Umfeld, z.B. nicht an Grabenrändern oder Wegsäumen.
Dank
Unser Dank gilt folgenden Personen: Dipl.-Forstw. Baumgärtel (Forstamt Groß-Gerau) und Dipl.-Ing. Harnisch (Riedstadt) für die gute Zusammenarbeit, insbesondere bei Flächenauswahl und management; Dipl.-Geogr. Schmiede, Universität Gießen, für die Bereitstellung der botanischen Daten; Dr. Günther (Ingelheim), Esser (Berlin) und Bellmann (Bremen) für die Bestimmung der Wanzen, Blatt- bzw. Rüsselkäfer; Dipl.-Biol. Lopau (Oldenburg) für die engagierte Mitarbeit bei den Geländearbeiten, der Auswertung und der Manuskripterstellung. Der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) danken wir für die finanzielle Förderung der Untersuchungen (Projekt Nr. 23329-33/0).
Literatur
Bissels, S., Hölzel, N., Donath, T. W., Otte, A. (2004): Evaluation of restoration success in alluvial grasslands under contrasting flooding regimes. Biol. Conserv. 118 (5), 641-650.
–, Donath, T.W., Hölzel, N., Otte, A. (2005): Ephemeral wetland vegetation of irregularly flooded arable fields: the importance of persistent soil seed banks. Phytocoenologia 35, 469-488.
Blab, J., Terhardt, A., Zsivanovits, K.-P. (1989): Tierwelt in der Zivilisationslandschaft. Teil I: Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Säugetieren und Vögeln im Drachenfelser Ländchen. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 30, Bonn-Bad Godesberg, 223 S.
Bockwinkel, G. (1988): Der Einfluß der Mahd auf die Besiedlung von mäßig intensiv bewirtschafteten Wiesen durch Graswanzen (Stenodemini, Heteroptera). Natur u. Heimat aus dem Westfälischen Museum f. Naturkunde 48 (4), 119-128.
Bornholdt, G. (1991): Auswirkungen der Pflegemaßnahmen Mahd, Mulchen, Beweidung und Gehölzrückschnitt auf die Insektenordnungen Orthoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha und Coleoptera der Halbtrockenrasen im Raum Schlüchtern. Marburger Entom. Publ. II/6, 1-330.
–, Brenner, U., Hamm, S., Kress, J.C., Lotz, A., Malten, A. (1997): Zoologische Untersuchungen zur Grünlandpflege am Beispiel von Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen in der Hohen Rhön. Natur und Landschaft 72 (6), 275-281.
Baumgärtel, R., Dister, E., Ernst, M., Fiemann, H., Gonnermann, H., Hartmann, G., Herzig, G., Korte, E., Kreuziger, J., Mecke, T., Schneider, E., Zettl, H. (2002): 50 Jahre Naturschutzgebiete – Kühkopf-Knoblochsaue – Hessens bedeutendstes Rheinauenschutzgebiet im Wandel der letzten Jahrzehnte. Regierungspräsidium Darmstadt, 70 S.
Bräu, M., Nummer, A. (2003): Tierökologische Anforderungen an das Streuwiesenmanagement. Laufener Seminarbeitr. 1, 203-222.
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2007): ÖPUL 2007. Sonderrichtlinie des BMLFU für das Österreichische Programm zur Förderung der umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft. BMLFU-LE.1.1.8/0073-II/8/2007.
Burmeier, S., Eckstein, R.L., Otte, A., Donath, T.W. (2010): Desiccation cracks act as natural seed traps in flood-meadow systems. Plant & Soil 333, 351-364.
Cattin, M.-F., Blandenier, G., Banasek-Richter, C., Bersier, L.-F. (2003): The impact of mowing as a strategy for wet meadows on spider (Araneae) communities. Biol. Conserv. 113 (2), 179-188.
Detzel, P. (1984): Die Auswirkungen der Mahd auf die Heuschreckenfauna von Niedermoorwiesen. Veröff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Würt. 59/60, 345-360.
Donath, T.W., Hölzel, N., Otte, A. (2003): The impact of site conditions and seed dispersal on restoration success in alluvial meadows. Appl. Vegetation Science 6, 13-22.
–, Bissels, S., Handke, K., Harnisch, M., Hölzel, N., Otte, A. (2006): E+E-Vorhaben „Stromtalwiesen“ – Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung. Natur und Landschaft 81, 529-535.
–, Bissels, S., Hölzel, N., Otte, A. (2007): Large scale application of diaspore transfer with plant material in restoration practice – impact of seed and microsite limitation. Biol. Conserv. 138, 224-234.
–, Schmiede, R., Harnisch, M., Burmeier, S., Eckstein, R.L., Otte, A. (2009): Renaturierung von Auenwiesen – Perspektiven für die langfristige Entwicklung. Laufener Spezialbeitr. 2/09, 122-132
Gigon, A., Rocker, S., Walter, T. (2010): Praxisorientierte Empfehlungen für die Erhaltung der Insekten- und Pflanzenvielfalt mit Ried-Rotationsbrachen. ART-Ber. 721, Forschungsanstalt ART, Reckenholz-Tänikon, 12 S.
Handke, K. (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachflächen in Baden-Württemberg. Arbeitsber. Lehrstuhl Landschaftsökol. Münster (8), 1-157.
Hempel, W., Hiebisch, H., Schiemenz, H. (1971): Zum Einfluss der Weidewirtschaft auf die Arthropodenfauna im Mittelgebirge. Faun. Abh. Dresden 3, 235-281.
Hölzel, N., Donath, T.W., Bissels, S., Otte, A. (2002): Auengrünlandrenaturierung am hessischen Oberrhein – Defizite und Erfolge nach 15 Jahren Laufzeit. Schr.-R. Vegetationskde. 36, 131-137.
–, Bissels, S., Donath, T.W., Handke, K., Harnisch, M., Otte, A. (2006): Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein – Ergebnisse aus dem E+E-Vorhaben 89211-9/00 des Bundesamtes für Naturschutz. Naturschutz und biologische Vielfalt 31.
–, Otte, A. (2003): Restoration of a species-rich flood-meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant material. Appl. Vegetation Science 6, 131-140.
Kiechle, J., Luick, R., Pier, A. (1994): Zeitliche und räumliche Funktion von Wiesenrandstreifen. Hohenheimer Umwelttagung 26, 321-324.
Kubach, G., Hermann, S. (1993): Dienen neuangelegte Saumstrukturen in der Agrarlandschaft dem Artenschutz? Verh. Ges. Ökol. 22, 99-102.
Lorna, J.C., Morton, R., Harrison, W., McCracken, D.I., Robertson, D. (2007): The influence of riparian buffer strips on carabid beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblage structure and diversity in intensively managed grassland fields. Biodiversity and Conservation 17 (9), 2233-2245.
Luick, R., Kapfer, A. (1993): Untersuchungen zur Bedeutung temporärer Wiesen-Altgrasstreifen. Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds, B.W. Symposium 15.02.1993 in Ettlingen, 25-35.
Morris, M.G. (1978): Grassland Management and invertebrate animals – a selective review. Scient. Proceed. Roy. Dublin Soc. Ser. A, 6 (11), 247-257.
Müller, M., Bosshard, A. (2010): Altgrasstreifen fördern Heuschrecken in Ökowiesen – eine Möglichkeit zur Strukturverbesserung im Mähgrünland. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (7), 212-217.
Oppermann, R., Reichholf, J., Pfadenhauer, J. (1987): Beziehungen zwischen Vegetation und Fauna in Feuchtwiesen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62.
RP Darmstadt (2005): Grunddatenerhebung für das FFH- Gebiet „Kühkopf- Knoblochsaue“. Unveröff., Darmstadt.
Sternberg, K., Sternberg, M. (2004): Veränderung der Artenzusammensetzung und erhöhte Abwanderrate bei Libellen durch die Mahd der Uferwiesen zweier Fließgewässer (Odonata). Libellula 23 (1/2), 1-43.
Anschriften der Verfasser: PD Dr. Klaus Handke, Ökologische Gutachten, Riedenweg 19, D-27777 Ganderkesee, E-Mail K.Handke@oekologische-gutachten.de ; Prof. Dr. Dr. Annette Otte & Dr. Tobias W. Donath, Institut für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, IFZ – Interdisziplinäres Forschungszentrum für biowissenschaftliche Grundlagen der Umweltsicherung, Justus-Liebig-Universität, Heinrich-Buff-Ring 26-32, D-35395 Gießen, E-Mail Annette.Otte@umwelt.uni-giessen.de bzw. Tobias. W.Donath@umwelt.uni-giessen.de .
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen






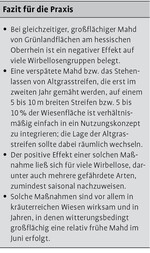
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.