Naturschutz ist Klimaschutz
Klimarelevante Naturschutzmaßnahmen im Alpenraum
- Veröffentlicht am
Von Mateja Pirc
Naturschutz ist in Zeiten des Klimawandels relevanter denn je zuvor. Dabei darf es aber nicht passieren, dass die ökologischen Folgen mancher Klimamaßnahmen noch schwerwiegender sind als der Klimawandel selbst. Deshalb stellt die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA in ihrem Hintergrundbericht „Naturschutz im Klimawandel“ klimarelevante Naturschutzmaßnahmen auf den Prüfstand der Nachhaltigkeit, zeigt mögliche Konflikte auf und stellt beispielhafte Projekte vor, die als Vorbild dienen können.
Verändert sich das Klima, bekommt die Natur das zu spüren. Der Klimawandel verändert die Arten und Ökosysteme und bedroht durch Extremwetterereignisse auch den Menschen. Die Alpen sind dabei besonders gefährdet, da sich dort die Klimaerwärmung besonders deutlich zeigt – und zwar doppelt so stark wie im europäischen Durchschnitt.
Jeder Temperaturanstieg um 1°C hat in Mitteleuropa eine Verschiebung der Vegetationszonen um 150 Höhenmeter nach oben und um 150km von Süden nach Norden zur Folge (Rebetez 2009). Experten gehen davon aus, dass einige Arten derartige räumliche Veränderungen, angesichts der Geschwindigkeit des derzeitigen Klimawandels, nicht bewältigen können. Weil die Berggebiete besonders sensibel sind, werden hier die höchsten Artenverluste auftreten. Gemäß aktuellen Modellen sind 45 % der alpinen Arten bis zum Jahr 2100 vom Aussterben bedroht (Klaus & Pauli 2009).
Der Klimawandel bedroht nicht nur Arten, er verändert ganze Ökosysteme. Der Rückzug der Gletscher ist beispielsweise eine schon sichtbare Folge des Klimawandels für die Ökosysteme im Alpenraum.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist die Rolle von intakten und vernetzten Ökosystemen relevanter denn je zuvor, da diese flexibler und dynamischer auf Änderungen des Klimas reagieren und als biologische Kohlenstoffsenken die Treibhausgasbilanz verbessern können. Der Naturschutz kann also einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Es gibt zahlreiche Naturschutzmaßnahmen, die die Artenvielfalt schützen und naturnahe Lebensräume erhalten oder wiederherstellen und die einzelnen Lebensräume mit ökologischen Korridoren verbinden: Moorschutz und Wiedervernässung, Fließgewässerrenaturierungen, naturnahe Waldbewirtschaftung und Biotopverbundsysteme sind neben der naturschutzfachlichen Bedeutung gleichzeitig wichtige Beiträge zum Klimaschutz. Diese Maßnahmen fördern die Senkenleistung und verhindern die Freisetzung von Kohlenstoff aus Landökosystemen. Zudem wirken sie auch als Schutz vor Naturgefahren: So fungieren beispielsweise Moore auch als natürliche Wasserspeicher, die nahe gelegene Gebiete vor Überschwemmungen schützen können. Falls Flüsse vermehrt Retentionsflächen aufweisen, können sie mehr Wasser zurückhalten und so die Überschwemmungsgefahr vermindern.
Eine der wichtigsten Antworten auf die geänderten Klimabedingungen sollte die Schaffung eines funktionalen Biotopverbundes sein. Damit Tiere und Pflanzen auf diesen Wandel reagieren und neue Standorte zum Überleben finden können, braucht es neue Schutzgebiete und ökologische Korridore, um Wanderungen zu erleichtern bzw. erst zu ermöglichen.
Klimarelevante Naturschutzmaßnahmen müssen sorgfältig geplant und umgesetzt werden, sonst führen gut gemeinte Eingriffe zu Konflikten. Alle Maßnahmen, die den Klimawandel bremsen oder seine Folgen abpuffern sollen, müssen einem Nachhaltigkeits-Check unterworfen werden. Bei Konflikten zwischen Zielen des Klimaschutzes und des Naturschutzes darf nicht einseitig entschieden werden. Jede Maßnahme muss auf ihre ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgewirkungen hin untersucht werden. So kann vermieden werden, dass aus „Gut gemeint“ ein „Schlecht gemacht“ resultiert.
Zu Konflikten kann es beispielsweise in produktiven, gut erschlossenen Wäldern kommen: Soll der wirtschaftliche Aspekt oder die Senkenleistung im Vordergrund stehen? Ein weiteres Problem ist der Ertragsausfall für Land- und Forstwirte, die zugunsten des Naturschutzes auf einen Teil ihrer Erträge oder ihrer Flächen verzichten, wie es etwa bei Biotopverbundsystemen oder bei Moorrenaturierungen der Fall ist. Die derzeitigen finanziellen Fördermöglichkeiten der EU und der Länder bieten noch keine ausreichenden Entschädigungen. Konflikte entstehen auch oft bei der Einrichtung oder Erweiterung von Schutzgebieten, wenn die aktuellen Nutzungen wie z.B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Tourismus eingeschränkt werden und die betroffene Bevölkerung nicht adäquat in die Planungen eingebunden wird.
Ein weiteres Konfliktfeld zwischen Naturschutz und Klimaschutz resultiert, weil die Natur sehr häufig von den Folgewirkungen der Klimamaßnahmen in anderen Sektoren betroffen ist. Zielkonflikte treten nämlich dann auf, wenn beispielsweise extensiv bewirtschaftetes Grünland zur industriellen Biodiesel-Plantage umgenutzt wird; wenn Talbiotope weichen sollen, um einem Stausee zur Stromgewinnung Platz zu machen; wenn Gewässer zum Zwecke des Hochwasserschutzes in ein Beton-Korsett gezwängt werden; oder wenn Schneekanonen den Verlust natürlicher Niederschläge ausgleichen sollen.
Durch den Klimawandel gewinnen die schon seit langem erhobenen Forderungen des Naturschutzes an Bedeutung: Die Arten und Lebensräume müssen besser geschützt und vernetzt werden. Die hierfür nötigen Maßnahmen sind bekannt, sie müssen aber konsequenter, effektiver und auf wesentlich größeren Flächen als bisher umgesetzt werden. Das Wissen ist ausreichend vorhanden, es gibt keinen Grund länger zu warten. Wissenslücken gibt es heute vor allem im Bereich des Monitorings der Klimawirkungen von Naturschutzmaßnahmen. Hier ist mehr Forschung nötig.
Seit Jahrzehnten führt der Bund Naturschutz in Bayern im Alpenraum weitgehend ehrenamtlich Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts degradierter Moore durch. Hierfür wurden Flächen angekauft oder gepachtet, intensive Nutzungsformen beseitigt und insbesondere Anstau-Maßnahmen durchgeführt. Mehr dazu findet sich im Internet unter http://www.cipra.org/de/cc.alps/wettbewerb/moorrenaturierung .
Das Departement Isère setzt sich seit dem Jahr 2000 für die Schaffung eines Netzwerks von rund hundert Schutzgebieten ein. Dank des Know-hows und des Beitrags zahlreicher Naturwissenschaftler und Akteure vor Ort konnten über 400 Problemzonen ausgemacht werden. Es wurde ein kartographisches Dokument erstellt, anhand dessen das ökologische Netzwerk von Isère sichtbar gemacht und die größten Herausforderungen aufgezeigt wurden. Zudem wurden zehn Prioritäten zur Wiederherstellung von Verbindungskorridoren für die Fauna festgelegt. Mehr dazu unter http://www.cipra.org/de/alpmedia/publikationen/3809/ .
Literatur
Klaus, G., Pauli, D. (2009): Biodiversität im Zeichen des globalen Wandels. http://www.kbnl.ch/de/2010.asp .
Rebetez, M. (2009): Was noch nie passiert ist, glaubt man nicht. In: Szene Alpen 92: Im Namen des Klimaschutzes. Internationale Alpenschutzkommission CIPRA, Schaan.
Datenbank mit beispielhaften Klimamaßnahmen: http://www.cipra.org/de/cc.alps/ergebnisse/good-practice . Der vollständige CIPRA compact über Klimawandel und Naturschutz ist unter http://www.cipra.org/de/cc.alps/ergebnisse/compacts zum Download verfügbar.
Anschrift des Verfassers: Mateja Pirc, CIPRA International, Internationale Alpenschutzkommission, Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan, E-Mail mateja.pirc@cipra.org , Internet http://www.cipra.org .
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

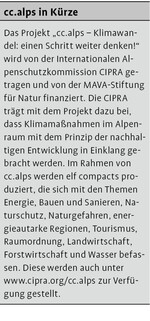
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.