Waldbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels
Abstracts
Durch Befragung von Fachvertretern aus sechs deutschen Bundesländern und Literaturauswertung wurden Synergien und Konfliktpotenziale zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft hinsichtlich Baumartenwahl und Anpassungsstrategien der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel identifiziert.
Die Anpassungspotenziale der Baumarten wurden von beiden Gruppen ähnlich eingeschätzt. Die Fichte (Picea abies) wurde als sehr labil eingestuft. Die Bedeutung der Buche (Fagus sylvatica), Eichen (Quercus spec.), Tanne (Abies alba) und der Gruppe von Edellaubbäumen wird zunehmen. Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) wurde als weitgehend angepasst an die veränderten klimatischen Verhältnisse gesehen.
Bezüglich der Wahl der geeigneten waldbaulichen Anpassungsstrategien herrschte Konsens über die grundsätzliche standörtliche Eignung der heimischen Hauptbaumarten, über Verschiebungen der Baumartenanteile und eines gemischten, strukturierten und stabilen Waldes zur Reduktion und Streuung von Risiken. Unterschiedliche Vorstellungen existierten bezüglich des Anbaus von fremdländischen Baumarten, einer Verkürzung der Produktionszeiträume und der Folgen für Alt- und Totholzstrukturen.
Auch in anderen Punkten zeigten sich innerhalb der beiden Interessengruppen unterschiedliche Sichtweisen. Von den Forstexperten wurde vorwiegend ein auf Anpassung an ein zukünftiges Klima ausgerichteter, „proaktiver“ Waldumbau befürwortet, der sofort begonnen werden sollte. Bei den Naturschutzexperten gab es sowohl Anhänger eines schnellen und eines langsamen Waldumbaus, charakterisiert durch das Zulassen natürlicher Sukzession, bis hin zur Akzeptanz des Zusammenbruchs der heutigen Waldbestände.
Forest Management in Times of Climate Change – Synergies and potential conflicts between forestry and nature conservation
The survey of representatives from six federal states in Germany and a literature review identified synergies as well as potential conflicts between foresters and nature conservationists. Focal points were the selection of tree species and adaptive strategies of forest management to climate change.
The adaptive capabilities of the native tree species were assessed similarly by both groups. Spruce trees (Picea abies) were labelled as labile whilst the prominence of others species such as beech (Fagus sylvatica), oak (Quercus spec.), fir (Abies alba), and valuable broadleaf trees is supposed to increase. It has been noted that the douglas-fir seems to be reasonably adapted to a drier and warmer climate.
Concerning the choice of adaptive strategies for forest management there is consensus on the following points: local native tree species will principally be suitable; there will be shifts in the proportions of tree species; mixed, structured and stabile forests will reduce and pool risks. Different opinions were encountered in respect to the cultivation or usage of exotic tree species, shorter rotation periods, and the amount of deadwood in managed forests.
Both groups have different opinions on how to solve the current situation: Forest experts have promoted a proactive forest conversion which should be adopted immediately. Nature conservationists seem to be split into camps. Partly they have supported faster-paced proactive forest conversions; others have favoured a slow-paced forest conversion steering natural successional processes; and again others have tended to accept a complete breakdown of current tree stands.
- Veröffentlicht am
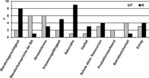
1 Einleitung
Bereits in den 1990er Jahren zeichnete sich in der Diskussion über die künftige Klimaentwicklung ab, dass die starken Veränderungen und wirtschaftlichen Schäden, denen die mitteleuropäischen Wälder unterlagen, möglicherweise keine Folge normaler Witterungsschwankungen darstellen, sondern Resultat eines bereits beginnenden drastischen Klimawandels sein könnten (z.B. Manthey et al. 2007; Posch et al. 1996; Werntze 2009). Spätestens seit dem 3. Bericht des IPCC (2001) beeinflusst diese Sichtweise zunehmend das Handeln der Forstleute und hatte zur Konsequenz, dass sich die Zielsetzungen der ökologischen Forschung verlagerten. Modellierungen künftiger regionaler Klimazustände gewannen an Bedeutung, beispielsweise in den Projekten einzelner Bundesländer wie „KlimLandRP“ oder „KLIWA“ oder in „WETTREG“, einem Regionalisierungsmodell des Umweltbundesamtes. Szenarien der Standortsveränderungen und deren ökologische und ökonomische Auswirkungen wurden erarbeitet (z.B. Kölling 2007). All dies beeinflusst heute die forstliche, naturschutzorientierte und gesellschaftspolitische Diskussion über Art und Ausmaß von bereits jetzt zu treffenden Maßnahmen, um die Wälder vorausschauend „klimastabil“ zu entwickeln (Bolte & Ibisch 2007, Jenssen et al. 2007, Kölling et al. 2009 und 2010, Korn et al. 2005).
Die zunehmende Wahrnehmung des sich ändernden Klimas hat inzwischen der Debatte über adaptive Maßnahmen im Wald eine neue Dimension verliehen (Bolte et al. 2009). Insbesondere Überlegungen zur gezielteren Auswahl fremdländischer Herkünfte und Baumarten eröffneten Perspektiven (Schmiedinger et al. 2010), die über die Ansätze der Bestandesstabilisierung durch naturnahe Waldwirtschaft hinausgehen.
Die klimatischen Veränderungen in den letzten Jahren werden auch von vielen Naturschützern mit Sorge gesehen (Heiland & Kowarik 2008). Viele Ansätze zum pragmatischen Umgang mit den sich als unausweichlich abzeichnenden Folgen werden von ihnen jedoch mit Misstrauen betrachtet oder gar abgelehnt (z.B. Straussberger & Weiger 2009).
Momentan wird international wie auch national sehr stark an Anpassungsstrategien der verschiedenen Sektoren gearbeitet (BMU 2008, Seppälä et al. 2009, Thompson et al. 2009). Daher erscheint es wichtig, bereits vor Beginn von umfangreichen Umsetzungen der verschiedenen Anpassungsstrategien die geplanten bzw. bereits praktizierten Maßnahmen zu Baumartenwahl und Waldumbau zu analysieren. Ziel dieses Beitrags ist es daher, die Konfliktpunkte und Synergiepotenziale zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz herauszuarbeiten, Wissensdefizite zu identifizieren und Ansätze für partizipativ erarbeitete, konsensfähige Lösungen aufzuzeigen. Entsprechende Ziele hat sich die hier dokumentierte, vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit finanzierte Studie (FKZ 350884) gesetzt (Reif et al. 2010).
2 Methode
Grundlage dieses Beitrags ist die Analyse der Meinungen von 28 Experten hinsichtlich des Themenfeldes Wald und Klimaänderung. 14 Vertreter der Forstwissenschaft und -wirtschaft sowie 14 Personen des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachen, Rheinland-Pfalz und Sachsen wurden befragt. Die Bundesländer wurden so ausgewählt, dass einerseits eine möglichst große Anzahl von verschiedenen waldökologischen Naturräumen innerhalb Deutschlands abgebildet wurde und gleichzeitig ein großer Teil der Waldfläche repräsentiert war. Die Experten wurden auf unsere Anfrage von den staatlichen Forst- und Naturschutzverwaltungen sowie Nicht-Regierungsorganisationen wie NABU, BUND sowie Naturschutzbeauftragten benannt. Die Interviews wurden in Form von halbstrukturierten Leitfadeninterviews durchgeführt. Zentrale Fragen im Bezug auf den Wald waren die Einschätzung (1) des Ausmaßes der zu erwartenden Klimaänderung; (2) der künftigen Baumarteneignung, Baumartenwahl; (3) der waldbaulichen Behandlungsstrategien, von der man sich die gewünschte Anpassung erwartet, einschließlich bereits heute erfolgender Umsetzungsmaßnahmen; sowie (4) der Frage, welche Konfliktfelder gesehen werden.
3 Annahmen zum Klimawandel
Während die überwiegende Zahl der Vertreter der Forstwirtschaft und -wissenschaft in Anlehnung an das Emissionsszenario B1 (IPCC 2001, IPCC 2007) eine Temperaturzunahme um + 2 °C als handlungsleitende Bezugsbasis annahm, äußerten sich die Vertreter des Naturschutzes eher indifferent. Sie erachteten verschiedene Szenarien für möglich oder hielten sich mit Angaben zurück. Wenige Forstexperten zogen auch andere, weniger moderate Szenarien (A2, A1FI) in Erwägung.
Sowohl die Vertreter der Forstwirtschaft als auch des Naturschutzes rechnen damit, dass durch die zu erwartende klimatische Veränderung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Extremereignissen wie Trockenheit, Sturm, Schädlingskalamitäten und Starkregen zunehmen und es in Folge dessen zu Verschiebungen der Baumartenanteile kommen wird.
4 Eignung der Baumarten
Die Angepasstheit der Baumarten an abiotische Faktoren (Standortsgerechtigkeit, Standortsansprüche, Stresstoleranz) wird von beiden befragten Gruppen als zentrales Kriterium zur Bestimmung der Baumarteneignung gesehen. Vor allem von Naturschutzseite wird die Natürlichkeit des Vorkommens bzw. heimische Herkunft und die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Umweltbedingungen gefordert. Wirtschaftliche Überlegungen wie Produktionsaufwand, Betriebssicherheit oder Ertrag wurden von beiden Gruppen seltener benannt (Abb. 1).
Hinsichtlich der Anpassungspotenziale der Baumarten wurden von beiden Gruppen ähnliche Vermutungen geäußert:
Die Baumart Fichte (Picea abies) wurde als äußerst anfällig gegenüber klimatischen Veränderungen eingestuft und wird daher, nach Meinung der Experten, insbesondere auf (wechsel-)trockenen Böden in den Tieflagen große Flächenanteile verlieren.
Buche (Fagus sylvatica) und Eichen (Quercus spec.) werden als die „Gewinner“ des Klimawandels gesehen, wobei einige Forstexperten vor Risiken warnen (Trockenheit bei Buche, Abb. 2; biotische Schadrisiken und Wildverbiss bei Eichen).
Der Tanne (Abies alba) wird laut Expertenmeinung in ihrem Verbreitungsgebiet eine größere Bedeutung zukommen.
Edellaubbäume wurden von beiden Gruppen als wichtige Baumarten für die zukünftige Waldbewirtschaftung eingeordnet.
Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) wurde von einer großen Mehrheit beider Expertengruppen als eine Baumart eingeschätzt, welche mit den sich verändernden klimatischen Verhältnissen zurechtkommen wird, wenngleich sie als fremdländische Baumart aus naturschutzfachlicher Sicht vielfach nicht erwünscht ist.
Die künftige Bedeutung der Kiefer (Pinus sylvestris) wurde vor allem von den Forstexperten unterschiedlich bewertet. Insbesondere süddeutsche Waldökologen beurteilten die Standortseignung der Kiefer in sommerwarmen Tieflagen kritisch (vgl. Walentowski et al. 2007). Die Naturschutzexperten schätzten die Kiefer überwiegend als künftig angepasst ein.
Provenienzen heimischer Baumarten aus wärmeren oder trockeneren Ländern Europas werden vor allem von Forstexperten als Option für den Aufbau angepasster Wälder gesehen. Dabei sollen wissenschaftlich begleitete Versuchsanbauten wichtige Erkenntnisse über die jeweilige Eignung erbringen.
5 Waldbauliche Anpassungsstrategien
Durch die Wahl geeigneter Baumarten und Provenienzen sollen stabile und an Erwärmung und Trockenheit angepasste Wälder erzogen werden. Bereits heute müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Anpassungsfähigkeit bestehender Wälder mit der aktuellen Artenzusammensetzung gegenüber klimabedingten Stressoren und Störungen zu erhöhen. Folgende denkbare waldbauliche Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an eine Klimaänderung wurden von den Experten genannt (Abb. 3):
Erhöhung der Stabilität von Einzelbäumen und Beständen,
Schaffung und Erhalt von Mischbeständen,
Schaffung und Erhalt von vielfältiger Waldstruktur (horizontal und vertikal),
Auswahl und Förderung geeigneter Baumarten und Provenienzen,
Waldumbau/Baumarten-Wechsel,
Verwendung geeigneter Verjüngungsverfahren,
Veränderung der Produktionszeit/Umtriebszeit,
Erhaltung und Förderung der Walddynamik/natürlicher Prozesse,
Erhaltung und Förderung des naturnahen Waldbaus/ Dauerwald,
Erhaltung von Wasser- und Nährstoffkreisläufen, schonender Umgang mit den Ressourcen Boden und Grundwasser.
Bei der Betrachtung der genannten Maßnahmen ist festzustellen, dass beide Interessensgruppen die Zielvorstellung eines gemischten, reich strukturierten (ungleichaltrigen) und stabilen Waldes verfolgen. Dessen Bewirtschaftung soll nach den Grundsätzen einer naturnahen Waldwirtschaft erfolgen. Wälder, die diesen Zustand erst noch erreichen müssen, sind durch Waldumbau- und Überführungsmaßnahmen auf dieses Ziel hin zu entwickeln. Das Verjüngungsverfahren (Naturverjüngung, Pflanzung) richtet sich nach der Baumartenzusammensetzung des Vorbestandes. Abiotische Ressourcen sollten bei der Bewirtschaftung geschont, Wilddichten angepasst werden.
Unterschiedliche Auffassungen können vor allem hinsichtlich des Anbaus von fremdländischen Baumarten und einer Veränderung der Produktionszeiträume gesehen werden. Während Forstleute fremdländische Arten in künftigen Mischwäldern eher akzeptieren, bevorzugte eine Mehrheit von Naturschutzexperten geeignete standortsheimische oder heimische Baumarten. Die Resistenz von Beständen soll nach Ansicht von Forstexperten durch Verkürzung der Produktionszeiten erhöht werden. Naturschützer dagegen fordern aus Artenschutzgründen ein möglichst hohes Baum- und Bestandesalter.
Bezüglich der zeitlichen Umsetzung waldbaulicher Anpassungsstrategien gibt es unter den Naturschutzvertretern sowohl Anhänger eines schnellen und eines langsamen Waldumbaus als auch des Zulassens von natürlicher Sukzession. Die Forstvertreter sind sich dagegen einig, dass bereits jetzt mit dem Waldumbau begonnen werden muss.
6 Gemeinsame und unterschiedliche Sichtweisen von Forstwirtschaft und Naturschutz
Bei der Analyse der Experteninterviews wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz deutlich (Tab. 1).
6.1 Gemeinsame Sichtweisen
Die Angepasstheit der Baumarten an die jeweiligen Umweltbedingungen eines Standortes einschließlich seiner klimatischen Witterungsextreme muss in Zukunft bei der Baumartenwahl eine zentrale Rolle einnehmen.
Insgesamt herrscht, unter Annahme einer künftigen Klimaänderung, Konsens über die grundsätzliche standörtliche Eignung der heimischen Hauptbaumarten. Es herrscht auch Einigkeit darüber, dass es zu Verschiebungen der Baumartenanteile kommen wird und muss. Die einheitlich positive Einschätzung des Potenzials der Buche überrascht, da deren Zukunft kontrovers diskutiert wird (Ammer et al. 2005, Rennenberg et al. 2004) und in warm-trockenen Regionen von vielen Autoren als kritisch eingeschätzt wird (z.B. Manthey et al. 2007).
Gemeinsam ist beiden Interessensgruppen die Zielvorstellung eines gemischten, reich strukturierten (ungleichaltrigen) und stabilen Waldes, welcher der Risikominimierung und Risikostreuung dienen soll. Die Bewirtschaftung soll sich nach den Grundsätzen einer naturnahen Waldwirtschaft richten.
6.2 Unterschiedliche Sichtweisen und Konfliktfelder
Unstimmigkeiten in der Wahl der waldbaulichen Anpassungsstrategien an einen zu erwartenden Klimawandel herrschen vor allem hinsichtlich des Anbaus fremdländischer und der aus wärmeren Klimaten stammenden Herkünfte einheimischer Baumarten. Während Forstleute fremdländische Arten und auch fremdländische Provenienzen heimischer Baumarten stärker akzeptierten, bevorzugte eine Mehrheit von Naturschutzexperten ganz eindeutig geeignete standortsheimische oder heimische Baumarten, was mit einer vermehrten Naturnähe in der Waldwirtschaft begründet wird. Befürchtet werden die Verdrängung der heimischen Arten durch fremdländische Baumarten, die sich einbürgern, ausbreiten und einheimische Arten dadurch gefährden, sowie ein Verlust an Biodiversität durch fehlende Einpassung der Neophyten in bestehende Biozönosen.
Unterschiedlich sind die Ansichten über eine Veränderung der Produktionszeiträume. Nach Ansicht von Forstexperten soll die Resistenz von Beständen durch Verkürzung der Produktionszeiten erhöht werden. Naturschützer dagegen fordern ein möglichst hohes Baum- und Bestandesalter.
Aus naturschutzfachlicher Sicht wurde befürchtet, dass durch waldbauliche Anpassungsstrategien ein Verlust von Alt- und Totholzstrukturen einhergeht. Von Seiten der Forstwirtschaft fand diese Überlegung keine Berücksichtigung.
Neben Unterschieden hinsichtlich des Umgangs mit den Folgen des Klimawandels bekommen drei bereits bestehende Differenzen eine neue Dimension:
Verschieden sind die Ansichten über die Bewirtschaftung in Schutzgebieten. Besonders kontrovers diskutiert wird darüber, wie hoch Aufwand und Intensität bei forstlich-pflegerischen Eingriffen mit dem Ziel des Erhalts der Habitatqualitäten sein sollen. Während der Naturschutz in Schutzgebieten einen „guten ökologischen Zustand“ erhalten oder schaffen will, weisen die Forstexperten angesichts des Klimawandels auf die Probleme eines zu „statischen Naturschutzes“ in vielen Schutzgebieten hin und betonen die Notwendigkeit, natürliche Entwicklungen der Verschiebungen der Baumartenanteile zulassen zu dürfen. Aktuelles Beispiel hierfür ist die Verpflichtung des Erhalts der Eiche in buchengeprägten Natura 2000-Gebieten („Verschlechterungsverbot“). Diese lichtliebende Baumart kann auf vielen Standorten nur durch gezielte Eingriffe künftig erhalten werden. Dies wird insbesondere von Forstexperten als Problem gesehen. Um Anpassungen der Baumartenzusammensetzung an veränderte Umweltbedingungen zu ermöglichen, welche den Waldlebensraum stark verändern werden, müssten nach Ansicht der Forstexperten die Zielsysteme überarbeitet werden. Auch Bewirtschaftungsauflagen müssten „auf das Notwendige reduziert“ werden.
Ebenfalls verschieden sind die Ansichten hinsichtlich der Walddynamik in Wirtschaftswäldern außerhalb von Schutzgebieten. Einige Naturschutzvertreter fordern mehr Integration von eigendynamischen Prozessen in die Waldbewirtschaftung zur Anpassung an die klimatischen Änderungen (Sukzessionen, Prozessschutzflächen, Totholz, Altholzinseln). Dies wird von forstlicher Seite oftmals als nicht zielführend abgelehnt, da eine nachhaltige Bewirtschaftung die Nutzung der klimaneutralen Ressource Holz ermöglicht und den Arten- und Strukturreichtum fördert.
Ein weiteres Konfliktpotenzial besteht im Umgang mit politischen Rahmenbedingungen, in welche die Waldbewirtschaftung eingebettet ist. Nach Ansicht des Naturschutzes führen insbesondere ein erhöhter ökonomischer Druck auf die Ertragsleistung der Wälder und die Folgen der Forstreformen in einigen Bundesländern (Umstrukturierungen der Verwaltung, Reduzierung des Personals, Vergrößerung der Zuständigkeitsbereiche der Revierförster) zu Fehlentwicklungen. Insbesondere würden die Grundsätze der naturnahen Waldwirtschaft nicht in ihrem Sinne angemessen auf der ganzen Fläche umgesetzt werden können. Derartige Befürchtungen wurden von Seiten der Forstleute nicht thematisiert.
6.3 Unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der beiden Interessengruppen
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass weder „die Forstwirtschaft“ noch „der Naturschutz“ als „monolithischer“ Block zu betrachten sind. In einigen Punkten zeigten sich auch innerhalb der beiden Gruppen unterschiedliche Sichtweisen.
Innerhalb der Forstverwaltungen/-betriebe der Länder wurden Unterschiede in der bereits erfolgenden Umsetzung waldbaulicher Anpassungsstrategien erkennbar. Es kann unterschieden werden zwischen einer derzeitigen Umsetzung bzw. Planung einer gerichteten „klimaspezifischen“ Anpassung und einem Waldumbau, welcher eine ungerichtete „klimaunspezifische“ Risikominimierung darstellt. Insgesamt betonten die Forstexperten, dass die in allen Ländern praktizierte ökologische und naturnahe Waldbewirtschaftung in ihren Grundsätzen geeignete Maßnahmen für „klimaspezifische“ Anpassungsstrategien beinhalten würde.
Innerhalb des Naturschutzes reicht die Tolerierung des Anbaus fremdländischer Provenienzen heimischer Baumarten von einer vorbehaltlosen Akzeptanz einer solchen potenziellen Anpassungsmaßnahme bis zur strikten Ablehnung. Ähnlich verhält es sich mit der Sichtweise gegenüber fremdländischen Baumarten. So tolerieren einige Naturschutzexperten unter der Annahme eines sich ändernden Klimas den Anbau fremdländischer Baumarten in mehr oder weniger geringen Mischungsanteilen und/oder außerhalb von Schutzgebieten, andere lehnen das konsequent ab. Unterschiedliche Vorstellungen existieren auch bezüglich der Umsetzung waldbaulicher Anpassungsstrategien. Es gab sowohl Anhänger eines schnellen Waldumbaus (aufgrund eines hohen Nadelholzanteils), eines vorsichtigen, langsamen Waldumbaus wie auch des Zulassens von natürlicher Sukzession bis hin zum Akzeptieren des Zusammenbruchs der heutigen Waldbestände.
7 Fazit
Die Analyse der Sichtweisen der beiden Expertengruppen zeigt, dass sowohl Gemeinsamkeiten wie auch Interessenskonflikte in Bezug auf die Anpassung der Wälder an den Klimawandel bestehen. Die aus den unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen hervorgerufenen Spannungen werden nicht zwingend durch geplante oder bereits durchgeführte Anpassungsmaßnahmen an einen Klimawandel verursacht. Sie beruhen vielmehr auf bereits vorhandenen Interessensunterschieden, können aber in Folge der sich ändernden Klimabedingungen verschärft werden (z.B. Länge der Produktionszeiten, Anteil fremdländischer Baumarten).
Die Hinwendung zu mehr (Laub-)Mischwäldern, welche naturnah bewirtschaftet werden, wie dieses von Seiten des Naturschutzes gefordert und von der Forstwirtschaft seit einigen Jahrzehnten verstärkt praktiziert wird, wird unter der Annahme eines Klimawandels konsequent, teilweise mit hoher Priorität fortgesetzt.
Zentral im Dialog zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz über Anpassungsstrategien der Wälder an sich verändernde Umweltbedingungen ist eine transparente, sachliche, für alle Beteiligten klare Darlegung der Sichtweisen und Wertesysteme. Unterschiedliche Standpunkte und Einschätzungen der Beteiligten zeigen, dass es umfangreicher Forschungsanstrengungen bedarf, um nachhaltige, konsensfähige Anpassungsstrategien zu entwickeln. Dies ist nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit lösbar.
Dank
Wir bedanken uns bei Dr. Anke Höltermann und Dipl.-Forstwirt Markus Roehling vom Bundesamt für Naturschutz für die sehr gute Zusammenarbeit, bei den befragten Experten für ihre Mithilfe und Geduld und bei den anonymen Gutachtern für die gründliche und hilfreiche Revision des Manuskripts.
Literatur
Ammer, C., Albrecht, L., Borchert, H., Brosinger, F., Dittmar, C., Elling, W., Ewald, J., Felbermeier, B., Gilsa, H. von, Huss, J., Kenk, G., Kölling, C., Kohnle, U., Meyer, P., Mosandl, R., Moosmayer, H.U., Palmer, S., Reif, A., Rehfuss, K.E., Stimm, B. (2005): Zur Zukunft der Buche (Fagus sylvatica L.) in Mitteleuropa – kritische Anmerkungen zu einem Beitrag von Rennenberg et al. (2004). AFJZ 176, 60-67
BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2008): Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008 beschlossen. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/das_gesamt_bf.pdf
Bolte, A., Eisenhauer, D.-R., Ehrhart, H.-P., Gross, J., Hanewinkel, M., Kölling, C., Profft, I., Rohde, M., Röhe, P., Amereller, K. (2009): Klimawandel und Forstwirtschaft – Übereinstimmungen und Unterschiede bei der Einschätzung der Anpassungsnotwendigkeiten und Anpassungsstrategien der Bundesländer. Landbauforschung . vTI Agriculture and Forestry Research 59 (4), 269-278.
–, Ibisch, P. (2007): Neun Thesen zu Klimawandel, Waldbau und Naturschutz. AFZ/Der Wald 11, 572-576.
Heiland, S., Kowarik, I. (2008): Anpassungserfordernisse des Naturschutzes und seiner Instrumente an den Klimawandel und dessen Folgewirkungen. Informationen zur Raumentwicklung 6/7, 415-422.
IPCC (2001): Climate Change 2001: Working Group III. Mitigation. Summary for Policymakers, Intergovernmental Panel on Climate Change.
– (2007): Climate Change 2007: Working Group I. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers, Intergovernmental Panel on Climate Change.
Jenssen, M., Hofmann, G., Pommer, U. (2007): Die natürlichen Vegetationspotentiale Brandenburgs als Grundlage klimaplastischer Zukunftswälder. Beiträge zur Gehölzkunde, 17-29.
Kölling, C. (2007): Klimahüllen für 27 Waldbaumarten. AFZ-Der Wald 23, 1242-1245.
–, Bachmann, M., Falk, W., Grünert, S., Schaller, R., Tretter, S., Wilhelm, G. (2009): Klima-Risikokarten für heute und morgen. Der klimagerechte Waldumbau bekommt vorläufige Planungsunterlagen. LWF Wissen 63, 31-39.
–, Beinhofer, B., Hahn, A., Knoke, Th. (2010): „Wer streut, rutscht nicht“. Wie soll die Forstwirtschaft auf neue Risiken im Klimawandel reagieren? AFZ-Der Wald 5, 18-22.
Korn, H., Schliep, R., Stadler, J. (Hrsg., 2005): Biodiversität und Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland. Ergebnisse und Dokumentation des Auftaktworkshops. BfN-Skripten 131, 77 S.
Manthey, M., Leuschner, C., Härdtle, W. (2007): Buchenwälder und Klimawandel. Natur und Landschaft 9/10, 441-445.
Posch, M., Hettelingh, J.-P., Alcamo, J., Krool, M. (1996): Integrated scenarios of acidification and climate change in Asia and Europe. Global Environmental Change 6, 375-394.
Reif, A., Brucker, U., Kratzer, R., Schmiedinger, A., Bauhus, J. (2010, im Druck): Waldbau und Baumartenwahl in Zeiten des Klimawandels aus Sicht des Naturschutzes. BfN-Skripten.
Rennenberg, H., Seiler, W., Matyssek, R., Gessler, A., Kreuzwieser, J. (2004): Die Buche (Fagus sylvatica L.) – ein Waldbaum ohne Zukunft im südlichen Mitteleuropa? Allg. Forst- und Jagdzeitung 175, 210- 224.
Schmiedinger, A., Bachmann, M., Kölling, C., Schirmer, R. (2010): Gastbaumarten für Bayern gesucht. Wissenschaftler entwickelten ein Verfahren zur Auswahl klimagerechter Baumarten für Anbauversuche. LWF aktuell 74, 47-51.
Seppälä, R., Buck, A., Katila, P. (Hrsg., 2009): Adaptation of forests and people to climate change- A global assessment report. IUFRO World Series 22, 224 S.
Straussberger, R., Weiger, H. (2009): Rückblick 2008: Viel Schatten – wenig Licht. Über den Schutz der Wald – Biodiversität in Zeiten des Klimawandels. Der kritische Agrarbericht 2009, 193-198.
Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., Mosseler, A. (2009): Forest Resilience, Biodiversity, and Climate Change. A synthesis of the biodiversity/resilience/stability relationship in forest ecosystems. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series no. 43, 1-67.
Walentowski, H., Kölling, C., Ewald, J. (2007): Die Waldkiefer – bereit für den Klimawandel? LWF Wissen 57 37-46.
Werntze, A. (2009): Klimawandel und nachhaltige Waldwirtschaft. In: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Hrsg., In Sachen Klimawandel, Leipzig, 20-21.
Anschrift der Verfasser(innen): Prof. Dr. Dr. h.c. Albert Reif, Prof. Dr. Jürgen Bauhus, Ulrike Brucker und Raffael Kratzer, Waldbau-Institut, Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, D-79085 Freiburg, E-Mail albert.reif@waldbau.uni-freiburg.de , juergen.bauhus@waldbau.uni-freiburg.de , ulrike.brucker@waldbau.uni-freiburg.de bzw. raffael.kratzer@waldbau.uni-freiburg.de ; Andreas Schmiedinger, AgroBIOL, Naturverträgliche Pflege- und Entwicklungskonzepte, Grenzhammer 16, D-95485 Warmensteinach, E-Mail info@agrobiol.de .
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.