Das Dachauer Moos
Am Nordrand des mächtigen, wasserdurchlässigen Schotterkörpers der Münchner Schotterebene tritt das Grundwasser zutage und schuf im Laufe der Jahrtausende Bayerns ursprünglich größtes Moorgebiet, das Dachauer- und das Erdinger Moos, beide unterteilt durch das Isartal. Dem Dachauer Moos hat nun der gleichnamige Verein anlässlich seines fünfundzwangzigjährigen Bestehens ein sehr gelungenes Buch gewidmet.
- Veröffentlicht am
Der Autor Stefan Gerstorfer spannt auf 243 Seiten einen solide recherchierten, brilliant illustrierten und verständlich geschriebenen Bogen über eine breite Palette von Themen. Die landschaftliche Eigenart, die den Landstrich und seine Menschen einst formte, ist der rote Faden, der sich durch die Kapitel zieht. Berichtet wird von der Entstehung nach der Eiszeit und den jahrhundertelangen Versuchen, dem kargen Landstrich einen Lebensunterhalt abzutrotzen. Wie so viele Prozesse, die unsere Zivilisation heute prägen, waren die Versuche zunächst vor allem von Mühsal und weniger Erfolg gekrönt, und gewannen erst im Laufe der Zeit an einer Dynamik, die heute kaum umkehrbar scheint. Was mit mangels Nachfrage verschenktem Brenntorf, Streuwiesennutzung und Torfstecherei für die Brauereien begann, führte über den Einsatz von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und Arbeitsdiensten sowie staatlichen Moorversuchsgütern schließlich zum Ergebnis eines komplett kultivierten Moores. Spätestens mit dem Bau der Autobahn und der Regattastrecke für die Olympischen Spiele 1972 wurden die Veränderungen unumkehrbar. Heute sind 80% des Dachauer Mooses ackerbaulich genutzt, die Moorböden auf großer Fläche weitgehend abgetorft, oder aber gesackt, verpufft und vererdet. Heute sind vor allem jene wenigen Bereiche noch in einem besseren Erhaltungszustand, in denen, meist als Ausgleichsflächen für verschiedene Eingriffe in die Landschaft, wegen günstiger Ausgangslage auch relativ kleinräumig Maßnahmen durchgeführt werden können. Doch der tiefgradig abgesenkte Grundwasserspiegel und die reichlich vorhandene Infrastruktur setzen auf dem Großteil der Fläche dem Moorschutz im ursprünglich größten Moorgebiet Bayerns enge und stellenweise sehr enge Grenzen.
Dass das Dachauer Moos ursprünglich wohl eine neben den Offenen Mooren vor allem auch von undurchdringlichen Wäldern durchsetzte Landschaft war, beschrieb die Moorforscherin Selma Ruoff in den 1920 Jahren basierend auf Quellen, die 600 Jahre zurückreichen. Dieser Vegetationstypus, am schönsten erhalten im Moorbirken-Moorwald bei Gröbenzell und – viel bekannter als voriger – im Schwarzhölzl, kommt in dem Buch leider sehr kurz. Ebenso wie die eigentümliche Schönheit, die gerade die Moorbirkenwälder den naturnäheren Resten des Dachauer Mooses heute noch geben. Auch zu den nachgewiesenen wirbellosen Tierarten, Moosen und Pilzen hätte man sich noch etwas mehr Information gewünscht, vielleicht eine Artenliste, wie bei den Gefäßpflanzen. Das vor allem als bilderstarkes Lesebuch mit informativen Karten konzipierte Werk überzeugt dennoch in Konzeption und Inhalt voll und ganz. Aktuelle Forschungsarbeiten von LWF und TUM in den Moorbirkenwäldern der Moore am Nordrand der Schotterebene können als Grundlage dienen, zu diesen mehr Informationen bereitzustellen.
Stefan Gerstorfer zeigt auf, welche Bemühungen der Verein Dachauer Moos, getragen von elf Kommunen, die seine Mitglieder sind, unternimmt und was getan werden kann, um den Moorschutz auch im Dachauer Moos an weiteren Stellen zu stärken. Das Buch, wie auch der Verein unter seinem Geschäftsführer Robert Rossa, sind Aushängeschilder für diese Arbeit. Ihrem auf Information, Offenheit und Zusammenarbeit setzenden Ansatz ist viel Erfolg für die nächsten 25 Jahre zu wünschen, und den zwischenzeitlichen Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Moor begleiten zu können: früher, als es noch intakt war, versuchte man mit allen Mitteln, das Moor nutzbar zu machen. Heute, wo es in jeder Hinsicht nutzbar geworden ist, versucht man, es zumindest auch in Teilen wiederherzustellen.
Das Buch ist leider nicht käuflich erhältlich, sondern wird nur auf speziellen Anlass von der Geschäftsstelle des Vereins zur Verfügung gestellt. Das sollte aber nicht davon abhalten, bei Interesse dort nachzufragen.
Kontaktinformationen unter: www.verein-dachauer-moos.de

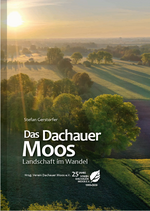
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.