Waldkrise 2021
„Der Holzweg – Wald im Widerstreit der Interessen“ ist das Buch zur Forstkrise im Klimawandel. Es gibt Antworten auf die Fragen von Berthold Brecht: „Weißt Du, was ein Wald ist? Ist ein Wald etwa nur zehntausend Klafter Holz? Oder ist er eine grüne Menschenfreude?“
- Veröffentlicht am
Die Deutschen lieben ihren Wald, obwohl er meist aus gezähmten Kulturforsten besteht. Gerade zerstört eine Holzmafia wilde Urwälder in Rumänien, und die EU schaut zu. Die letzten Primärwälder Europas werden vernichtet, und wir sehen eine Katastrophe darin, dass Borkenkäfer unsere naturfernen Nadelbaum-Monokulturen auffressen? Sicher – ein ökonomischer Schaden, aber ökologisch der Versuch einer Heilung.
Die Natur ist laut Goethe „ein lebendiges Buch“, doch die deutsche Forstpolitik und ihr wissenschaftlicher Beirat können es nicht lesen, wie ihre naturferne „Waldstrategie 2050“ gerade gezeigt hat. Das streitbare Buch „Der Holzweg“ von 36 AutorInnen bietet alternative Eckpunkte für eine naturfreundliche Strategie. Zwei Naturschutz-Experten und ein Öko-Forstwirt haben das Sammelwerk herausgegeben. Der Biologe Prof. Dr. Hans Dieter Knapp leitete die Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz auf der Insel Vilm. Der Biologe Dr. Siegfried Klaus begleitete die Nationalparkentstehung Hainich. Der Forstwirt Dr. Lutz Fähser begründete das Lübecker Konzept der naturnahen Waldnutzung, das mit minimalen Eingriffen mehr Erträge erwirtschaftet als konventioneller Forst. Dieses Konzept „Ökonomie durch Ökologie“ mit dem Zertifikat „Naturland“ fand Nachahmer bei Gemeinden, z. B. Berlin, Bonn, Göttingen, Saarbrücken und Wiesbaden, leider nicht beim Staatsforst.
2007 hatte sich die Bundesregierung in ihrer Biodiversitätsstrategie ein Ziel gesetzt: Bis 2020 sollte 5 % des deutschen Waldes aus der Nutzung genommen werden, im Staatswald sogar 10 %. Ergebnis 2021: Nur knapp 3 % des deutschen Waldes darf Wildnis werden. Wird unser Wald mit der Klimaerwärmung und den technokratischen Forststrategien im Desaster enden, oder werden Waldfreunde und ÖkologInnen mit dem Buch „Der Holzweg“ die Forstpolitik zu einem Paradigmenwechsel zwingen?
Wer sich einliest in das schön bebilderte 477-Seiten-Werk, ist begeistert von der Fakten- und Themenfülle und den fachlich fundierten Analysen, aber man kann auch wütend werden! – Denn der beschriebene Holzweg scheint der Mainstream im amtlichen und wissenschaftlichen Forst zu sein und kann ökologisch nur in die Irre führen. Es geht um die Fragen: Soll der deutsche Wald vor allem Holz und Gewinn machen und darf die Fortwirtschaft deshalb sogar in Naturschutz- und NATURA-2000-Gebieten – z. B. in den letzten Auwäldern am Rhein – tun und lassen was sie will? Oder muss der Forst als Ganzes als Naturwald bewirtschaftet werden, um ihn ökologisch zu retten und ökonomisch zu sanieren?
Der deutsche Forst erzählt gerne die Legende, er habe die Nachhaltigkeit erfunden. Denn es werde immer nur so viel Holz gefällt wie nachwachse. Die Frage ist, was da wächst. Es sind Kunstforste, nachwachsende Rohstoffe vom Typus www.langweiliger-wald.de, die den wilden Tieren und Pflanzen nur sehr verarmte Biotope bieten. Das komplexe Ökosystem Wald, das die Naturwissenschaft nur ansatzweise versteht, versucht sich auch im Forst immer wieder durchzusetzen. Wenn es das tut, wird es meist missverstanden. Die letzten Hitzesommer haben die Bäume geschwächt und Borkenkäfer gestärkt, doch großflächig abgestorben sind keine Naturwälder.
Trotzdem verfällt die Forstpolitik jetzt in Aktionismus. Ein Milliarden-Euro-Hilfsprogramm wurde aufgelegt. Die abgestorbenen Plantagen werden mit schweren Maschinen großflächig kahlgeschlagen und aufgeforstet. Wer im Wald Bäume pflanzt, will keinen Naturwald. Freie Entwicklung über Gebüsche und Pionierwald aus Haseln, Birken, Espen und Weiden wird kaum erlaubt, weil es keinen schnellen Profit bringt. Aber die Salweide bringt für Insekten Profit, z. B. als Bienenhotel im Vorfrühling und als Futterpflanze der Raupen des Großen Schillerfalters.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) trägt den Wald weder im Titel noch im Herzen. Es fördert nur Forst und dort agrarindustrielle technische Maßnahmen. Das Ziel ist Holz, und den Naturschutz erledigt man in kollateralen Adjektiven nebenbei. Das erklärt das BMEL so herrlich unverhohlen in seiner kleinen Waldfibel für Eltern und Kinder: „Der Wald der Zukunft soll dauerhaft ein naturnaher, artenreicher und vitaler Lieferant des wichtigen Rohstoffs Holz sein.“ Kein Wunder, dass die Waldfibel als erste Baumart die Fichte vorstellt, dass die Salweide fehlt und die zugehörige App fürs Handy die Eiche mit der Kiefer verwechselt.
Aktuell vergießen Forstpolitiker Krokodilstränen, weil die Dürresommer auf Grenzstandorten selbst der Buche geschadet haben. Dabei darf fast keine Buche im Forst ihr natürliches Alter erreichen. Manche Forstschulen singen nun ihren Abgesang und fordern Ersatz durch noch mehr Exoten aus aller Welt. Quo vadis – Forstwirtschaft? Gerade holt sie die alten Knüppel aus dem Sack, um mit der neuen Krise fertig zu werden. Sie will künstlich klimastabile Wälder erzeugen. Mutter Natur und ihren evolutiven Anpassungsprozessen trauen Forstmänner wenig zu. Lieber wird mit Hubschrauber gekalkt, werden Pestizide verspritzt, z. B. tonnenweise das Total-Insektizid „Karate Forst Flüssig“ gegen Nonnenfalter in Brandenburgs Kiefern-Monokulturen, bis ein Gericht den Umweltfrevel stoppte. Die Bäume werden weiter mit industriellen Techniken gefällt und die Böden durch schwere Maschinen verdichtet. Es werden breite Forstwege in den Wald geschlagen, wo die Sonne noch besser hineinknallt und Starkregen Erde abschwemmen kann.
Die deutsche Forstwirtschaft war in den 80er Jahren etwas vom strengen Holzweg abgekommen, hatte nach dem Waldsterben infolge Luftverschmutzung und durch den Druck der Umweltbewegung naturgemäßer gewirtschaftet. Horst Sterns Sammelwerk „Rettet den Wald“ von 1979 hatte dazu beigetragen. Von den damaligen Autoren ist im neuen Buch „Der Holzweg“ noch einer dabei, Hans Bibelriether mit einem Kapitel „Natur Natur sein lassen“.
Unser Forst hat den Kahlschlag durch den Schirmschlag ersetzt. Dabei wird Buchen-Hochwald immer weiter aufgelichtet, damit die jungen Bäume schneller wachsen (viel zu schnell, weiß der Leser, der bei Wohlleben aufgepasst hat), bis der Schwarzspecht seinen Höhlenbaum verlässt, auch wenn man ihn gnädig stehen lässt. Zu fürchten ist, dass nun Holzäcker und Ernte in Kahlschlägen hier wieder in Mode kommen, wurden sie doch nach deutschen Vorbildern in andere Kontinente exportiert. 2017 habe ich diese Kulturschande in Argentinien gesehen, wo in Patagonien ein Deutscher gefeiert wird, der vor Jahrzehnten die Wildnis mit exotischen Nadelbäumen aufgeforstet hat. Im Traumreiseziel Neuseeland sah ich 2019 viele Berghänge mit Plantagen aus amerikanischen Kiefern und daneben riesige Kahlschläge für den Holzmarkt in China.„Der Holzweg“ bietet keine leichte Bettlektüre vorm Einschlafen wie die freundlichen Bestseller von Peter Wohlleben. Dazu ist der Band zu streitbar und zu aufregend, er kann Alpträume erzeugen. Aber die Gliederung ist übersichtlich und die Sprache der 29 Autoren und 7 Autorinnen (weibliche Forstfachleute sind leider noch eine Minderheit) allgemeinverständlich. Am Schluss bilden Grundsatzerklärung und Konzept einer „Waldallianz“ eine Art Fazit und Zusammenfassung des Buches. Hier wundert man sich über Unausgegorenes: Wieso wird statt Naturwald ein Dauerwald angestrebt? Der passt nicht recht zum Duktus des Buches, denn in der Natur ist nichts von Dauer. Im Anhang werden die Autoren vorgestellt, nur ein Register fehlt leider, weshalb das günstigere E-Book zwei Vorteile hat.
Fazit: Dem wichtigen Buch „Der Holzweg“ ist eine weite Verbreitung und eine breite Leserschaft über die Fachkreise hinaus zu wünschen. Denn es zeigt mit seinen alternativen Konzepten, die fundiert ökosystemar begründet werden und sich im praktischen Betrieb bewährt haben, viele Wege aus der Sackgasse Holzweg heraus – hin zu einer ökologisch nachhaltigen Waldwirtschaft.
Zum Buch gelangen Sie hier.

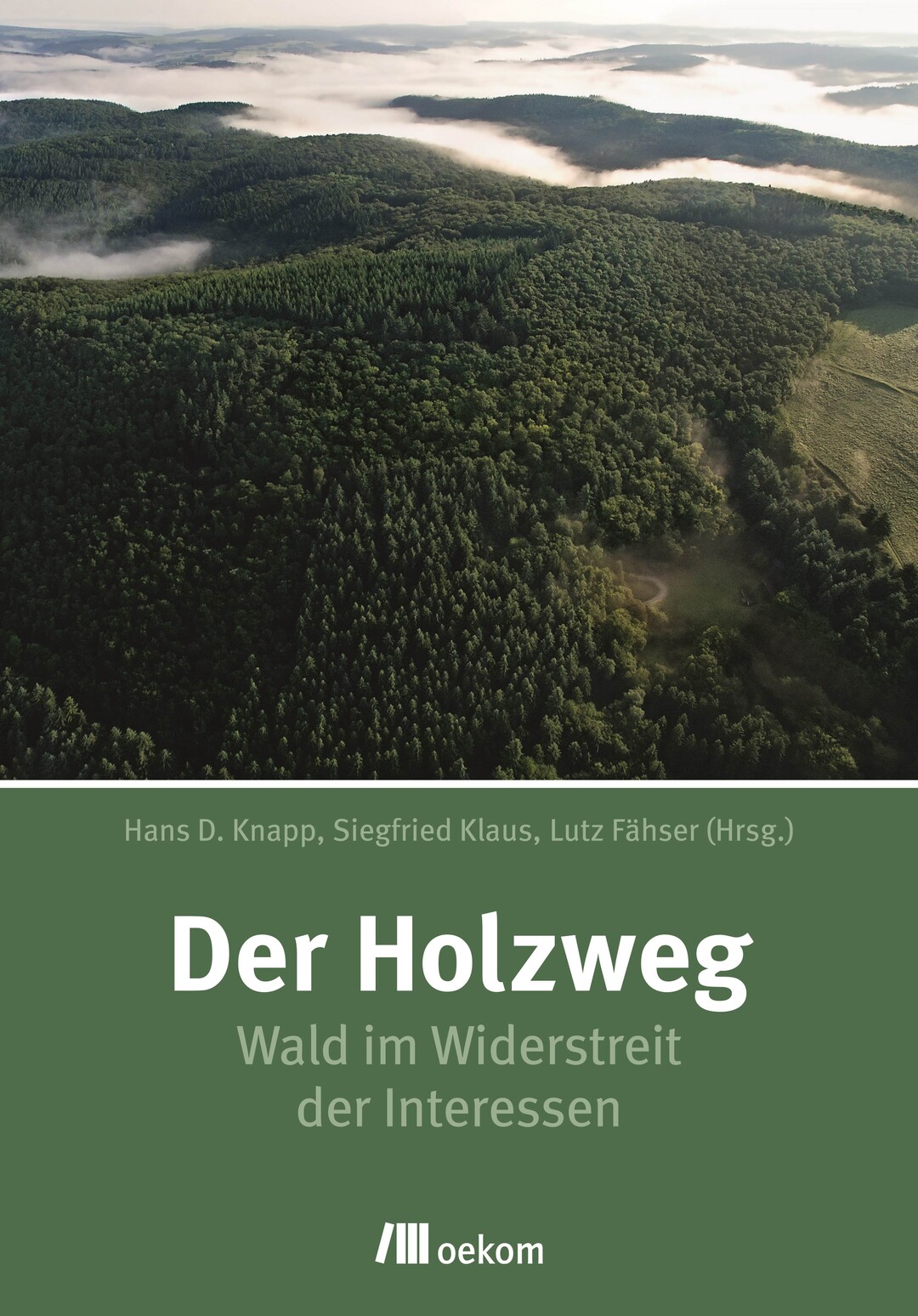
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.