Fachlicher Blick auf das Management der großen Beutegreifer
- Veröffentlicht am
Im April ist im Verlag Eugen Ulmer das Grundlagenwerk „Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft“ erschienen. Bereits in der Juli-Ausgabe haben wir Ihnen den Hauptautor Marco Heurich im Interview vorgestellt. Nun hat der Rechtsanwalt Andreas Lukas die Publikation durchgearbeitet und stellt Ihnen in seiner Rezension seine Eindrücke dar.
Ökologie der Beutegreifer
Grundlegende Kenntnisse zu Biologie, Verhalten und Ökologie der großen Beutegreifer zu vermitteln sowie darauf aufbauend aus dem fachlichen und praktischen Blickwinkel Empfehlungen für das Management zu geben – das bildet Gegenstand und Ziel des Bandes „Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft“. Die Neuerscheinung bildet den Auftakt der neuen Buchreihe „Praxisbibliothek Naturschutz und Landschaftsplanung“. Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten einen thematisch umfassenden und grafisch ansprechenden Überblick, der von Marco Heurich, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, als Herausgeber verantwortet wird.
Der Wildtierökologe beschreibt in dem zentralen Kapitel „Die Rolle der drei großen Beutegreifer im Ökosystem“ den Einfluss der Großkarnivoren auf die Diversität des Ökosystems, wobei der Schwerpunkt hier auf dem Wolf liegt. Denn Wölfe sind aufgrund ihrer weiträumigen Verbreitung, des Jagens in Rudeln und ihrer ganzjährigen Aktivität die bedeutendsten Jäger von Huftieren in der nördlichen Hemisphäre. Zudem sind sie in der Lage, ihre Nahrungsgewohnheiten flexibel an das lokale Vorkommen der verschiedenen Beutetierarten anzupassen. Im Zentrum einer ökosystemaren Betrachtung stehen die indirekten Effekte der Jagd von Wölfen.
Dieser Gesichtspunkt wurde bislang vor allem im Zuge der Wiederansiedlung von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark untersucht. Einhergehend mit dem Rückgang der Wapitipopulation konnte dabei ein Rückgang des Espenverbisses im Jahr 2010 auf 20 Prozent (gegenüber 1998) festgestellt werden. Mittlerweile haben sich Espen-Wäldchen gebildet und die Bäume eine Größe erreicht, in der sie nicht mehr verbissen werden können. Infolge der häufiger vorkommenden Weiden und Espen stieg die Anzahl der aktiven Biberkolonien zwischen 1996 und 2009 um mehr als 50 Prozent an und auch Singvögel zeigten eine Reaktion auf das zusätzliche Gehölzangebot. Darüber hinaus hatten Wölfe über ihre Risse einen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Aas als Nahrungsgrundlage für Aasfresser. An den Wolfsrissen im Yellowstone-Nationalpark konnten 30 verschiedene Säugetier- und Vogelarten sowie mehr als 57 Käferarten nachgewiesen werden.
Damit haben, so Heurich, zumindest Wölfe einen Einfluss auf die Diversität des Ökosystems. Noch nicht beantwortet ist damit allerdings die Frage, welche Effekte die drei großen Beutegreifer auf die mitteleuropäische Kulturlandschaft haben werden, da die Populationen durch anthropogene, limitierende Umstände vielleicht gar nicht die ökologisch effektiven Bestandsdichten erreichen werden. Die bisherigen Forschungsergebnisse zu dem Einfluss von großen Beutegreifern stammen vor allem aus Nordamerika und dort vor allem aus relativ naturnahen und großräumigen Landschaften mit einem geringen menschlichen Einfluss. Deshalb stellt sich die Frage, ob die drei großen Beutegreifer in unserer vom Menschen dominierten Landschaft überhaupt in der Lage sind, die Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren und trophische Kaskaden auszulösen. Aufgrund des bisherigen Forschungsstandes muss diese Frage letztlich noch offenbleiben.
Konfliktfeld Jagd
Im Beitrag von Ulrich Wotschikowsky zum „Konfliktfeld Jagd“ findet sich unter Hinweis auf die gleichbleibenden Jagdstrecken in den ostsächsischen Kreisen Bautzen und Görlitz trotz erheblicher Zunahme der Wolfspopulation im Zeitraum von 2008 (5 Rudel) bis 2017 (18 Rudel) der diesbezüglich interessante Hinweis, dass ein Effekt bisher allein auf das Muffelwild belegt werden kann. Um satt zu werden, braucht ein Wolf etwa 2 kg reine Nahrung pro Tag. Genaue Untersuchungen unter Freilandbedingungen liegen dazu allerdings nicht vor. Wotschikowsky unterstellt für seine Betrachtung 3 kg lebende Beute pro Wolf und Tag:„Die Annahme von 3 kg für mitteleuropäische Verhältnisse erscheint gerechtfertigt, weil nur selten Risse gefunden werden; denn Rehe, Rot- und Damwildkälber oder gar Frischlinge werden so gut wie vollständig konsumiert.“
In Ostsachsen, das die höchste Dichte an Wolfsrudeln im Bundesgebiet aufweist, ist aus der Jagdstrecken-Statistik 2008 bis 2017 kein Rückgang in Bezug auf das Rehwild, Rotwild und Damwild erkennbar. Der Abschuss an Wildschweinen hat sich sogar deutlich erhöht (von 6.000 im Jahr 2011 auf 10.000 im Jahr 2017). Daran macht Wotschikowsky deutlich, dass die Eingriffe von Wölfen in die Schalenwildbestände wesentlich geringer seien als die der Jäger. Sein Zwischenfazit lautet:„Große Beutegreifer allein könnten unsere Schalenwildbestände wahrscheinlich nicht auf dem zahlenmäßigen Niveau halten, das seitens der Forst- und der Landwirtschaft sowie der Landeskultur gewünscht wird … egal ob sich Luchs und Wolf ausbreiten oder nicht. Die Jagd wird nicht entbehrlich.“ Das gelte sogar für die Rotwildgebiete. Gegen Raubfeinde setzten sich Rothirsche nicht durch großräumige Ortswechsel zur Wehr, sondern durch ein angepasstes Flucht- und Vermeidungsverhalten, wobei sie ihr Streifgebiet kaum verlassen würden.
Wotschikowsky weicht der Gretchenfrage, ob man den Wolf zur Vermeidung von Übergriffen auf Weidetiere sinnvoll bejagen könne, nicht aus. Er bezieht einen klaren Standpunkt: Dies bedürfe einer politischen Antwort auf die Sorgen der Landbevölkerung. Die Begrenzung der Wolfspopulation, wie in Schweden, sei aus seiner Sicht auch in Mitteleuropa vorstellbar. Grundlage wäre – im Hinblick auf das europäische Artenschutzrecht (vgl. insbesondere Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) – ein Konzept zur jagdlichen Kontrolle von Wölfen, das mit einer möglichst geringen Beeinträchtigung der Population verbunden ist. Eine herkömmliche Bejagung in den Wintermonaten scheidet für Wotschikowsky aus, weil damit unweigerlich der Abschuss von Elterntieren verbunden wäre. Sie ließen sich um diese Zeit nicht von den fast ausgewachsenen Jungwölfen unterscheiden.
Eine selektive Bejagung in den Wintermonaten ist für den Experten jedoch vorstellbar, wenn man sich von der Revierstruktur löst:„Alle Rudelterritorien müssten von der Bejagung ausgenommen werden. … Außerhalb der Territorien kann eine Bejagung der Wölfe in den Wintermonaten erfolgen. Das wären etwa zwei Drittel des Bundesgebietes. Die Abschüsse würden zum größten Teil … abwandernde Jungwölfe treffen, die ihrerseits einer hohen jugendbedingten Mortalität durch Verkehrsunfälle u. dgl. unterliegen. Diese räumlichen statt am Einzeltier orientierten Eingriffe bilden für den günstigen Erhaltungszustand der Population keine Gefahr. Es würden voraussichtlich immer noch genügend Jungwölfe überleben, die natürliche Verluste bei den älteren Wölfen ersetzen können.“
Führt man sich die aufgeregte politische Diskussion in Deutschland vor Augen, so ist dieser Vorschlag von Wotschikowsky vielleicht so etwas wie das Durchschlagen des gordischen Knotens. Eine umweltpolitisch festzusetzende Mengengrenze greift einerseits die realen Nöte der Nutztierhalter auf. Andererseits entspricht eine revierabseitige Bejagung anstatt des Abschusses von übergriffigen „Problemwölfen“ der naturschutzrechtlichen Vorgabe der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Wolfspopulationen in Deutschland.
Fazit
Insgesamt betrachtet besticht das Handbuch durch die teils sehr hochwertigen Einzelbeiträge, in denen die Autoren ihre eigene praktische Erfahrung mit dem Stand der transnationalen Forschung kombinieren und dadurch zu konkreten Einschätzungen bzw. praktikablen Lösungen gelangen. Das Buchprojekt ist mit der günstigen eBook-Ausgabe (durchsuchbare PDF-Datei) und dem Service eines Online-Supplements ( www.nul-online.de ) auf der Höhe der Zeit und auch für das Ehrenamt geeignet. Als hochwertiger Ausgangspunkt für die eigene Tätigkeit uneingeschränkt empfehlenswert, sei es als Referent in der Jägerschulung, als Wolfsbotschafter in einem Naturschutzverein oder als amtlicher Naturschützer in der Nutztierhalterberatung.
Zum Rezensenten:
Andreas Lukas ist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Umweltrecht für die Kanzlei Baumann Rechtsanwälte tätig und Lehrbeauftragter an der Hochschule Geisenheim.
Buchhinweis: Marco Heurich (Hrsg.): Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft. Konflikte, Chancen, Lösungen im Umgang mit großen Beutegreifern. 287 Seiten. 34,95 €. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.(NuL4028)
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

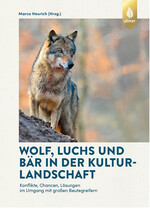

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.