Citizen-Science-Beobachtungsdaten
Abstracts
Hauptberufliche Forscher unterstellen Naturbeobachtungsdaten aus Citizen-Science-Projekten oft, nicht ausreichend plausibel und zudem fehlerbehaftet zu sein. Gleichzeitig wird angenommen, dass es entsprechende Daten mit hoher Qualität und ohne bzw. mit nur minimalem Fehler grundsätzlich gibt.
Tatsächlich liegt es aber aufgrund ihrer Eigenschaften und der Art, wie sie gewonnen werden, im Wesen der Naturbeobachtungen, potenziell fehlerbehaftet zu sein. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um von Bürgerwissenschaftlern oder hauptberuflichen Forschern gewonnene Daten handelt.
Es liegen immer dieselben potenziellen Fehlerquellen vor, da Naturbeobachtungen stets auf einem subjektiven Erleben und Verarbeiten visueller und/oder akustischer Reize basieren. Zu diesen intrinsischen Fehlerquellen kommen extrinsische, die sich auf verschiedene weitere Faktoren beziehen, darunter soziale oder auch technische Aspekte.
Citizen Science Observation Data – Characteristics and sources of error
Full-time researchers often presume that nature observation data collected in citizen science projects are not sufficiently plausible and also defective. At the same time, they assume that it is generally possible to establish high quality data without any or only with minimal errors.
But in fact, it is due to their very own characteristics and the way they are obtained, that nature observation data in general potentially contain errors. This applies regardless of whether these data are obtained from citizen scientists or full-time researchers. here are the same potential sources of error in either case since observations of nature are always based on a subjective experience and processing of visual and/or auditory stimuli. In addition to these intrinsic error sources there are extrinsic influences based upon various other factors including social and technical aspects.
- Veröffentlicht am
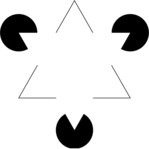
Kanizsa’s Triangles. Fibonacci, Wikimedia Commons, CC-BY SA 3.0
1 Vorbemerkungen
Auch auf die Gefahr hin, Eulen nach Athen zu tragen, und trotz der Vermutung, dass dieses scheinbar kaum etwas mit Citizen-Science-Beobachtungsdaten zu tun hat: Die Biologie ist zwar heute als Naturwissenschaft anerkannt, dennoch unterscheidet sie sich beispielsweise deutlich von der klassischen Physik. Wesentliche physikalische Grundkonzepte wie Essentialismus (= Typologie), Determinismus, Reduktionismus und universelle Naturgesetze haben in der Biologie nur eine eingeschränkte Bedeutung (Mayr 2005: 46f.).
Der Bereich der funktionalen Biologie, die sich mit den Stoffwechselvorgängen auf molekularer Ebene beschäftigt, genügt diesen Grundkonzepten noch weitgehend. Die systemische Biologie, die Biologie von Ökosystemen und die Evolutionsbiologie sind hingegen probabilistische (= wahrscheinlichkeitsbestimmte) und zeitabhängige Bereiche der Biologie, die nicht zu den beschriebenen Grundkonzepten passen (vgl. u.a. Mayr 2005: 48). Diese Biologie ist aufgrund der komplexen Systeme durch eine Vielzahl emergenter Eigenschaften gekennzeichnet, die sich nicht auf Eigenschaften der Systemelemente zurückführen lassen und in diesem Sinne neu sind. Beispielsweise findet sich keine der Eigenschaften eines Proteins in den das Molekül aufbauenden Atomen. Und auch die durch das Zusammenspiel zahlreicher Arten und abiotischer Faktoren entstehenden Eigenschaften eines Ökosystems spiegeln sich nicht in den Grundbestandteilen wider. Zudem gibt es in der Biologie ein hohes Maß an Zufälligkeit sowie fast immer eine große Anzahl von Ausnahmen.
Ergebnis ist eine an Variationen überaus reiche Natur, die kaum scharfe Grenzen, dafür aber unterschiedlich breite Übergangsbereiche kennt und sich linearen Kausalerklärungen bis auf wenige Ausnahmen verschließt. Insbesondere diese vielfältige Unbestimmtheit macht aber für unzählige Naturbeobachter die enorme Faszination aus: Nie weiß man, was man sehen wird, ob man etwas Seltenes, Ungewöhnliches sehen wird oder ob etwas bislang Alltägliches plötzlich nicht mehr entdeckt werden kann. Garantiert ist dabei, dass man fast immer etwas für sich selbst Neues beobachten kann!
Doch wie steht es mit den Beobachtungsdaten, die dabei gewonnen werden? Dass sie grundsätzlich für „ernsthafte“ Wissenschaft genutzt werden können, ist heute unstrittig (z.B. GEWISS 2016). Aber wie kann man insgesamt oder im Einzelfall ihre Qualität abschätzen?
Der vorliegende Beitrag ist der erste von voraussichtlich drei Teilen einer Beitragsserie zu Citizen-Science-Beobachtungsdaten. In diesem geht es insbesondere um spezielle, menschbedingte Fehlerquellen, die wesentliche Auswirkungen auf Beobachtungsdaten haben können. Teil 2 wird Möglichkeiten einer Qualitätsabschätzung behandeln, Teil 3 die Datenplausibilisierung bei naturgucker.de.
2 Eigenschaften von Naturbeobachtungen
2.1 Grundsätzlicher Charakter
Naturbeobachtungen können im Gegensatz zu beispielsweise einem naturwissenschaftlichen Laborexperiment nicht jederzeit und intersubjektiv wiederholt werden. Deshalb verschließt sich eine einzelne Naturbeobachtung grundsätzlich der Popperschen Forschungslogik, die eine positive Bestätigung im Sinne von „Diese Theorie ist wahr“ negiert (unendlich viele Alternativen, Induktionsproblem) und stattdessen als Bewährung für getroffene Annahmen lediglich das Mittel der empirischen Widerlegung (Falsifizierung) zulässt (u.a. Popper 1935). Da eine solche Widerlegung nicht möglich ist, ist eine Naturbeobachtung keine prüfbare, empirisch-wissenschaftliche Aussage. So lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass während des Beobachtungsvorgangs etwas übersehen und/oder falsch wahrgenommen worden ist, nicht hinreichend einschätzen.
Selbst Naturbeobachtungen, zu denen es geeignete Belege wie Sammlungsbelege, Bilder, Videos, Tonaufnahmen etc. gibt, sind davon nicht ausgenommen. Zwar erlauben solche Belege jederzeit und intersubjektiv eine nachträgliche Artbestimmung. Die anderen, zwingend zu einer Beobachtung gehörenden Daten wie Ort, Datum oder Detailinhalte wie beobachtetes Verhalten der Art etc. entziehen sich allerdings einer empirischen Falsifizierung. Abgesehen davon ist es auch immer möglich, dass „Beweise“ beispielsweise von einem anderen Ort oder einem anderen Zeitpunkt stammen, also bewusst falsche Angaben gemacht werden. Aus diesen Gründen gilt die Nichtwiderlegbarkeit auch für Naturbeobachtungen, denen Belege beigefügt sind.
Eine Naturbeobachtung ist damit logisch betrachtet grundsätzlich eine nicht widerlegbare Behauptung des Beobachters und der Popperschen Logik folgend dem Bereich der philosophischen Theorien/Aussagen zuzuordnen (Popper in Miller 1995: 199).
Im Kontext von Naturbeobachtungen wird häufig von sogenannten Zufallsbeobachtungen gesprochen (u.a. Dachverband Deutscher Avifaunisten 2016), wenn eine Art ohne definierte Methode wahrgenommen wurde. Die Bezeichnung führt insbesondere Nichtfachleute in die Irre, denn eine im Rahmen eines Monitorings durchgeführte Beobachtung erfolgt zwar gemäß einer definierten Methode. Doch auf welcher Basis Individuen unterschiedlicher Arten Entscheidungen treffen und sich an einem bestimmten Ort aufhalten oder nicht, können wir Menschen zumeist nicht nachvollziehen. Monitoring ist deshalb zwar standardisiert und Beobachtungstage werden häufiger wiederholt, doch sind die dabei gesammelten Naturbeobachtungen dennoch zu einem nicht unerheblichen Maße zufällig, da vom Verhalten der beobachteten Arten abhängig.
Korrekt wäre es deshalb, von Monitoring- und Nicht-Monitoring-Beobachtungen zu sprechen; Letzteres wäre die unmissverständliche Beschreibung dessen, was landläufig als Zufallsbeobachtung bezeichnet wird.
2.2 Fehlerquellen bei Naturbeobachtungen
Naturbeobachtungen haftet wie Messwerten in der Physik immer eine gewisse Ungenauigkeit (= Fehler) an. Es gibt viele Werke, die sich mit Fehlerquellen und Problemen der Datenerfassung befassen (z.B. Bauer 2005). Technische und methodische Fehler, die beispielsweise aus den angewendeten Verfahren resultieren, werden dabei detailliert betrachtet. Mehr am Rande gestreift werden hingegen Fehlerquellen, die menschbedingt sind. Zumeist gar nicht erwähnt oder berücksichtigt werden wesentliche Fehlerquellen, die ihren Ursprung in den besonderen Funktionsweisen des menschlichen Gehirns und im sozialen Wesen des Menschen haben. Die wichtigsten im Kontext von Naturbeobachtungen betrachten wir nachfolgend.
2.2.1 Veränderungsblindheit (inattentional blindness)
Menschen, die mit einer bestimmten Beobachtungsaufgabe betraut sind, nehmen auffällige Ereignisse außerhalb der gestellten Aufgabe nur bedingt wahr (Simon 2007). Berühmtes Beispiel dafür ist das Gorilla-Experiment (Simon & Chabris 1999): Von Beobachtern, die mit einer einfachen Zählaufgabe im Rahmen eines Basketballspiels betraut waren, nahm rund die Hälfte (46 % ) einen quer über das Spielfeld laufenden Menschen in einem Gorilla-Kostüm nicht wahr, obwohl er sich in der Mitte des Spielfeldes sogar noch auf die Brust trommelte.
Beobachten setzt offensichtlich eine bewusste Wahrnehmung voraus. Das menschliche Gehirn muss für eine Wahrnehmung aus der Gesamtmenge der einlaufenden Informationen die relevanten selektieren. Die als nicht-relevant erkannten Reize werden aussortiert und entsprechend nicht wahrgenommen. Dieser Zusammenhang erklärt den Umstand, dass die Veränderungsblindheit umso stärker auftritt, je schwieriger die gestellte Aufgabe ist und damit mehr Aufmerksamkeit (= Fokussierung) erfordert. Auch der Umstand, dass die Veränderungsblindheit geringer ausfällt, wenn das unerwartete Objekt dem eigentlichen Beobachtungsobjekt ähnlich ist, ist so nachvollziehbar.
Praxisrelevanz: u.a. wenn Vorhandenes nicht wahrgenommen wird, weil man beispielsweise intensiv mit einer Transektzählung beschäftigt ist oder sich auf einen speziellen Umstand konzentriert. Landläufig spricht man auch von „Suchschema“: Jemand, der z.B. auf Vögel konzentriert ist, beachtet durchaus Dinge, die Vögel sein könnten, wie fliegende Insekten, die im Augenwinkel wahrgenommen werden, ignoriert aber die blühenden Pflanzen direkt zu seinen Füßen.
2.2.2 Subjektive Vervollständigung
Wenn das menschliche Gehirn scheinbar unvollständige Strukturen wahrnimmt, so werden diese auf Basis von Erfahrungswerten ergänzt. Bekanntes Beispiel sind die sogenannten kognitiven Konturen, auch subjektive Konturen genannt. Hier werden unvollständige Linien zu sinnvollen Konstrukten ergänzt. Im Kanizsa-Dreieck sind drei Winkel und drei Pac-Man-Figuren so angeordnet, dass Beobachter mindestens zwei Dreiecke wahrnehmen (Abb. 1): ein weißes, das teilweise ein mit einer schwarzen Linie umrahmtes zweites überdeckt. Im Maximum können bis zu elf Dreiecke wahrgenommen werden, keines davon ist aber als tatsächliche Figur vorhanden.
Diesen Prozess beschreibt Max Wertheimer in seiner Gestalttheorie (1925) wie folgt: „Es gibt Zusammenhänge, bei denen nicht, was im Ganzen geschieht, sich daraus herleitet, wie die einzelnen Stücke sind und sich zusammensetzen, sondern umgekehrt, wo – im prägnanten Fall – sich das, was an einem Teil dieses Ganzen geschieht, bestimmt von inneren Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.“
Die Interpretation durch den Beobachter spielt damit eine entscheidende Rolle für eine Wahrnehmung und keineswegs ausschließlich das objektiv Vorhandene. Erfahrungen und Wissen dienen dem menschlichen Gehirn dabei als Abgleich für neue Bilder und es manipuliert die Wahrnehmung eines neuen Bildes bei Bedarf so, dass sie einen stimmigen, annehmbaren Gesamteindruck ergibt.
Praxisrelevanz: u.a. wenn Beobachtungen nicht perfekt sind, wird unvollständig Wahrgenommenes automatisch zu etwas Sinnvollem ergänzt: eine kurz gesehene Libelle, ein halb verdeckt sitzender Vogel etc.
2.2.3 Konformitätsdruck (peer pressure)
Die Gruppendynamik beschreibt den Umstand, dass Menschen in einer Gruppe durch Kommunikation bzw. durch Angleichung von Haltungen und Meinungen einem gemeinsamen Ziel näherkommen. Man konnte dabei zeigen, dass die in einer Gruppe entstehende Dynamik mehr Wirkung zeigen kann als der Vortrag eines (externen) Experten (Schindler 1957).
Mitglieder einer Gruppe ordnen sich in eine Hierarchie vom Anführer bis zum einfachen Mitglied ein. Tendenziell dominieren Anführer die Meinung und innere Haltung der Gruppe. Da der Mensch als soziales Wesen zu Konformität neigt, verstärken Gruppennormen dies (normativer Einfluss). Eine zweite Verstärkung entsteht, wenn Informationen teilweise von anderen Gruppenmitgliedern bezogen werden, die ihrerseits bereits beeinflusst sind (informativer Einfluss) (Stroebe et al. 2002: 458-461).
Mit seinem Konformitätsexperiment hat Asch (1951, 1956) eindrücklich bewiesen, was gruppendynamische Prozesse und gegenseitige Verstärkungen bewirken: Ein Proband musste dabei Bewertungen im Rahmen einer Gruppe abgeben, deren andere Mitglieder instruiert waren, in zwölf von achtzehn Fällen bewusst falsche Einschätzungen abzugeben. Ergebnis: Rund ein Drittel der Probanden schloss sich in allen Fällen den offensichtlichen Fehlentscheidungen der Mehrheit an, nur ein Viertel der Probanden äußerte in allen Fällen ein unabhängiges, richtiges Urteil.
Praxisrelevanz: u.a. wenn man in Gruppen gemeinsam beobachtet, Beobachtungen mit anderen Beobachtern z.B. in Gremien diskutiert.
2.2.4 Erinnerungsverfälschung (false memories)
Das menschliche Gedächtnis ist kein Videorekorder, der unverfälscht alles Erlebte punktgenau und mit einer Time-line versehen aufzeichnet. Zudem erodiert nach kurzer Zeit die Detailgenauigkeit des selektiv Wahrgenommenen. Das wusste bereits Darwin und er bemühte sich deshalb immer, kritische Überlegungen zu seiner Evolutionstheorie innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Einfall zu notieren (Barlow 1958).
Erinnerung ist weder vollständig noch persistent. Amerikanische Psychologen haben die Umstände dazu im Umfeld des Blitzlicht-Ereignisses der Challenger-Katastrophe, bei der die gleichnamige Raumfähre 1986 kurz nach dem Start explodierte, untersucht. Am Tage danach ließen sie Probanden die genauen Umstände des Erlebens der Katastrophe schriftlich niederlegen. Zwei Jahre danach befragten sie die Probanden erneut. Ergebnis: Die Erinnerungen der Befragten hatten sich zwischenzeitlich dramatisch verändert. Sie enthielten nun Elemente, die zwar gut passten, aber nicht wirklich geschehen waren. Konfrontiert mit ihren schriftlich niedergelegten ursprünglichen Erinnerungen, zeigten sich alle schockiert, einige beharrten trotzdem auf ihren „eigenen“ Erinnerungen, statt sich eine Gedächtnisverfälschung einzugestehen (Neisser et al. 1992). Wolfgang Singer, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, bezeichnet Erinnerung deshalb als „datengestützte Erfindungen“ (Assmann 2006: 134).
Wie weit die Unzuverlässigkeit menschlicher Erinnerungen geht und wie stark diese manipulierbar sind, untersuchten Wade et al. (2002) mit folgendem Experiment: Erwachsenen wurden stark manipulierte Bilder einer Ballonfahrt gezeigt, die diese angeblich in ihrer Kindheit mit ihren Vätern unternommen hätten. Rund die Hälfte der Probanden konnte sich in der Folge an die Fahrt in den Himmel erinnern und das Erlebnis detailliert beschreiben. Einzig und allein: Eine solche Ballonfahrt hatte in keinem Fall je stattgefunden! Vergleichbares berichtet auch Lofus (1997, 2003).
Salzburger Psychologen um Josef Perner stellen ergänzend fest, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen dem, was tatsächlich stattgefunden hat, und dem Resultat, das man als Erinnerung im Kopf herumträgt (Schurz et al. 2013).
Praxisrelevanz: u.a. wenn beispielsweise Beobachtungserlebnisse ausgetauscht werden oder man nach einer gewissen Zeit zu Hause versucht, sich exakt zu erinnern und dann erst Notizen macht.
2.2.5 Bestätigungsfehler (confirmation bias)
Menschen neigen dazu, Informationen, die ihrer Erwartung entsprechen, häufiger zu suchen, wahrzunehmen, stärker zu wichten oder sich eher daran zu erinnern. Entgegengesetzt verhält es sich in Bezug auf Informationen, die ihrer Erwartung widersprechen (Schweizer 2005: 178). Dieses Verhalten führt dazu, dass vor allem nach bestätigenden Informationen und nicht nach falsifizierenden gesucht wird. Es gibt Untersuchungen aus den USA, die darauf hinweisen, dass durch eine gezielte Ausbildung der Bestätigungsfehler vermindert werden kann (Schweizer 2005: 184).
Praxisrelevanz: u.a. wenn Naturbeobachtungen bewertend in den Kontext vorhandener Daten gestellt werden oder wenn man beobachtet und weiß, dass in einem bestimmten Gebiet bestimmte Arten vorkommen.
2.2.6 Selbstüberschätzung (overconfidence)
Befragte Autofahrer in einer US-Studie beantworteten mit rund 93 % die Frage mit Ja, ob sie zur Hälfte der besseren Autofahrer in dieser Gruppe (Bezug: Gruppe der Befragten) gehören (Svenson 1981). Mindestens 43 % müssen sich dabei überschätzt haben, da die Hälfte der besseren Autofahrer ja exakt 50 % der Befragten umfasst. Ein wesentlicher Teil aller Befragten überschätzt also seine eigenen Fähigkeiten, und zwar teilweise dramatisch. Vergleichbare Ergebnisse erhält man auch bei prognostischen Fragen (u.a. Gilovich et al. 2002). Überraschend ist, dass Experten ebenfalls keineswegs vor Selbstüberschätzung gefeit sind. Sie sind dabei von der Richtigkeit ihrer Einschätzung sogar noch deutlich überzeugter als die Nichtexperten. Letztere leiden dafür an einem höheren Maß der Überschätzung (Kruger et al. 1999). Frauen sind insgesamt in geringerem Maß anfällig für eine Selbstüberschätzung (Vallone et al. 1990).
Praxisrelevanz: u.a. wenn es um Entscheidungen auf Basis von Wissen oder Fertigkeiten geht, also z.B. bei Artbestimmungen, die schwierig oder nicht eindeutig zu entscheiden sind.
3 Fehlerbetrachtung an einem hypothetischen Beispiel
Welche Relevanz diese psychologischen Fehlerquellen für das Thema Naturbeobachtungen haben, möchten wir an nachfolgendem hypothetischen Beispiel zur Vogelbeobachtung veranschaulichen. Vergleichbare Beispiele lassen sich auch für Botaniker, Schmetterlingsgucker, Libellenfreunde oder beliebige andere Naturbeobachter finden, sodass sicherlich bereits viele Naturbeobachter Ähnliches selbst erlebt haben.
Eine siebenköpfige Gruppe von Vogelbeobachtern trifft sich am frühen Morgen für einen gemeinsamen Beobachtungsausflug an der Nordseeküste. Besonders beeindruckt sind die Ornis von den regelrechten Limikolenwolken, die vor ihnen hin und her fliegen. Während sich alle Beobachter voll und ganz darauf konzentrieren, die Watvögel zu zählen, übersehen sie die Eiderenten, die in unmittelbarer Nähe des Spülsaums ruhen und schließlich davonfliegen (Abb. 2) (2.2.1 Aufmerksamkeitsdefizit).
Aus dem Augenwinkel heraus sehen die Beobachter hoch oben am Himmel kurz einen kleinen Schwarm Vögel mit langen Schnäbeln fliegen. Der langjährige Binnenland-Beobachter der Gruppe hat Bekassinen wahrgenommen, ein anderer Beobachter ist überzeugt, dass es Uferschnepfen waren (Abb. 3) (2.2.2 Subjektive Vervollständigung).
Im Mündungsbereich eines Entwässerungsgrabens werden Möwen gesichtet. Einer der Beobachter, er arbeitet sich gerade intensiv in Möwen und ihre verschiedenen Federkleider ein, ist überzeugt, darunter eine seltene Eismöwe zu erkennen (möglicherweise 2.2.6 Selbstüberschätzung). In der Gruppe wird über die Bestimmung diskutiert, letztendlich der Einschätzung aber nicht mehr widersprochen (potenziell 2.2.3 Konformitätsdruck).
Zum Aufwärmen geht es schließlich ins nahe gelegenes Café. Bei Ostfriesentee und Kuchen werden die Beobachtungen noch einmal besprochen, auch die Kurzbeobachtung mit den Langschnäblern. Ein in der Vogelbeobachtung noch recht unerfahrenes Gruppenmitglied zeigt auf seinem Smartphone Bilder von fliegenden Großen Brachvögeln und fragt, ob es nicht auch so etwas gewesen sein könnte. Die hätten ja schließlich auch lange Schnäbel ... Es geht hin und her, bis die meisten überzeugt sind, dass es auch Brachvögel gewesen sein könnten (2.2.4 Verfälschte Erinnerungen in Kombination mit 2.2.3 Konformitätsdruck). Außerdem seien Brachvögel im Gebiet deutlich häufiger als Bekassinen oder Uferschnepfen (2.2.5 Bestätigungsfehler).
4 Gesamtbewertung
Naturbeobachtungen sind nicht nur keine exakt-wissenschaftlichen Aussagen, sondern zusätzlich noch bedingt durch die Besonderheiten des menschlichen Gehirns der Beobachter mit nicht abzuschätzenden, aber auch nicht zu unterschätzenden Ungenauigkeiten behaftet.
Die genannten Effekte treten bei jedermann auf; nicht einmal Experten sind davor gefeit, lediglich die Selbstüberschätzung ist bei ihnen in geringerem Maße zu finden. Untersuchungen bei naturgucker.de legen einen weiteren Zusammenhang offen: Die am wenigsten zu diskutierenden Beobachtungen kommen erwartungsgemäß von den Experten. In Bezug auf die Qualität kaum davon zu unterscheiden sind die Beobachtungen absoluter Einsteiger. Doch auch sie sind ja Experten: Sie wissen sehr gut, dass sie nicht viel wissen, sind aber bei dem wenigen sehr sicher. Größere Diskussionen lösen des Öfteren hingegen Beobachter aus dem Mittelbau aus, also Daten von Beobachtern, die bereits wissen, dass es mehr gibt (Munzinger 2015).
Wie auch immer, wenn man alle genannten Aspekte miteinander vermischt, ergibt sich ein nicht zu entwirrender Cocktail an Einflüssen, der es unmöglich macht, eine tragfähige oder zumindest brauchbare Aussage zur „Richtigkeit“ oder „Falschheit“ einer einzelnen Naturbeobachtung zu treffen. Das gilt für alle diese Daten – gleich, ob sie von hauptberuflichen Wissenschaftlern oder ehrenamtlichen Naturbeobachtern stammen, wann und zu welchem Zweck sie erhoben wurden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Naturbeobachtungsdaten grundsätzlich wertlos sind, sondern es heißt vielmehr, dass bei der Interpretation solcher Daten diese Sachverhalte in jedem Fall hinreichend berücksichtigt werden müssen.
Literatur
Asch, S.E. (1951): Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgment. In: Guetzkow, H., ed., Groups, leadership and men, Carnegie Press.
– (1956): Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs 70 (9), 1-70.
Assmann, A. (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. C.H.Beck, München.
Bauer, H.-G. (2005): Feldornithologische Erfassungsmethoden – eine Übersicht. In: Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C., Hrsg., Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Radolfzell, 26-29.
Barlow, N. (1958): The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882. Collins, London.
Dachverband Deutscher Avifaunisten (Hrsg., 2016): Richtlinien zur Nutzung von Beobachtungen aus ornitho.de (Zufallsbeobachtungen). http://files.biolovision.net/www.ornitho.de/userfiles/Referencelists/ornitho-de-Richtlinien-Datennutzung-2016-01-22.pdf (zuletzt abgerufen am 11.12. 2016).
Gardenne, V. (2007): Bewährung. In: Keuth, H., Hrsg., Logik der Forschung, Akademie, Berlin, 3. Aufl., 125-144.
Gewiss (Hrsg., 2016): Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland. Projekt „Bürger schaffen Wissen – Wissen schafft Bürger“, Berlin http://www.buergerschaffenwissen.de/sites/default/files/assets/dokumente/gewiss-gruenbuch_citizen_science_strategie.pdf (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Gilovich, T., Griffin, D., Kahneman, D. (Hrsg., 2002): Heuristics and biases, The psychology of intuitive judgement. Cambridge University Press.
Jacobs, C., Resch, B. (2013): Semi-automatisierte Plausibilitätsprüfung in Citizen Science gestützten Naturbeobachtunge. In: Strobl, J., Blaschke, T., Griesebner, G., Hrsg., Angewandte Geoinformatik, Wichmann, Heidelberg, 350-355, http://koenigstuhl.geog.uni-heidelberg.de/publications/2013/Jacobs/agit2013_jacobs_resch.pdf (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Kruger, J., Dunning, D. (1999): Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. Journal of Personality and Social Psychology 77 (6), 1121-1134.
Loftus, E.F. (1997): Creating False Memories. Scientific American 277 (3), 70-75. https://faculty.washington.edu/eloftus/Articles/sciam.htm (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
– (2003): Make-believe Memories. American Psychologist 58 (11), 867-873. https://faculty.washington.edu/eloftus/Articles/AmerPsychAward+ArticlePDF03 % 20(2).pdf (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Mayr, E. (2005): Biologische Konzepte. S. Hirzel, Stuttgart.
Miller, D. (Hrsg., 1995) Karl Popper Lesebuch. Mohr Siebeck, Tübingen.
Munzinger, S. (2015): Citizen Science: Qualitätssicherung durch Motivation. Entomologie heute 27, 171-176.
Neisser, U., Harsch, N. (1992): Phantom flashbulbs: False recollections of hearing the news about Challenger. In: Winograd, E., Neisser, U., eds., Affect and Accuracy in Recall Studies of “Flashbulb” Memories, Cambridge University Press, 9-31.
Popper, K.R. (1935): Logik der Forschung. Springer, Wien.
–, (1973): Objektive Erkenntnis. Hoffmann und Campe, Hamburg.
Schindler, R. (1957): Grundprinzipien der Psychodynamik in der Gruppe. Psyche 11 (5), 308–314.
Schurz, M., Aichhorn, M., Martin, A., Perner, J. (2013): Common brain areas engaged in false belief reasoning and visual perspective taking: a meta-analysis of functional brain imaging studies. Front. Hum. Neurosci., http://dx.doi.org/ 10.3389/fnhum.2013.00712 (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Schweizer, M.D. (2005): Kognitive Täuschungen vor Gericht. Diss., Rechtswiss. Fakultät der Univ. Zürich. http://opac.nebis.ch/F?local_base=NEBIS&CON_LNG=GER&func=find-b&find_code =SYS&request=005075899 (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Simons, D.J. (2007): Inattentional blindness. Scholarpedia 2 (5), 3244. http://dx.doi.org/10.4249/scholarpedia.3244 (zuletzt abgerufen am 11. 12.2016).
–, Chabris, C.F. (1999): Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events. Perception 28, 1059-1974.
Stroebe, W., Jonas, K., Hewstone, M. (2002): Sozialpsychologie. Eine Einführung. Springer, Heidelberg.
Svenson, O. (1981): Are we all Less Risky and More Skillful Than Our Fellow Drivers? Acta Psychologica 47, 143-148.
Vallone, R.P., Griffin, D.W., Lin, S., Ross, L. (1990): Overconfidence prediction of future actions and outcomes by self and others. Journal of Personality and Social Psychology 58 (4), 582-592.
Wade, K.A., Garry, M., Read, J.D., Lindsay, D.S. (2002): A picture is worth a thousand lies: Using false photographs to create false childhood memories. Psychonomic Bulletin and Review 9, 597-603. http://web.uvic.ca/∼slindsay/publications/2002WadGarReadLind.pdf (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Wertheimer, M. (1925): Über Gestalttheorie. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache 1, 39-60. http://gestalttheory.net/gta/Dokumente/gestalttheorie.html (zuletzt abgerufen am 11.12.2016).
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



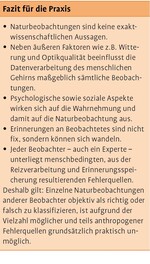
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.