Wie entwickeln sich Buchen- und Eichen-FFH-Lebensraumtypen in Naturwaldreservaten?
Abstracts
In der vorliegenden Analyse werden Zeitreihendaten aus Naturwaldreservaten (NWR) genutzt, um die mittelfristige Entwicklung der Erhaltungszustände von Buchen- und Eichenwald-Lebensraumtypen (LRT) gemäß FFH-Richtlinie nach Stilllegung zu untersuchen.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Erhaltungszustand der betrachteten Wald-LRT in NWR überwiegend positiv entwickelt, insbesondere für Buchen-LRT und diejenigen Merkmale, die mit der Reifung der Bestände in Zusammenhang stehen. Im Unterschied dazu deutet sich in den Eichen-LRT ein schleichender Verlust der wertbestimmenden Hauptbaumart Eiche an. Offenbar handelt es sich nicht um natürliche, sondern um sekundäre Eichenwälder.
Die Entwicklung der Bodenvegetation nach Stilllegung ist durch eine Abnahme der Artenvielfalt und einen steigenden Anteil der lebensraumtypischen Arten gekennzeichnet. Die Mehrzahl der untersuchten Bestände weist einen relativ geringen Anteil an Störzeigern in der Krautschicht auf. Der Anteil an Neophyten ist durchgehend sehr gering.
Auch in Zukunft wird der überwiegende Anteil von Wald-LRT im Wirtschaftswald liegen. Eine große Herausforderung wird darin gesehen, eine gleichermaßen naturschutzgerechte wie ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von FFH-LRT sicherzustellen. Notwendig erscheint eine Intensivierung der waldbaulich-naturschutzfachlichen Forschung unter Einbeziehung von NWR.
How do beech and oak habitat types according to the Habitats Directive develop in Natural Forest Reserves? The evaluation using time series data
The study investigated time series data in Strict Forest Reserves (SFR) to examine the medium-term development of the conservation status of forest habitat types after they were set aside from forestry interventions. The results show that the conservation status in SFR developed mostly positive over the past 24 years. This is especially true for beech habitat types and those structures that are related to old growth forests. Contrary to the beech habitat types, a gradual loss of oak could be observed in the oak habitat types. It is assumed that these are secondary oak forests calling for active interventions to favour oak trees against competition and to enhance oak regeneration.
The development of ground vegetation in SFR has been characterised by a decrease in species diversity and an increasing proportion of species typical for the habitat type. Most of the stands show a low share of indicator species for disturbance. The amount of neophytes has been very low in all stands.
In the future, the vast majority of forest habitat types will be situated in managed forests. This underlines the importance to ensure a multi-functional management of habitat types, incorporating economic as well as conservation goals. Consequently, intensified research will be needed focusing on silviculture and nature conservation using SFR as reference stands in corresponding experiments.
- Veröffentlicht am

Habitat types 9110 Luzulo-Fagetum beeck forests (above left NFR Hasenblick, Hesse), 9130 Asperulo-Fagetum beech forests (above right NFR Großer Freeden, Lower Saxony) and 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oakhornbeam forests of the Carpinion betuli (NFR Braken, Lower Saxony).
1 Einleitung
Im Zusammenhang mit dem Management von FFH-Waldlebensraumtypen (Wald-LRT) wird kontrovers diskutiert, inwieweit Einschränkungen der forstlichen Nutzung bis hin zur Stilllegung naturschutzfachlich zielführend sind. Während beispielsweise Ssymank et al. (1998) die Aufgabe der forstlichen Nutzung in allen Wald-LRT als optimale Maßnahme empfehlen, gehen Müller-Kroehling (2013) und Lux et al. (2014) davon aus, dass der Bestand der Eichenwald-LRT von Pflegemaßnahmen abhängt. Aber auch für Buchenwald-LRT stellt sich die Frage, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich deren Erhaltungszustand nach Aufgabe der forstlichen Nutzung verändert. Hier sind verschiedene Entwicklungen denkbar. Einerseits könnte es durch eine Reifung der Waldbestände zur Verbesserung des Erhaltungszustands kommen, da Totholz, Altbäume und späte Waldentwicklungsphasen zunehmen. Andererseits könnten fehlende forstliche Eingriffe auch zu einer lange anhaltenden Homogenisierung der Bestandesstruktur und der Artenzusammensetzung führen.
Die Bewertung von Wald-LRT wird anhand der Kriterien Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars und Beeinträchtigungen vorgenommen (PAN/ILÖK 2010). Im Vorfeld der dritten Bundeswaldinventur (BWI3) wurde erstmalig eine deutschlandweit einheitliche Bewertungssystematik (PAN/ILÖK ebd.) entwickelt. In dieser werden die Waldentwicklungsphasen, die Totholzmenge und die Anzahl an Biotopbäumen als Indikatoren für die Habitatstrukturen verwendet. Zur Charakterisierung des Arteninventars wird die Artenzusammensetzung der Baum- und Krautschicht angesprochen. Für die Bewertung von Beeinträchtigungen werden der Anteil an Störzeigern in der Bodenvegetation, das Ausmaß des Wildverbisses, Befahrungsschäden, Schäden an Standort, Waldvegetation und Struktur sowie der Anteil an nicht heimischen Gehölzarten herangezogen.
In Deutschland existieren mehr als 700 Naturwaldreservate (NWR), die oftmals bereits seit mehreren Jahrzehnten aus der forstlichen Nutzung entlassen sind. Viele Gebiete werden regelmäßig im Rahmen von Monitoringprogrammen untersucht, um Erkenntnisse für eine naturnahe Waldbewirtschaftung und den Waldnaturschutz abzuleiten (Albrecht 1988, Bücking 1994, 1997; Trautmann 1980). Die erhobenen Daten decken einen großen Teil derjenigen Parameter ab, die zur Bewertung von Wald-LRT herangezogen werden.
Im vorliegenden Beitrag wird diese Datengrundlage genutzt, um die mittelfristige Entwicklung flächig bedeutsamer Buchen- und Eichenwald-LRT (Beispiele in Abb. 1 bis 3) nach Stilllegung zu untersuchen. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Fragen, wie sich die einzelnen wertgebenden Kriterien nach der Stilllegung entwickeln und ob es Hinweise auf eine eigendynamische Verschlechterung des Erhaltungszustands gibt.
2 Auswahl geeigneter Naturwaldreservate
Von den für die NWR-Forschung zuständigen Einrichtungen in den Bundesländern wurden Datensätze aus NWR erfragt, in denen Buchen- und Eichen-LRT liegen und für die mindestens eine Wiederholung der Aufnahmen von Waldstruktur und/oder Vegetation auf denselben Probeflächen vorhanden waren. Die Aufnahmen sollten einen zeitlichen Mindestabstand von zehn Jahren haben und die Naturwaldreservate sollten möglichst innerhalb von FFH-Gebieten liegen. In Einzelfällen wurden jedoch auch NWR außerhalb von FFH-Gebieten einbezogen, wenn ihre Waldbestände eindeutig einem Buchen- oder Eichen-LRT zugeordnet werden konnten.
Insgesamt wurden von den Bundesländern Datensätze aus 213 NWR zur Verfügung gestellt. Diese befinden sich überwiegend im Norden, Westen und Süden Deutschlands (Abb. 4, Download unter http://www.nul-online.de » Webcode 2231).
3 Daten
Für die verschiedenen Merkmale zur Ableitung von Wertstufen von LRT (Tab. 1) wurden Datensätze zum lebenden Derbholzbestand (Stammzahl und Brusthöhendurchmesser (BHD) nach Baumarten), zur Gehölzverjüngung, zum Totholz und zur Vegetation von den Bundesländern erfragt. Zusätzlich wurden begleitende Informationen zur Größe der Probefläche, den Aufnahmejahren, dem Beginn der Stilllegung bzw. Ausweisung des jeweiligen NWR, dem LRT, der Trophie und der Wasserversorgung geliefert. Daten zum lebenden Bestand und zur Bodenvegetation waren für eine große Zahl an NWR vorhanden (Abb. 4 zum Download und Tab. 2). Dagegen liegen Wiederholungsaufnahmen zum Totholz erst für relativ wenige NWR vor. Die Aufnahmen zur Verjüngung waren sehr lückenhaft, so dass von einer weiteren Bearbeitung abgesehen wurde. Die Datenreihen umfassen einen Zeitraum von 1967 bis 2013. Der mittlere Untersuchungszeitraum beträgt bei den Aufnahmen des lebenden Bestandes 23 Jahre (Totholz: 14 Jahre) und bei den Vegetationsaufnahmen 13 Jahre.
Hinsichtlich der Waldentwicklungsphasen stellen rund 80 % der Untersuchungsflächen überwiegend mittlere bis sehr starke Baumhölzer (BHD =35cm) dar. Es handelt sich demnach mehrheitlich um ältere Bestände.
4 Datenaufbereitung und -auswertung
Um im Hinblick auf die Waldstruktur (lebender Derbholzbestand, Totholz) die Vergleichbarkeit der Kenngrößen zwischen den meist 1ha großen Repräsentationsflächen und den oft nur 0,05 bis 0,1ha großen Probekreisen zu gewährleisten, wurden die Probekreise eines NWR auf gleichem Standort und im gleichen LRT zu Auswertungseinheiten zusammengefasst. Die mittlere Größe der Untersuchungsflächen beträgt nach diesem Datenbearbeitungsschritt für den lebenden Derbholzbestand 0,98±0,04ha (einfacher Standardfehler) und für das Totholz 1,12±0,11ha. Der überwiegende Teil der Ergebnisse zur Waldstruktur wurde daher für rund 1ha große Untersuchungsflächen berechnet.
Die Werte der Zweitaufnahme wurden auf einen Zeitpunkt von 24 Jahren nach der Erstaufnahme normiert, indem die jährliche Differenz zwischen Erst- und Wiederholungsaufnahme errechnet und daraus der Wert der Zweitaufnahme nach 24 Jahren ermittelt wurde. Dieser Bezugszeitraum liegt im Rahmen der Wiederholungsaufnahmen und entspricht dem Vierfachen des sechsjährigen Berichtszeitraums der FFH-Richtlinie.
Für die vorliegende Untersuchung wurde eine einheitliche, bundesländerübergreifende Definition der Haupt-, Neben- und Pionierbaumarten eines LRT entwickelt, die sich weitgehend an den Länderzuordnungen im Rahmen der dritten Bundeswaldinventur orientiert (Tab. 3).
Die Auswertung und graphische Darstellung erfolgt zum einen in Form von Mittelwerten und Standardabweichungen der Erst- und der zeitlich standardisierten Zweitaufnahme nach 24 Jahren sowie zum anderen in Form der Anteile der resultierenden Wertstufen. Die Wertstufen (A, B, C) wurden nach den Rechenvorschriften von PAN/ILÖK (2010) für die drei Kriterien Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstruktur, Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars und Beeinträchtigung ermittelt. Dabei erfolgte die Ableitung der Waldentwicklungsphasen aus der Durchmesserverteilung der Auswertungseinheiten, unabhängig davon, ob es sich um ein- oder mehrschichtige Bestände handelte.
Die Datensätze wurden in einer MS-Access-Datenbank gespeichert. Die Datenauswertung für den lebenden Bestand und das Totholz erfolgte unter SAS 9.3 (SAS-Institute 2011), die der Vegetationsdaten mit R (Cran-Projekt – Version 3.1.0).
5 Ergebnisse
5.1 Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen
5.1.1 Waldentwicklungsphasen
Während die Anzahl der Waldentwicklungsphasen nur einer geringen Veränderung unterliegt (Abb. 5), zeigt sich eine erhebliche Zunahme des Anteils der Reifephase (starkes und sehr starkes Baumholz: Bäume >49cm BHD). Diese Entwicklung ist vor allem bei den LRT 9110, 9130 und 9160 zu erkennen. Hingegen ist die Veränderung beim LRT 9170 weniger deutlich. Auffällig ist der bereits bei der Erstaufnahme sehr hohe Anteil der Reifephase beim LRT 9190 (alte bodensaure Eichenwälder der Sandebenen), der nach 24 Jahren auf 100 % ansteigt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Waldentwicklungsphasen erst ab einem Flächenanteil von 5 % bzw. 10 % berücksichtigt werden (PAN/ILÖK 2010).
Die dargestellte Entwicklung führt im Fall der LRT 9110, 9130 und 9160 zu einer deutlichen Zunahme der Auswertungseinheiten mit Wertstufe B (Abb. 6). Wertstufe A wird allerdings nur in wenigen Einzelfällen erreicht. Interessanterweise zeigen die Auswertungseinheiten in den LRT 9170 und 9190 eher einen Trend in Richtung der Wertstufe C, obwohl der Anteil der Reifephase auch hier gestiegen ist. Dies ist offenbar auf eine Abnahme der jüngeren Waldentwicklungsphasen zurückzuführen, so dass nur noch eine Phase gezählt werden konnte und damit die Bedingungen für eine gute Wertstufe (B; = 2 Waldentwicklungsphasen) nicht mehr erfüllt waren. Hier deutet sich an, dass eine mehr oder weniger flächenhafte Reifung von Waldbeständen nach der Stilllegung gemäß der Anrechnungsvorschrift von PAN/ILÖK (2010) zu einer Verschlechterung der Wertstufe führen kann, da hierdurch die Phasenanzahl abnimmt.
5.1.2 Altbäume
Im Rahmen der vorliegenden Auswertung konnten ausschließlich die nach ihrem BHD ausgewählten sog. „Altbäume“ berücksichtigt werden. Die Datengrundlage über faktische Biotopbäume (Höhlenbäume, Bäume mit anderen Habitatstrukturen) war nicht ausreichend.
In allen Lebensraumtypen außer den „Alten Eichenwäldern der Sandebenen“ (LRT 9190) ist ein deutlicher Anstieg der Anzahl von Altbäumen festzustellen, die einen Brusthöhendurchmesser von 80 bzw. bei Weichlaubhölzern von 40cm überschreiten (Abb. 7). Diese Entwicklung führt zu einer deutlichen Verbesserung der erreichten Wertstufen (Abb. 8). Im Vergleich zu den Waldentwicklungsphasen lag jedoch bereits bei der Erstaufnahme der Anteil hervorragender Bewertung auf einem hohen Niveau.
Zwischen den Buchen- und den Eichen-LRT sind die Unterschiede der Mittelwerte, aber auch der Streubreiten groß. So ist die Altbaumdichte in den Buchen-LRT erheblich geringer und einheitlicher als in den Eichen-LRT.
5.1.3 Totholz
Eine ähnliche Entwicklung wie bei den Altbäumen zeigt sich auch bei der Totholzmenge (Abb. 9). Damit entwickeln sich auch hier die untersuchten Wald-LRT von einem mehrheitlich mittleren bis schlechten zu einem guten bis hervorragenden Zustand (Abb. 10). Aussagen für den LRT 9190 sind aufgrund der eingeschränkten Datengrundlage zum Totholz allerdings nicht möglich.
5.1.4 Vollständigkeit des Arteninventars: Lebensraumtypische Gehölzarten im Derbholzbestand
Bereits bei der Erstaufnahme lag der Anteil der Hauptbaumarten in allen betrachteten Buchen- und Eichen-Lebensraumtypen im Mittel bei mehr als 70 % (Abb. 11). Entsprechend machen die Nebenbaumarten im Durchschnitt weniger als 30 % Anteil aus. Pionierbaumarten sind nur in sehr geringen Anteilen vertreten.
Innerhalb des Untersuchungszeitraums von 24 Jahren sind Verschiebungen bei den Anteilen der Baumartengruppen und Wertstufen festzustellen (Abb. 11 und 12). In den LRT 9110 und 9130 zeigt sich eine Zunahme des mittleren Anteils der alleinigen Hauptbaumart Buche von 83 auf 86 % (LRT 9110) bzw. von 83 auf 84 % (LRT 9130). In den Eichen-LRT nimmt hingegen die Hauptbaumart Eiche im Mittel durchgehend ab: von 57 auf 54 % im LRT 9160, von 46 auf 43 % im LRT 9170 und von 79 auf 77 % im LRT 9190.
5.1.5 Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Zusammensetzung der Krautschicht
In der Krautschicht fällt bei allen LRT außer dem Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald (LRT 9160) eine Abnahme der lebensraumtypischen Artenzahl ins Auge (Abb. 13). Der Anteil dieser Arten steigt allerdings überwiegend an. Eine Darstellung der resultierenden Wertstufen ist für diesen Parameter nicht möglich, da hier gemäß PAN/ILÖK (2010) eine gutachterliche Einschätzung für jeden Einzelfall vorgesehen ist und Grenzwerte nicht genannt werden.
5.1.6 Beeinträchtigungen: Störzeiger und invasive Gehölzarten
Da sich die Deckungsanteile der Störzeiger (Definition nach PAN/ILÖK 2010) und der Neophyten in der Krautschicht in fast allen LRT auf einem geringen Niveau bewegen, ergibt sich überwiegend eine gute bis hervorragende Wertstufe mit tendenziell positiver Entwicklung (Abb. 14). Bei den Neophyten in der Krautschicht erreicht nur das Kleinblütige Springkraut (Impatiens parviflora) Deckungsanteile von über 1 %. Von den gebietsfremden Baumarten sind vereinzelt Rot-Eiche (Quercus rubra), Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), Späte Traubenkirsche (Prunus serotina), Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia) und Douglasie (Pseudotsuga menziesii) in der Krautschicht zu finden. Die Neophyten in den Derbholzaufnahmen liegen im Schnitt der Lebensraumtypen unter 0,3 %. Auf eine Darstellung der resultierenden Wertstufen wurde verzichtet, da diese durchgehend hervorragend waren.
6 Diskussion
Die FFH-Richtlinie sieht zwar ein Monitoring der LRT vor, nach mehr als 20 Jahren ist es aber für den größten Teil der LRT nicht möglich, die Entwicklung ihrer Erhaltungszustände deutschlandweit zu ermitteln. So können lediglich für 13 der 57 im jüngsten Nationalen Bericht betrachteten LRT Aussagen über tatsächliche Veränderungen getroffen werden (Ellwanger et al. 2014). Darunter befinden sich mit den LRT 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden) und 91U0 (Kiefernwälder der sarmatischen Steppe) nur zwei Wald-LRT, die zudem von geringer flächenmäßiger Bedeutung sind. Eine wesentliche Ursache für dieses Manko ist sicherlich die in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Erfassungs- und Bewertungsmethode (Winter & Seif 2011). Mit der Einbindung der Bundeswaldinventur in das FFH-Monitoring und der Entwicklung einer bundeseinheitlichen Bewertungssystematik (PAN/ILÖK 2010) sind hier in Zukunft deutliche Fortschritte zu erwarten. Allerdings wäre es wünschenswert, weitere Standardisierungen vorzunehmen, wie beispielsweise umfassendere und LRT-spezifische Listen von Störzeigern und eine reproduzierbare Ableitung der Wertstufen für die Artenzusammensetzung der Krautschicht.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass sich die großflächig verbreiteten Wald-LRT in Naturwaldreservaten im Laufe von 24 Jahren überwiegend positiv entwickeln. Dies gilt insbesondere für Buchen-LRT und diejenigen Merkmale, die mit der Reifung der Bestände in Zusammenhang stehen, wie Altbäume, Totholz und fortgeschrittene Waldentwicklungsphasen (Tab. 4). Vergleichbare Ergebnisse zeigen auch andere Studien aus NWR (Meyer & Schmidt 2011, Müller et al. 2007, Paillet et al. 2010).
Mittlerweile existieren zunehmend konkretere Vorstellungen über die Geschwindigkeit, mit der Strukturelemente reifer Wälder nach Stilllegung angereichert werden. Beispielsweise ist für Totholz in mitteleuropäischen NWR mit Akkumulationsraten zwischen 1,0 und 4,9m3 je Hektar und Jahr zu rechnen (Meyer & Schmidt 2011, Müller-Using & Bartsch 2007, Vanderkerkhove et al. 2009, von Oheimb et al. 2007).
Im Unterschied zu den Buchen-LRT stellt sich die Entwicklung der Eichen-LRT differenzierter dar. Hier verläuft die Entwicklung der Reifeparameter Altbäume und Totholz zwar auch positiv (Tab. 4), allerdings deutet sich ein schleichender Verlust der wertbestimmenden Hauptbaumart Eiche (Trauben- und Stiel-Eiche, Quercus petraea agg. und Q. robur) an. Abnehmende Eichenanteile wurden auch in Naturwaldreservaten der Schweiz (Brang et al. 2011, Rohner et al. 2013), Bayerns (Endres & Förster 2014), Nordrhein-Westfalens (Becker 1989, Schulte 2012) und Niedersachsens (Meyer 2013a, Meyer et al. 2000, 2006) festgestellt.
Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die einheimischen Eichenarten in stillgelegten Wäldern langfristig vollständig verschwinden (Dölle et al 2013, Rohner et al. 2013). Kritisch ist dabei nicht nur der Rückgang des Alteichenbestands, sondern auch die ausbleibende Eichen-Verjüngung (Dölle et al. 2013, Kölbel 1996). Auf der Grundlage einer umfangreichen Zusammenstellung von Untersuchungsergebnissen aus Waldreservaten des mittel- und westeuropäischen Tieflands stellt Vera (2000) fest, dass in keinem der betrachteten Gebiete eine junge Eichen-Generation nachgewiesen werden konnte. Die Alteichen fallen nach seiner Recherche infolge der Konkurrenz durch Schattbaumarten i.d.R. in weniger als einem Jahrhundert aus. Auch waldwachstumskundliche Versuchsergebnisse zeigen, dass die nachhaltige Sicherung von Eichen in Mischung mit Schattbaumarten Pflegemaßnahmen voraussetzt (Bonnemann 1956, Spellmann 2001). Im Gegensatz zu den vorgenannten Untersuchungen halten Jedicke & Hakes (2005) den ausbleibenden Eichen-Nachwuchs in stillgelegten Altbeständen für nicht ausreichend belegt und rufen zu intensiveren langfristigen Untersuchungen auf. Schlüsselrollen für die Naturverjüngung der beiden Eichenarten als Lichtbaumarten könnten „Katastrophen“ (Sturm, Waldbrand) spielen. Zudem ist ihre erfolgreiche Naturverjüngung an den Rändern von Gehölzbeständen sowie in halboffenen Weidelandschaften, in denen Phasen der Weideruhe mit Beweidungsphasen abwechseln, gut belegt (Böhm 2015, Reif & Gärtner 2007).
In der vorliegenden Untersuchung ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Baumartenanteile zugunsten der Buche bzw. anderer Nebenbaumarten verschieben, überraschend gering. Wenn die Veränderungsrate in der ermittelten Höhe anhält, dürften Alteichen noch viele Jahrzehnte lang das Waldbild der Eichen-LRT prägen. Allerdings ist eine entsprechende Vorhersage mit hohen Unsicherheiten verbunden, da durchaus auch eine beschleunigte Abnahme vorstellbar ist.
Tendenzen einer Homogenisierung der Bestandesstruktur deuten sich bisher nur in den Eichen-LRT 9170 und 9190 an. Dass sich mit zunehmender Entwicklungszeit eines stillgelegten Waldes eine gleichmäßigere Waldstruktur herausbildet, konnte bisher nur in Einzelfällen und für einen begrenzten Zeitraum nach der Stilllegung gezeigt werden (Heiri et. al. 2011). Offenbar führen Störungen durch Stürme, Insektenbefall oder Krankheiten, wie z.B. die Buchen- und Eichen-Komplexkrankheit, immer wieder zu Auflockerungen des Kronendachs und verhindern damit die Entwicklung dicht geschlossener Bestände auf großer Fläche. Zudem wird durch diese Störungen die Totholzmenge und -vielfalt erhöht.
Die Entwicklung der Bodenvegetation nach Stilllegung ist durch eine Abnahme der Artenvielfalt charakterisiert. Ein Rückgang der Krautschicht-Artenzahlen und Deckungsgrade nach Aufgabe der Nutzung in Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwäldern ist aus Naturwaldreservaten vielfach belegt (Heinrichs et. al. 2011, Schmidt 2013, Schmidt & Schmidt 2007). Auch in einer europaweiten Metastudie wurde für Gefäßpflanzen in bewirtschafteten Wäldern eine höhere Artenzahl als in unbewirtschafteten Beständen bestätigt (Paillet et al. 2010). Durch das höhere Lichtangebot sowie durch heterogenere Bodenbedingungen weisen Wirtschaftswälder häufig eine höhere Gefäßpflanzenartenvielfalt auf als Naturwaldreservate. Zudem kann in Wirtschaftswäldern durch Bodenstörungen bei Fäll- und Rückearbeiten die Samenbank des Bodens aktiviert werden, in der langlebige Diasporen von Waldpflanzen enthalten sind. Der Rückgang der Artenzahlen nach Aufgabe der Nutzung bettrifft auch die LRT-typischen Arten. Da allerdings die untypischen Arten in Deckungsgrad und Artenzahl stärker abnehmen, steigt der Anteil der lebensraumtypischen Arten in den meisten LRT deutlich an.
Die Mehrzahl der Bestände der Buchen-LRT weist einen relativ geringen Anteil an Störzeigern in der Krautschicht auf. Grundsätzlich profitieren Störzeiger von einer Bewirtschaftung, da sie auf ein verändertes Ressourcenangebot (z.B. Licht, Wasser, Stickstoff) in Waldbeständen schnell reagieren können (Meyer & Schmidt 2008). Ihr Auftreten ist meist mittelfristig reversibel (Schmidt 2013). Eine Ausnahme können Störzeiger bilden, die bei Bodenverdichtung auftreten, da die Veränderungen des Bodenwasserhaushalts durch Verdichtung meist lange anhalten (Gaertig & Green 2008). Naturwaldreservate sind Weiserflächen für eine natürliche Waldentwicklung (Bücking 1994) und die dort gewonnenen Erkenntnisse sollten daher genutzt werden, um die gegenwärtige Bewertungssystematik für die natürlichen Wald-LRT zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Im Hinblick auf die Bodenvegetation der Buchenwald-LRT ergibt sich die Problematik von naturnahen Beständen ohne Krautschicht, die früher häufig als „Fagetum nudum“ bezeichnet wurden (vgl. Schmid & Leuschner 1998). Eine gute bis hervorragende Ausprägung wird hier weniger durch die Präsenz der typischen Arten als vielmehr durch das Fehlen der untypischen indiziert, so dass das Kriterium „Vollständigkeit des Arteninventars der Bodenvegetation“ problematisch ist.
Dass die untersuchten Eichenwälder als natürliche LRT einzuschätzen sind, wird durch die vorliegenden Ergebnisse in Übereinstimmung mit zahlreichen weiteren Studien in Frage gestellt (vgl. auch Müller-Kroehling 2013). Tatsächlich sind offenbar viele der als LRT angesprochenen Bestände hinsichtlich ihrer standörtlichen Verhältnisse – insbesondere ihres Wasserhaushalts – so stark verändert worden und/oder aus kulturhistorischer Nutzung hervorgegangen, dass sie nicht als natürliche Eichenwälder angesehen werden können. Diese Problematik wurde bereits bei der Konzeption der FFH-Richtlinie bedacht. So sollten als LRT 9160 nur Waldbestände mit hohem Grundwasserstand, die nicht durch kulturhistorische Nutzung entstanden sind, ausgewiesen werden (European Commission DG Environment 2003).
Bei der Definition der LRT 9160 und 9170 für Deutschland werden ausdrücklich auch als Ersatzgesellschaft von Buchenwäldern entstandene Waldbestände einbezogen, deren Pflege jedoch nicht für erforderlich gehalten wird (Ssymank et al. 1998). Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass in der Praxis überwiegend sekundäre Eichen-Hainbuchenwälder als LRT ausgewiesen wurden. Diese sind konsequenterweise als nutzungs- bzw. pflegeabhängige LRT einzustufen und ihre Stilllegung wird den Erhaltungszielen der FFH-Richtlinie langfristig entgegen laufen. Bestätigung findet diese Einschätzung in Berichten der Bundesländer zum Erhaltungszustand der Lebensraumtypen (Fritzlar et al. 2009, Lux et al. 2014).
7 Schlussfolgerungen und Ausblick
Zwar können die vorliegenden Ergebnisse zeigen, wie sich die Buchen- und Eichen-LRT in Naturwaldreservaten mittelfristig entwickeln, sie können aber nicht belegen, dass die Entwicklung ausschließlich auf die Stilllegung zurückgeht. Vergleichsstudien zeigen, dass die Unterschiede zwischen NWR und Wirtschaftswäldern stark von der Dauer der Stilllegung und dem betrachteten Merkmal abhängen. Langfristig aus der Nutzung genommene Wälder weisen i.d.R. deutliche Unterschiede zu Wirtschaftswäldern auf (Winter 2006). In mittleren Zeiträumen von wenigen Jahrzehnten lassen sich hingegen oft nur geringe Unterschiede erkennen (Balcar 2014). Dies gilt beispielsweise auch für die Totholzmenge (Blaschke et al. 2013, Meyer 2013b). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass auch die Zustände in Wirtschaftswäldern mittel- bis langfristigen Veränderungen unterliegen. Dies zeigen die Zunahmen des Flächenanteils alter Wälder und der Totholzmenge im deutschen Wald (BMEL 2014).
Da der Flächenumfang stillgelegter Wälder in Deutschland auf Dauer eng begrenzt ist (Wildmann et al. 2014) und die FFH-Richtlinie nicht darauf abzielt, die forstliche Bewirtschaftung auszuschließen (Jünger 2001a), wird auch in Zukunft der weit überwiegende Teil der Wald-LRT forstlich bewirtschaftet werden. Es stellt sich daher die drängende Frage, wie eine gleichermaßen naturschutzgerechte wie ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von FFH-LRT sichergestellt werden kann (vgl. Jünger 2001b). Mittlerweile ist unstrittig, dass die naturschutzfachlichen Auflagen der FFH-Richtlinie erhebliche betriebswirtschaftliche Effekte haben können. So errechnen Rosenkranz et al. (2012) am Beispiel von 21 Forstbetrieben mittlere Verluste von 20 bis 28 % des waldbaulichen Deckungsbeitrags bezogen auf die Fläche der FFH-Lebensraumtypen. Die größte Herausforderung besteht darin, einerseits Altbäume, Reifephasen und Totholz zu erhalten und andererseits eine rentable Holzproduktion und erfolgreiche Verjüngung der Waldbestände sicherzustellen. Auch wenn nahezu alle größeren öffentlichen Forstbetriebe in Deutschland Programme zur Anreicherung von Altbäumen und Totholz im Wirtschaftswald umsetzen (Schaber-Schorr 2010), sind die Erfahrungen mit den auch als „Retention-Forestry“ bezeichneten Verfahrensweisen bisher begrenzt (vgl. Gustafsson et al. 2012). Um auf diesem Weg weiter zu kommen, sind waldbaulich-naturschutzfachliche Experimente erforderlich (Aubry et al. 2009), in denen NWR sinnvollerweise eine Variante flächenhafter Stilllegung darstellen können.
Besonders ausgeprägt ist die Problematik bei Eichen-LRT. Obwohl sich deutlich abzeichnet, dass ihre flächenhafte Stilllegung langfristig nicht sinnvoll ist, stellt sich insbesondere bei der Lichtbaumart Eiche die Frage, in welchem Umfang Altbäume verbleiben können, ohne den wirtschaftlichen Erfolg und die Verjüngung zu gefährden. Wie groß sollten die Verjüngungsflächen sein und wie sind sie räumlich zu verteilen? Wie viele Altbäume sollten in welchem räumlichen Muster belassen werden? Welche Vor- und Nachteile hat welches Vorgehen in ökonomischer und naturschutzfachlicher Hinsicht? Auch diese Fragen können nur durch entsprechende waldbaulich-naturschutzfachliche Experimente beantwortet werden.
Literatur
Albrecht, L. (1988): Ziele und Methoden forstlicher Forschung in Naturwaldreservaten. Schweiz. Z. Forstwes. 139, 373-387.
Aubry, K.B., Halpern, C.B., Peterson, C.E. (2009): Variable-retention harvests in the Pacifc Northwest: A review of short-term findings from the DEMO study. Forest Ecology and Management 258, 398-408.
Balcar, P. (2014): Zur Arten- und Lebensraumvielfalt unserer heimischen Wälder – Vergleichende Naturwaldforschung. AFZ/DerWald 69, 7-9.
Becker, A. (1989): Buche und Eiche: Veränderungen im Mischungsverhältnis in zehn Jahren. LÖLF-Mitt. (3), 16-19.
Blaschke, M., Lauterbach, M., Endres, U. (2013): Naturwaldreservat Wolfsee – Dicke Eichen und eine bemerkenswerte Vogelwelt machen das fränkische Naturwaldreservat zu einem außergewöhnlichen Vogelparadies. LWF-aktuell 96, 42-44.
Böhm, C.H. (2015): Eichenmischwald-Lebensraumtypen. In: Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Ellwanger, G., Finck, P., Grell, H., Hauswirth, L., Herrmann, A., Jedicke, E., Joest, G., Kämmer, G., Köhler, M., Kolligs, D., Krawczyski, R., Lorenz, A., Luick, R., Mann, S., Nickel, H., Raths, U., Reisinger, E., Riecken, U., Rössling, H., Sollmann, R., Ssymank, A., Thomsen, K., Tischew, S., Vierhaus, H., Wagner, H.-G., Zimball, O., Ganzjährige Weidelandschaften und NATURA 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000, Heinz Sielmann Stiftung, Hrsg., Duderstadt, 130-143.
Bonnemann, A. (1956): Eichen-Buchen-Mischbestände. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 127, 33-42 u. 118-126.
Brang, P., Streit, K., Meier, F. (2011): Bois de Chênes – Buchen holen sich ihr Terrain zurück. In: Brang, P., Heiri, C. und Bugmann, H., Waldreservate – 50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz, Haupt, Bern, 272 S.
Bücking, W. (1994): Ziele und Auswahl von Naturwaldreservaten in Deutschland. Allgemeine Forst Zeitschr. 11, 561-562.
Bücking, W. (1997): Naturwald, Naturwaldreservate, Wildnis in Deutschland und Europa. Forst und Holz 52 (18), 515-522.
BMEL (Bundesminsterium für Ernährung und Landwirtschaft, 2014): Der Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. http://www.bundeswaldinventur.de/index.php?id=541 (17.03.2015).
Dölle, M., Heinrichs, S., Schmidt, W., Schulte, U. (2013): Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – die Entwicklung der Naturwaldzelle „Am Sandweg“, ein Eichen-Hainbuchenwald in einem FFH-Gebiet der Niederrheinischen Bucht. Archiv für Forstwesen und Landschaftsökol. (6), 1-12.
Ellwanger, G., Ssymank, A., Buschmann, A., Ersfeld, M., Frederking, W., Lehrke, S., Neukirchen, M., Raths, U., Sukopp, U., Visher-Leopold, M. (2014): Der nationale Bericht 2013 zu Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie. Natur und Landschaft 89 (5), 185-192.
Endres, U., Förster, B. (2014): Die Eiche in Naturwaldreservaten – auf dem absteigenden Ast? LWF Wissen 75, 70-73.
European Commission, DG Environment (2003): Interpretation Manual of European Union Habitats. 126 pp. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm (17.03.2015)
Fritzlar, F., van Hengel, U., Westhus, W., Lux, A. (2009): Der Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Thüringen 2001 bis 2006. Landschaftspfl. Natursch. Thüringen 46 (2), 53-64.
Gaertig, T., Green, K. (2008): Die Waldbodenvegetation als Weiser für Bodenstörungen. AFZ/Der Wald 6, 300-301.
Gustafsson, L., Baker, S.C., Bauhus, J., Beese, W.J., Brodie, A., Kouki, J., Lindenmayer, D.B., Löhmus, A., Pastur, G.M., Messier, C., Neyland, M., Palik, B., Sverdrup-Thygeson, A., Volney, W.J.A., Wayne, A., Franklin, J.F. (2012): Retention forestry to maintain multifunctional forests: A world perspective. BioScience 62 (7), 633-645.
Heinrichs, S., Schulte, U., Schmidt, W. (2011): Veränderung der Buchenwaldvegetation durch Klimawandel? Ergebnisse aus Naturwaldzellen in Nordrhein-Westfalen. Forstarchiv 82 (2), 48-61.
Heiri, C., Brang, P., Commarmot, B., Matter, J.-F., Bugmann, H. (2011): Walddynamik in Schweizer Naturwaldreservaten. In: Brang, P., Heiri, C. und Bugmann, H., Waldreservate – 50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz. Haupt, Bern, 272S.
Jedicke, E., Hakes, W. (2005): Management von Eichenwäldern im Rahmen der FFH-Richtlinie. Naturschutz und Landschaftsplanung 37 (2), 37-45.
Jünger, F. (2001a): Standpunkte der EU-Kommision zur Umsetzung der FFH-Richtlinie. AFZ/DerWald 12, 637-640.
– (2001b): Umsetzung der FFH-Richtlinie. AFZ/Der Wald 4,181-185.
Kölbel, M. (1996): Waldkundliche Untersuchungen im Naturwaldreservat Seeben. Schr.-R. Naturwaldreservate in Bayern 3, 55-76.
Lux, A., Baierle, H.U., Boddenberg, J., Fritzlar, F., Rothgänger, A., Uthleb, H., Westhus, W. (2014): Der Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Thüringen 2007 bis 2012. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 51 (2), 51-66.
Meyer, P. (2013a): Naturwaldreservate und ihre Erforschung in Deutschland: Erreichtes und Erwartungen. Schr.-R. Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen 23, 124-129.
– (2013b): Reifungsprozesse in Buchen-Naturwaldreservaten: Wie schnell werden Wirtschaftswälder zu Urwäldern? AFZ/DerWald 24, 11-13.
–, Schmidt, M. (2008): Aspekte der Biodiversität in Buchenwäldern – Konsequenzen für eine naturnahe Bewirtschaftung. Beiträge der NW-FVA 3, 159-192.
–, Schmidt, M. (2011): Dead wood accumulation in abandoned beech (Fagus sylvatica L.) forests in northwestern Germany. Forest Ecology and Management 261, 342-352.
–, Unkrig, W., Griese, F. (2000) Dynamik der Buche (Fagus sylvatica L.) in nordwestdeutschen Naturwaldreservaten. Forst und Holz 55 (15), 470-476.
–, Wevell v. Krüger, A., Steffens, R., Unkrig, W. (2006): Naturwälder in Niedersachsen – Schutz und Forschung. Band 1. Leinebergland Druck, Alfeld, 339 S.
Müller, J., Hothorn, T., Pretzsch, H. (2007): Long-term effects of logging intensity on structures, birds, saproxylic beetles and wood-inhabitating fungi in stands of European beech Fagus sylvatica L. Forest Ecology and Management 242, 297-305.
Müller-Kroehling, S. (2013): Eichenwald-Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in Deutschland – drängende Fragen und mögliche Ansätze für ein Konzept zu Erhalt und Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes. Naturschutz und Biologische Vielfalt 131, 199-207.
Müller-Using, S., Bartsch, N. (2007): Totholz im Elementhaushalt eines Buchenbestandes. Forstarchiv 7, 12-23.
Oheimb, G.v., Westphal, C., Härdtle, W. (2007): Diversity and spatio-temporal dynamics of dead wood in a temperate near-natural beech forest (Fagus sylvatica). European Journal of Forest Research 126, 359-370.
Paillet, Y., Bergès, L., Hjältã, J., Ódor, P., Avon, C., Bernhardt-Römermann, M., Bijlsma, R.J., de Bruyn, L., Fuhr, M., Grandin, U., Kanka, R., Lundin, L., Luque, S., Magura, T., Matesanz, S., Mészáros, I., Sebastià, M.T., Schmidt, W., Standovár, T., Tóthmérész, B., Uotila, A., Valladares, F., Vellak, K., Virtanen, R. (2010): Biodiversity differences between managed and unmanaged forests: meta-analysis of species richness in Europe. Conservation Biology 24, 101-112.
PAN & ILÖK (2010): Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Deutschland – Überarbeitete Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeitskreise als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring, Arbeitspapier eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf (12.05.2014).
Reif, A., Gärtner, S. (2007): Die natürliche Verjüngung der laubwerfenden Eichenarten Stieleiche (Quercus robur L.) und Traubeneiche (Quercus petraea Liebl.) – eine Literaturstudie mit besonderer Berücksichtigung der Waldweide. Waldökologie online 5, 79-116.
Rohner, B., Bugmann, H., Brang, P., Wunder, J., Bigler, C. (2013): Eichenrückgang in Schweizer Naturwaldreservaten. Schweiz Z. Forstwes 11, 328-336.
Rosenkranz, L., Wippel, B., Seintsch, B., Becker, G., Dieter, M. (2012): Auswirkungen der FFH-Maßnahmenplanungen auf die Waldbewirtschaftung. AFZ/Der Wald 20, 12-14.
Schaber-Schorr, G. (2010): Alt- und Totholzkonzepte der Bundesländer. Fachliche Anforderungen, Ziele und Handlungsansätze. AFZ/Der Wald 1, 8-9.
Schmid, I., Leuschner, C. (1998): Warum fehlt den Gipsbuchenwäldern des Kyffhäusers (Thüringen) eine Krautschicht? Forstw. Cbl. 117, 277-288.
Schmidt, M. (2013): Vegetationsentwicklung in Buchenwäldern nach Aufgabe der forstlichen Nutzung. AFZ/DerWald 24, 14-15.
–, Schmidt, W. (2007): Vegetationsökologisches Monitoring in Naturwaldreservaten. Forstarchiv 78, 205-214.
Schulte, U. (2012): 40 Jahre Naturwaldreservate in NRW. Natur in NRW 2, 31-35.
Spellmann, H. (2001): Bewirtschaftung der Eiche auf der Grundlage waldwachstumskundlicher Untersuchungen in Nordwestdeutschland. Beitr. Forstwirtsch. u. Landschaftsökol. 35 (3), 145-152.
Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, C., Schröder, E. (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch. 53, 1-560.
Trautmann, W. (1980): Die Bedeutung der Naturwaldreservate für Schutzgebietssysteme. Natur und Landschaft 55, 133-134.
Vandekerkhove, K., De Keersmaeker, L., Menke, N., Meyer, P., Verscheide, P. (2009): When nature takes over from man: Dead wood accumulation in previously managed oak and beech w
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


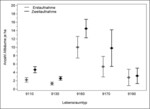
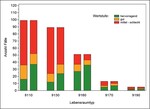
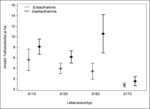
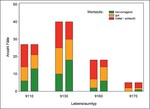






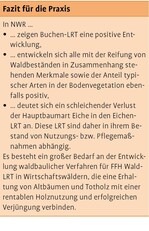
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.