Berücksichtigung des Klimawandels in der Landschaftsrahmenplanung
Abstracts
Der Klimawandel ist in den letzten Jahren zu einem der zentralen Themen der Naturschutzdiskussion geworden. Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob und in welchem Umfang dies bereits Eingang in die Praxis der Landschaftsplanung gefunden hat. Hierzu wurden bundesweit 171 Landschaftsrahmen- und Regionalpläne ausgewertet. Zunächst wurde untersucht, ob Unterschiede aufgrund des Aufstellungsjahrs der Pläne sowie zwischen Bundesländern bestehen. Zusätzlich wurden 21 ausgewählte Pläne inhaltlich vertieft betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass Landschaftsrahmenpläne den Klimawandel und seine Folgewirkungen seit 1995 zunehmend berücksichtigen und insbesondere in den letzten Jahren Maßnahmen und Ziele zu Klimaschutz und -anpassung formulieren. Zwischen den Bundesländern sind deutliche Unterschiede erkennbar, deren Ursachen sich jedoch nicht feststellen ließen. Die inhaltliche Analyse zeigte, dass der Klimawandel zwar mittlerweile auf vielfältige Weise in Landschaftsrahmenplänen behandelt wird, allerdings wird er nicht umfassend analysiert und systematisch über alle Planungsschritte hinweg behandelt.
Consideration of Climate Change in Landscape Framework Planning – An overview on federal level
Over the last years, the climate change has become one of the central subjects of debate in the field of nature conservation. The paper presented considers the question if and to what extent this topic has found its way into practical landscape planning. The study has analysed 171 regional plans and landscape framework plans throughout Germany, investigating potential differences due to the year of production or depending on the federal state. Additionally 21 select plans were surveyed more thoroughly. The results show that since 1995 landscape framework plans have increasingly considered the change of the climate and its effects and have defined measures and goals on climate protection and adaptation. There are significant differences amongst the states, but the reasons for these deviations could not be identified. Their content analysis showed that the climate change meanwhile has been dealt with in various ways but lacks comprehensive analyses and a systematic approach comprising all planning steps.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Die Notwendigkeit, den Klimawandel und seine Auswirkungen im Rahmen von Naturschutzstrategien, -maßnahmen und -instrumenten zu berücksichtigen, ist mittlerweile durch eine Vielzahl an Veröffentlichungen dargelegt und bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Begründungen. Diese Notwendigkeit gilt auch für die Landschaftsplanung als dem flächendeckenden Planungsinstrument des Naturschutzes, das zudem einen wesentlichen Beitrag zur Raumordnungs- und Bauleitplanung leistet (vgl. u.a. Heiland et al. 2008, Jessel 2008, Wilke et al. 2011). Auch Aussagen im „Aktionsplan Anpassung“ (Bundesregierung 2011) sowie im fünften Sachstandsbericht des IPCC (2014) lassen sich so verstehen.
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Indikatorensystem zur Darstellung direkter und indirekter Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt“ (Schliep et al. 2015) ein Indikator zur Berücksichtigung des Klimawandels in der Landschaftsplanung entwickelt und berechnet. Dieser erfasst bundesweit die Thematisierung des Klimawandels in rund 170 Landschaftsrahmenplänen sowie den Landschaftsprogrammen der Bundesländer, die jeweils zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2000, 2005, 2010 und 2012 gültig waren (d.h. dass einzelne Pläne im Zeitverlauf mehrfach erfasst werden können). Bei primär integrierten Landschaftsplänen wurde das Kapitel „Natur und Landschaft“ des jeweiligen Raumordnungsplans zur Analyse herangezogen.
Die Wahl fiel auf Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne, da diese aufgrund ihrer relativ begrenzten Anzahl im Gegensatz zu kommunalen Landschaftsplänen repräsentative Aussagen mit einem geringeren Erhebungsaufwand zulassen. Zudem sind Landschaftsrahmenpläne gemäß dem novellierten Bundesnaturschutzgesetz (2009) die einzigen, die ohne Erfordernisvorbehalt verbindlich aufzustellen sind. Darüber hinaus dienen sie als Vermittler zwischen Landes- und kommunaler Ebene und können zudem in besonderer Weise „Serviceaufgaben“ für die kommunale Landschaftsplanung übernehmen, um diese zu entlasten (vgl. Wilke et al. 2011).
Die Pläne wurden entsprechend der unterschiedlichen Intensität der Behandlung des Themas folgenden Kategorien zugeordnet:
Kategorie 1: Der Klimawandel allgemein bzw. Flächen mit Speicher- bzw. Senkenfunktion für Kohlenstoff werden erwähnt.
Kategorie 2: Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt werden beschrieben.
Kategorie 3a: Einzelne naturschutzfachliche Ziele und Maßnahmen werden u.a. mit dem Klimawandel begründet.
Kategorie 3b: Einzelne naturschutzfachliche Ziele und Maßnahmen werden ausschließlich oder vorwiegend mit dem Klimawandel begründet.
Abb. 1 zeigt die Ergebnisse. Es wird deutlich, dass der Klimawandel im Zeitverlauf in einer zunehmenden Anzahl der Pläne thematisiert wird, dass dabei aber die relativ „oberflächliche“ Kategorie 1 gegenüber denjenigen Kategorien überwiegt, die eine tiefer gehende Behandlung der Thematik indizieren.
Der Indikator soll zukünftig – ebenso wie allen anderen des vorgeschlagenen Indikatorensystems – der regelmäßigen Berichterstattung der Bundesregierung dienen. Die erforderlichen Daten müssen daher relativ schnell und einfach zu erheben sein. Deshalb ließ und lässt die „Berechnung“ des Indikators detaillierte inhaltliche Aussagen und Bewertungen nur bedingt zu. Die statistische Auswertung ließ z.B. keinen Schluss auf das Alter der Pläne, die Verteilung der Ergebnisse auf Ebene der Bundesländer oder die Inhalte der Ziele und Maßnahmen zu. Aus diesem Grund wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit (Radtke 2015) 171 Landschaftsrahmenpläne (bzw. Regionalpläne) aus allen Bundesländern vertieft untersucht. Dabei sollten
1. die Berücksichtigung des Klimawandels im zeitlichen Verlauf anhand des Aufstellungszeitpunkts der Pläne,
2. mögliche Unterschiede zwischen den Bundesländern sowie
3. Art und Umfang der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Klimawandel in der Landschaftsrahmenplanung beschrieben werden.
Vorgehensweise und wesentliche Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Folgenden vorgestellt.
2 Untersuchungsumfang und -design
In Anlehnung an die oben vorgestellten Kategorien aus dem F+E-Vorhaben wurden die Aussagen in den Landschaftsrahmenplänen drei weiterentwickelten Kategorien zugeordnet. Dafür wurde Kategorie 1 sprachlich genauer gefasst, und aus Kategorie 2 wurden die Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholung ausgeklammert, da diese keinen Zusammenhang zur hier betrachteten Biodiversität haben. Die Kategorien 3a und 3b wurden zur Kategorie 3 zusammengefasst, da im Rahmen der Bachelorarbeit eine vertiefte Betrachtung der einzelnen Ziele und Maßnahmen vorgenommen wurde. Die weiterentwickelten Kategorien lauten nun:
Kategorie 1: Der Klimawandel allgemein und/oder Speicher- bzw. Senkenfunktion einzelner Flächen für Kohlenstoff werden erwähnt.
Kategorie 2: Unmittelbare Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt oder auf Schutzgüter, deren Beeinträchtigung mittelbar auf die biologische Vielfalt wirkt, werden beschrieben (nicht untersucht wurden Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholung).
Kategorie 3: Einzelne Ziele und Maßnahmen werden ganz oder teilweise mit dem Klimawandel begründet.
Die Zuordnung eines Plans zu Kategorie 2 oder 3 schließt dabei automatisch auch eine Zuordnung zu Kategorie 1 ein. Hingegen bedeutet die Zuordnung zu Kategorie 3 nicht zwingend auch die Zuordnung zu Kategorie 2.
Anschließend wurden die Ergebnisse dieser Kategorisierung in drei Schritten analysiert:
Analyseschritt 1 – zeitliche Analyse: Es wurde untersucht, ob Unterschiede in Bezug auf das Aufstellungsjahr der Pläne bestehen.
Analyseschritt 2 – raumbezogene Analyse: Es wurde untersucht, ob Unterschiede zwischen den Plänen einzelner Bundesländer bestehen. Im Gegensatz zu Analyseschritt 1 wurden hier nur jene Pläne betrachtet, die zum Stichtag 31. Dezember 2012 gültig waren.
Analyseschritt 3 – inhaltliche Analyse: Es wurde untersucht, aus welchen Daten- und Kenntnisgrundlagen Aussagen abgeleitet, welche Auswirkungen beschrieben, welche Schutzgüter thematisiert und welche konkreten Ziele und Maßnahmen formuliert werden. Dabei wurden 21 ausgewählte Pläne untersucht, deren Aussagen auch der Kategorie 3 zugeordnet werden konnten.
3 Datengrundlagen und Methoden
Die Datengrundlagen bzw. auszuwertenden Pläne entsprechen weitgehend jenen, die im o.g. F+E-Vorhaben verwendet wurden. Einzelne damals nicht vorliegende oder erst 2013 aufgestellte Pläne kamen hinzu. Bereits während der Auswertung für das F+E-Vorhaben zeigte sich, dass in Plänen, die vor 1995 aufgestellt wurden, keine Erwähnung des Klimawandels oder klimawandelrelevanter Flächen auftritt. Deshalb flossen in die zeitliche Untersuchung nur Pläne und deren Fortschreibungen ein, die seit 1995 aufgestellt wurden.
Es wurden Pläne aus zwölf Bundesländern berücksichtigt. Da in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie im Saarland keine Landschaftsrahmenpläne aufgestellt werden, waren diese Länder von den Untersuchungen ausgenommen. In Bundesländern mit Primärintegration der Landschaftsplanung in die Raumplanung (Bayern, Rheinland- Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen) wurden anstelle der Landschaftsrahmenpläne die Kapitel „Natur und Landschaft“ der jeweiligen Regionalpläne ausgewertet. Gleiches gilt für Thüringen, da dort nur Landschaftsrahmenpläne von 1994 vorliegen, jedoch Regionalpläne neueren Datums mit entsprechend aktualisierten Aussagen zu Natur und Landschaft verfügbar sind.
Analyseschritt 1: zeitliche Analyse
Für Analyseschritt 1 wurden sämtliche eben erwähnte Pläne verwendet, die in Tab. 1 nochmals zusammengestellt sind. Insgesamt ergibt sich ein Untersuchungsumfang von 146 Plänen und Teilfortschreibungen, darunter 95 Landschaftsrahmenpläne und deren Fortschreibungen sowie 51 Regionalpläne und deren Fortschreibungen.
Die Datenmenge schwankt erheblich zwischen den Jahren. So lagen für das Jahr 1996 insgesamt 17 Pläne vor, für 2005 nur drei. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen.
Analyseschritt 2: raumbezogene Analyse
Um die aktuelle Situation der Berücksichtigung des Klimawandels durch die Planwerke der Landschaftsrahmenplanung abzubilden, wurden die bundesweit zum Stichtag 31.12.2012 gültigen Landschaftsrahmenpläne betrachtet. Insgesamt wurden für die räumliche Untersuchung 141 Pläne mit Gültigkeit zum 31. Dezember 2012 ausgewertet (s. Tab. 2), darunter 25 Pläne, die vor 1995 aufgestellt und somit nicht in Analyseschritt 1 berücksichtigt wurden.
Analyseschritt 3: inhaltliche Analyse ausgewählter Pläne
Dieser Analyseschritt widmet sich der vertieften inhaltlichen Untersuchung von Plänen, die Aussagen der Kategorie 3 enthalten, also Ziele oder Maßnahmen (auch) mit Bezug auf den Klimawandel formulieren. Es wurden 21 Pläne aus sechs Bundesländern betrachtet, die durchschnittlich sieben Jahre alt sind. Tab. 3 gibt einen Überblick über die ausgewerteten Pläne. 19 Pläne sind Landschaftsrahmenpläne, darunter eine Teilfortschreibung, zwei sind Regionalpläne.
In diesem Analyseschritt sollte auch untersucht werden, ob die Berücksichtigung von Aspekten des Klimawandels konsequent über alle Arbeitsschritte der Landschaftsplanung hinweg erfolgt, also z.B. Ziele und Maßnahmen schlüssig aus der vorhergehenden Bestandserhebung und -bewertung abgeleitet werden. Um die Pläne entsprechend systematisch untersuchen zu können, wurde ein Auswertungsbogen erstellt (s. Textkasten), der bestimmte Anforderungskriterien an die Behandlung von Klimawandelaspekten in der Landschaftsrahmenplanung stellt. Diese Kriterien wurden in Anlehnung an Aussagen von Wilke et al. (2011) entwickelt und den Arbeitsschritten I. Bestandserhebung und -bewertung, II. Ziel- und Leitbildentwicklung sowie III. Maßnahmen/Erfordernisse inkl. Monitoring zugeordnet.
4 Ergebnisse
4.1 Analyseschritt 1 – zeitliche Analyse
Die Annahme, dass der Klimawandel im zeitlichen Verlauf zunehmend in der Landschaftsrahmenplanung Berücksichtigung findet, kann bestätigt werden, wie Abb. 2 zeigt. Dargestellt ist der Anteil der Pläne, die die Kategorien 1, 2 und/oder 3 erreichen, an der Gesamtzahl der aufgestellten Pläne pro Jahr.
Die ersten Pläne erwähnen den Klimawandel 1996, alle drei Kategorien treten in diesem Jahr erstmals auf. Dies nimmt in den folgenden Jahren zu. 2013 nehmen bereits alle untersuchten Pläne Bezug auf den Klimawandel und seine Folgen. Drei Viertel formulieren zudem entsprechende Ziele und Maßnahmen.
Bei den Plänen, die bereits im Jahr 1996 auf den Klimawandel oder auf Flächen mit Funktion als Kohlenstoffsenke oder -speicher (Kategorie 1) eingehen, handelt es sich um die Landschaftsrahmenpläne der Landkreise Gransee, Templin, Nienburg/Weser und Lüneburg sowie der Planungsregionen Mittleres Mecklenburg und Vorpommern. Unterschiede zwischen den Plänen und gegenüber späteren Plänen zeigen sich sowohl in der Tiefe der Betrachtung als auch in der Begriffswahl: Fünf der sechs Pläne nennen die Funktion des Waldes als Kohlendioxidspeicher oder -senke, der Zusammenhang zum globalen Klima wird in der Regel über die Begriffe „Treibhausgas“ und „Treibhauseffekt“ hergestellt (Landkreis Lüneburg 1996, LAUN 1996a, b; Thode + Partner Büro 1996). Die Pläne der Regionen Mittleres Mecklenburg und Vorpommern beschreiben die Notwendigkeit der Wiederherstellung von Niedermooren als Beitrag zum „globalen Klimaschutz“ (LAUN 1996a: II-80, LAUN 1996b: II-73).
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Nienburg/Weser (Landkreis Nienburg/Weser 1996) geht, verglichen zu den anderen für diesen Zeitschnitt betrachteten Plänen, in besonderer Weise auf den anthropogen verursachten Klimawandel ein. Er beschreibt das Phänomen der „globalen Erwärmung“ (ebd.: 179), das durch steigende Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre verursacht wird, und zitiert den ersten Klimaschutzbericht der Bundesregierung: Als mögliche Auswirkung auf Flora und Fauna sei, aufgrund der Geschwindigkeit der Klimaänderung, eine Überforderung der Anpassungsfähigkeit natürlicher Ökosysteme und des Wirtschaftswaldes möglich, die deren Zusammenbruch zur Folge haben könne. Die Verantwortung für die erforderliche Reduktion von Treibhausgasemissionen wird aber nicht (auch) auf der Ebene der Landschaftsrahmenplanung gesehen. Vielmehr seien dafür nationale sowie überstaatliche Regelungen (EU, UN) nötig (ebd.). Darüber hinaus geht der Plan nicht weiter auf den Klimawandel, seine Auswirkungen oder mögliche landschaftsplanerische Reaktionen ein.
Aussagen der Kategorie 3 enthalten zu diesem frühen Zeitpunkt ebenfalls bereits alle Landschaftsrahmenpläne der vier Planungsregionen Mecklenburg-Vorpommerns, die aufgrund der Erstellung durch ein Amt bzw. Planungsbüro einen einheitlichen Aufbau sowie in der Regel nahezu identische Formulierungen aufweisen (LAUN 1996a, b; 1997, 1998). Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Bewertung wird im Unterkapitel „Schutzwürdigkeit von Klima und Luft“ auf den globalen Klimaschutz und die Reduktion von Treibhausgasen eingegangen. Die Wiedervernässung von Mooren und die damit verbundene Bindung und Speicherung von CO2 wird als wichtiges Element des Klimaschutzes beschrieben. Zudem wird erkannt, dass der „Klimawandel“ in bisher nicht abschätzbarer Art und Weise Auswirkungen auf Lebensräume haben wird (LAUN 1997: II-52). Im Rahmen der Formulierung regionaler Leitlinien wird auf das Globalklima, den Treibhauseffekt und die Emission klimarelevanter Gase Bezug genommen. In Niedermooren sollen natürliche Wasserverhältnisse wiederhergestellt werden, um so die Emission von Treibhausgasen zu verhindern bzw. Klimagase zu binden. Die frühe Reaktion auf den Klimawandel in Mecklenburg-Vorpommern mag damit durch die hohen Anteil an Mooren und deren Bedeutung für den Naturschutz begründet sein. Der Klimawandel konnte als zusätzliches Argument für deren Schutz herangezogen werden.
Im Jahr 2008 geht der Anteil der Landschaftsrahmenpläne und Regionalpläne, die den Klimawandel und/oder klimawandelrelevante Flächen berücksichtigen, in allen Kategorien deutlich zurück. Eine Erklärung könnte der überdurchschnittlich hohe Anteil der Regionalpläne an den in diesem Jahr betrachteten Plänen sein, da Regionalpläne in der Regel seltener auf den Klimawandel im Zusammenhang mit naturschutzfachlichen Fragestellungen eingehen.
4.2 Analyseschritt 2: raumbezogene Analyse (nach Bundesländern)
Die zunehmende Berücksichtigung des Klimawandels in Landschaftsrahmenplänen über den zeitlichen Verlauf zeigt sich auch bei der raumbezogenen Analyse: In allen betrachteten zwölf Bundesländern greift mindestens ein aktueller Plan die Thematik Klimawandel auf, in acht Ländern tritt zudem Kategorie 2 mindestens einmal auf, in sechs Ländern Kategorie 3 (vgl. Abb. 3). Dennoch sind deutliche Unterschiede sichtbar. Während etwa in Mecklenburg-Vorpommern alle aufgestellten Landschaftsrahmenpläne allen drei Kategorien zugeordnet werden können, erwähnt in Thüringen nur einer von vier Plänen den Klimawandel, ohne dabei näher auf Klimawandelfolgen oder Maßnahmen und Ziele zu Klimaschutz und anpassung einzugehen.
Ansonsten ist das Bild sehr heterogen. So greifen in Sachsen und Schleswig-Holstein alle Pläne das Thema Klimawandel zwar prinzipiell auf (Kategorie 1), während Kategorie 3 dort überhaupt nicht vertreten ist. Umgekehrt ist Kategorie 3 in Ländern anzutreffen, in denen nicht einmal alle Pläne Aussagen im Sinne von Kategorie 1 treffen (z.B. Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern). Über die Gründe für diese Ungleichverteilung kann hier nur spekuliert werden, das Alter sowie der Plantyp lassen sich aber als alleinige bzw. entscheidende Ursachen ausscheiden, so dass von weiteren bundeslandspezifischen Einflüssen auszugehen ist.
4.3 Analyseschritt 3 – inhaltliche Analyse
Die inhaltliche Analyse zeichnet – erwartungsgemäß – ein sehr diverses Bild, eine einheitliche oder bevorzugte Praxis zur Berücksichtigung des Klimawandels in der Landschaftsrahmenplanung zeichnet sich selbst bei den hier ausschließlich ausgewerteten Plänen mit „Kategorie-3-Aussagen“ nicht ab. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass kein Plan eine umfassende und konsequente Analyse der Auswirkungen des Klimawandels sowie daraus folgender Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen vornimmt. Eine über alle Arbeitsschritte hinweg stringente, systematische und strukturierte Bearbeitung findet bislang nicht statt. Dies zeigt sich an mehreren Punkten:
Die Folgen des Klimawandels werden meist nicht systematisch erhoben und bewertet, so dass nicht alle Pläne, die Ziele oder Maßnahmen zu Klimaschutz und -anpassung enthalten, auch die Auswirkungen des Klimawandels auf das betroffene Gebiet beschreiben und bewerten (12 von 21). Auf den Klimawandel bezogene Ziele und Maßnahmen sind daher oftmals nicht durch zuvor beschriebene Auswirkungen des Klimawandels begründet, auch fehlt in 16 Plänen eine Bezug von klimawandelbezogenen Maßnahmen und Erfordernissen zu entsprechenden Zielen.
Bei der Beschreibung der direkten Auswirkungen liegt ein deutlicher Fokus auf dem Schutzgut Arten und Biotope bzw. der Biodiversität (11), die Schutzgüter Wasser (10) und Boden (6) werden nachrangig mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht. Zwar behandeln fast gleich viele Pläne sowohl das Schutzgut Arten und Biotope als auch das Schutzgut Wasser, für Arten und Biotope wird jedoch ein deutlich breiteres Spektrum möglicher Auswirkungen des Klimawandels aufgezeigt. Einen Überblick über die Vielfalt der in allen ausgewerteten Plänen (171) beschriebenen Auswirkungen gibt Tab. 4.
Eine Einschätzung der Auswirkungen des Klimawandels im Vergleich zu oder auch im Zusammenwirken mit anderen Wirkfaktoren auf Natur und Landschaft, wie etwa der flächigen Zunahme oder Intensivierung von Landnutzungen, bleibt in der Regel aus (in einem Plan wird dieser Ansatz thematisiert).
Darüber hinaus sind folgende wesentliche Ergebnisse festzuhalten:
Klimaschutzziele und -maßnahmen werden in je 14 Plänen formuliert und damit häufiger als Ziele und Maßnahmen zur Anpassung, die lediglich in acht bzw. zehn Plänen Erwähnung finden. Klimaschutzziele und -maßnahmen beziehen sich in der Regel auf Sicherung, Entwicklung und Mehrung von Lebensräumen mit CO2-Speicher- und CO2-Senkenfunktion, insbesondere auf Moore (12) und Wälder (9). Ziele zur Anpassung thematisieren überwiegend Biotopverbund (3) und Wasserhaushalt (4), entsprechende Maßnahmen hingegen Wasserhaushalt (6) und Waldlebensräume (7).
Szenarien künftiger Entwicklungen (sei es des Klimas, seiner Folgewirkungen oder auch in Hinblick auf Maßnahmenwirksamkeit) werden nicht erstellt. Diese in der Literatur oftmals anzutreffende Forderung stellt offenbar zumindest derzeit eine Überforderung der Landschaftsplanungspraxis dar.
Die Maßnahmen mit Bezug zum Klimawandel lassen sich durchgehend als so genannte „No-Regret-Maßnahmen“ bezeichnen, d.h. sie hätten auch unter einer anderen als der derzeit angenommenen klimatischen Entwicklung keine negative, meist sogar eine positive Wirkung.
Die meisten Maßnahmen zu Klimaschutz und -anpassung sind „klassische“ Maßnahmen des Naturschutzes, die möglicherweise auch ohne den Bezug zum Klimawandel in den Plänen aufgetreten wären. Es lässt sich daher vermuten, dass die Berücksichtigung des Klimawandels nicht in erster Linie „neue“ Maßnahmen generiert, sondern der Begründungshorizont altbekannter und bewährter Maßnahmen erweitert wird. Diese These ließ sich allerdings im Rahmen der Arbeit und der angewandten Methoden nicht überprüfen.
Umfassende Betroffenheits- oder Vulnerabilitätsanalysen sowie Analysen, die räumlich differenzierte Betroffenheiten durch den Klimawandel ermitteln, werden in der Regel nicht durchgeführt. Die Pläne formulieren daher meist Anpassungsziele und -maßnahmen zur Steigerung der Resilienz des Wasserhaushalts oder einzelner Lebensraumtypen bzw. zur Vernetzung von Lebensräumen, ohne räumlich konkret zu werden.
Hingegen ist die raumkonkrete Identifizierung von klimaschutzrelevanten Ökosystemen nach derzeitigem Erkenntnisstand vergleichsweise gut möglich und wird auch durchgeführt. Entsprechend häufig werden bereits Maßnahmen und Erfordernisse zur Sicherung, Entwicklung und Mehrung von Mooren, Wäldern und Grünländern als Kohlenstoffspeicher bzw. -senken formuliert.
5 Ausblick
Die Landschaftsrahmenplanung in Deutschland hat das Thema Klimawandel aufgegriffen, wenn auch noch nicht alle derzeit gültigen Pläne entsprechende Aussagen aufweisen und die inhaltliche Tiefe der Auseinandersetzung mit der Problematik sehr unterschiedlich ist. Kein Plan bearbeitet das Thema vollkommen stringent und systematisch über alle Arbeitsschritte hinweg. Dies war beim bisherigen Stand der methodischen Entwicklung und deren Anwendung in der Praxis allerdings auch nicht zu erwarten. Positiv zu vermerken ist daher, dass das Thema Klimawandel mittlerweile kein Randthema der Landschaftsrahmenplanung mehr ist und vermutlich auch in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Zu erwarten ist, dass dabei auch Intensität und inhaltliche Qualität der Bearbeitung weiter steigen werden.
Literatur
Bundesregierung (2008): Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Berlin, 72S.
– (2011): Aktionsplan Anpassung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Berlin, 53 S.
Heiland, S., Geiger, B., Rittel, K., Steinl, C., Wieland, S. (2008): Der Klimawandel als Herausforderung für die Landschaftsplanung. Probleme, Fragen und Lösungsansätze. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (2), 37-41.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2014): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. IPCC Working Group II Contribution to AR5. Final Draft. Online: http://ipcc.ch/report/ar5/wg2/ (Abgerufen am 25.06.2014).
Jessel, B. (2008): Zukunftsaufgabe Klimawandel – der Beitrag der Landschaftsplanung. Natur und Landschaft 83 (7), 311-317.
Landkreis Lüneburg (1996): Landschaftsrahmenplan. Online: http://geo.lklg.net/terraweb_internet/login.htm?login=gast&legend=embed&ref=&lang=de&size=gross (abgerufen am 17.08. 2014).
Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan Landkreis Nienburg/Weser. Nienburg/Weser.
LAUN – Landesamt für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, Projektbüro Landschaftsrahmenplanung (1996a): Erster Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Mittleres Mecklenburg / Rostock. LAUN, Gülzow.
– (1996b): Erster Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern. LAUN, Gülzow.
– (1997): Erster Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Mecklenburgische Seenplatte. LAUN, Gülzow.
– (1997): Erster Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Mittleres Mecklenburg. LAUN, Gülzow.
Radtke, L. (2015): Klimawandel in der Landschaftsrahmenplanung. Eine repräsentative Untersuchung zur Berücksichtigung von Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung durch Landschaftsrahmenpläne im zeitlichen Verlauf. Unveröff. Bachelor-Arb. am Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung der TU Berlin. 147 S. Online: http://www.landschaft.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/abschlussarbeiten/.
Schliep, R., Bartz, R., Dröschmeister, R., Dziock, F., Dziock, S., Fina, S., Kowarik, I., Radtke, L., Schäffler, L., Siedentop, S., Sudfeldt, C., Trautmann, S., Sukopp, U., Heiland, S. (2013): Indikatoren für die Deutsche Anpassungsstrategie. Indikator-Datenblätter zum Handlungsfeld „Biologische Vielfalt“. Indikator-Datenblatt: Berücksichtigung des Klimawandels in Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen. Unveröff. Mskr.
–, Bartz, R., Dröschmeister, R., Dziock, F., Dziock, S., Fina, S., Kowarik, I., Radtke, L., Schäffler, L., Siedentop, S., Sudfeldt, C., Trautmann, S., Sukopp, U., Heiland, S. (2015): Indikatorensystem zur Darstellung direkter und indirekter Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt. F+E-Vorhaben (FKZ 3511 82 044) im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. Abschlussbericht. In Vorb.
Thode + Partner Büro für Landschafts- und Freiraumplanung (1996): Landschaftsrahmenplan Templin im Auftrag des Landkreises Uckermark. Band 1 und 2. Dortmund.
Wilke, C. Bachmann, J., Hage, G., Heiland, S. (2011): Planungs- und Managementstrategien des Naturschutzes im Lichte des Klimawandels. Naturschutz und Biologische Vielfalt 109, 206S.
Anschriften der Verfasser(innen): B.Sc. Laura Radtke, Dipl.-Ing. Rainer Schliep und Prof. Dr. Stefan Heiland, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Sekr. EB 5, Straße des 17. Juni 145, D-10623 Berlin, E-Mail l.radtke@mailbox.tu-berlin.de, rainer.schliep@tu-berlin.de und stefan.heiland@tu-berlin.de, Internet http://www.landschaft.tu-berlin.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen








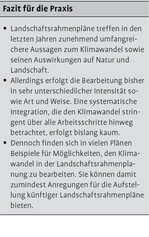
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.