Naturparke und die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung
Abstracts
Naturparke bilden die älteste deutsche Großschutzgebietskategorie und auch zahlenmäßig übertreffen sie Nationalparke und Biosphärenreservate bei Weitem (104 Naturparke gegenüber 15 Nationalparken und 16 Biosphärenreservaten, Stand Mitte 2014). Dennoch befinden sie sich im Vergleich – gerade zu Nationalparken – in einer deutlich schlechteren Position: Sie sind vielfach finanziell und personell schlechter ausgestattet und werden mitunter als Schutzgebiete „zweiter Klasse“ bezeichnet. Gleichwohl, bzw. als Versuch der Reaktion auf diesen Umstand, wurde ihnen durch das Bundesnaturschutzgesetz die anspruchsvolle Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung zugesprochen.
In der Praxis zeigt sich, dass einerseits vielfältige Problemlagen die Aufgabenumsetzung behindern, andererseits Potenziale bestehen, die in Wert gesetzt werden könnten. Der Artikel beleuchtet die Entwicklungsgeschichte der Naturparke und fragt danach, wie die Aufgabenumsetzung gelingen könnte und in welche Richtung Naturparke sich vor diesem Hintergrund entwickeln könnten.
Nature Parks and the Task of Sustainable Regional Development – Beyond flagging walking trails and locating park benches
Nature parks form the oldest category of large protected areas in Germany, by far outnumbering national parks and biosphere reserves (104 nature parks against 15 national parks and 15 biosphere reserves, status mid-2014). Nevertheless, they are – especially compared to national parks – in a significantly worse position: Often they are less well equipped in terms of financial and human resources and they are sometimes referred to as ‘second-class’ protected areas. On the other hand or maybe as an attempt to respond to this situation, nature parks are in charge of the challenging task of sustainable regional development according to the Federal Nature Conservation Act. In practice it turns out that, on the one hand, various problems hinder the task of implementation; on the other hand, there are still potentials to be exploited. The paper describes the history of nature parks and investigates options how to manage the task of implementation and in which direction nature parks could develop in future.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Naturparke können auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurückblicken. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in der Lüneburger Heide der Naturschutzpark e.V. gegründet (Barthelmess 1988: 134f.; Lommel 1974: 96f.), der als Ausgangspunkt für eine wechselhafte Naturparkentwicklung gelten kann. Damals trafen im Zuge der Industrialisierung unterschiedliche Nutzungsinteressen aufeinander und der Wunsch entstand, Heideflächen für Freizeit und Erholung unter Schutz zu stellen (Lommel 1974: 96f.). Dieser Kerngedanke der Vereinbarung von Freizeit- und Erholungsnutzung wurde lange Zeit prägend für Naturparke und beförderte eine Gründungswelle in den 1960er Jahren (Lommel 1974: 101; VDN 2003: 5). Heute bestehen in Deutschland 104 Naturparke, die mehr als ein Viertel der Landesfläche umfassen – Tendenz steigend (Forst & Scherfose 2010). Trotz der langen Tradition stehen sie heutzutage vielfach im Schatten der beiden anderen Großschutzgebietstypen, den Nationalparken und Biosphärenreservaten.
Großschutzgebiete sind nach Job (2000: 36) rechtlich festgesetzte Flächen für Naturschutz oder Landschaftspflege, die durch eine Trägerorganisation gemanagt werden und meist über 10000 ha groß sind. Nationalparke sind finanziell und personell vergleichsweise gut ausgestattet, als Kategorie international anerkannt und haben einen hohen Bekanntheitsgrad – anders als Naturparke, deren Situation deutlich schwieriger ausfällt, wie noch ausführlicher dargelegt wird (dazu auch Weber 2013: 173ff.). Trotz oder gerade aufgrund der problematischen Lage erhielten die Naturparke durch die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 27) aus den Jahren 2002 und 2010 neben bestehenden Aufgaben den gesetzlichen Auftrag, nachhaltige Regionalentwicklung zu betreiben. Die Aufgabe ist en vogue, aber keinesfalls als eindeutig definiert und mit Inhalt gefüllt zu bezeichnen. Sie wird dennoch als Heilmittel für die Zukunftsfähigkeit von Naturparken gesehen (u. a. Kaether 1994: 14; VDN 2009).
Vor diesem Hintergrund verfolgt der Artikel zunächst das Ziel, die geschichtliche Entwicklung der Naturparke aufzuzeigen, die schließlich in die Aufgabenausweitung hin zur nachhaltigen Regionalentwicklung mündet. Darauf aufbauend wird erläutert, wie diese Aufgabe im Naturpark-Kontext begriffen wird sowie welche Probleme und welche Potenziale sie mit sich bringt. Schließlich wird die Frage beantwortet, unter welchen Voraussetzungen Naturparke aktiv Regionalentwicklung mitbestimmen können, bzw. was dazu erforderlich wäre – gerade im Verhältnis zu Nationalparken und Biosphärenreservaten.
2 Entwicklungslinien der deutschen Naturparke
Die Entwicklungsgeschichte der deutschen Naturparke lässt sich in fünf Phasen gliedern, wobei die erste vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre reichte (Tab. 1). Den Anfang der Auseinandersetzung um großflächige Schutzgebiete in Deutschland bildeten konfligierende Nutzungsinteressen in der Lüneburger Heide (Barthelmess 1988: 134f.). Privatpersonen schlossen sich zusammen und gründeten im Jahr 1909 den privaten Naturschutzpark e.V. mit dem Ziel, Naturschutzgebiete einzurichten (Lommel 1974: 96, 111) und die „ursprüngliche[n] und eindrucksvolle[n] Landschaften“ (Lommel 1974: 97) – die Heidelandschaften – zu schützen. Neben dem Schutz der „ursprüngliche[n] Gebiete unserer Heimat“ (Widmann 1963: 6) stand die Nutzung durch die Stadtbevölkerung im Fokus – ein Verbinden von Schützen und Nutzen –, auch wenn der Erholungsgedanke erst nach dem Zweiten Weltkrieg als zentrale Aufgabe immanent wurde (Widmann 1963: 6).
Die Etablierung der Naturpark-Idee erfolgte ab den 1950er Jahren, was als zweite zentrale Entwicklungsphase gelten kann, die bis Ende der 1970er Jahre reichte. Der Hamburger Kaufmann und Mäzen der Naturparkidee Dr. Alfred Toepfer forderte die Schaffung von 25 „Naturschutzparken“, wobei Natur- und Landschaftsschutz und Erholung gleichberechtigt nebeneinander stehen sollten – gerade im Hinblick auf das steigende Freizeitinteresse der Bevölkerung (Lommel 1974: 101; Toepfer 1956; Weber 2013: 42). In einer Veröffentlichung zu „vorgeschlagene[n] Naturparken“ (siehe VDN 2003: 5f.) wurde im Jahr 1957 neben einem Überblick über mögliche Parkgebiete erstmals der Begriff Naturpark verwendet.
Gerade in den 1960er Jahren in Zeiten des Wirtschaftswunders traf die Gründung von Naturparken in der Nähe von Ballungsräumen zur Erholung auf große Zustimmung (bspw. auch der Naturpark Rhein-Westerwald e.V., gegründet 1962 zwischen Koblenz und Köln/Bonn, Abb. 1). Es kam zur Etablierung von bis heute grundsätzlich geltenden Strukturen: Naturparke wurden meist als Vereine gegründet, wobei Kommunen und Landkreise als Mitglieder fungieren. Im Jahr 1965 bestanden in Westdeutschland 25 Naturparke, deren Zahl bis zur Wiedervereinigung auf 64 anstieg (Liesen et al. 2008: 26; VDN 2003: 8f.). Im Oktober 1963 wurde der Verband Deutscher Naturparke (VDN) als Dachorganisation der Naturparke ins Leben gerufen.
In den 1970er Jahren nahmen Entwicklungen aus den USA bzw. des internationalen Schutzanliegens Einfluss auf die Naturparke, was Phase drei der Naturparkgeschichte einläutete. In dieser Zeit wurden in Deutschland die ersten Nationalparke und Biosphärenreservate gegründet (Blab 2006: 9; Deutsche UNESCO-Kommission 2011), was eine indirekte Abwertung der Naturparke mit sich brachte: Naturschutz der Nationalparke wurde durch den exklusiven Schutzgedanken zum „besseren“ Naturschutz. Bis heute gibt es vergleichsweise wenige Nationalparke auf geringer Fläche. Zusätzlich wurden Biosphärenreservate eingerichtet, die durch die UNESCO international anerkannt sind und die die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung besetzten – sie gelten als Modellräume für eine nachhaltige Entwicklung (u.a. Brodda 2002: 51; Kühne 2010: 27) –, womit auch hiermit Naturparke ins Hintertreffen gerieten (Stakelbeck 2011: 18).
Forciert wurde diese Abwertung durch Veränderungen in der Finanzierung: Mit dem ersten Bundesnaturschutzgesetz (1976), durch das der Bund nur noch die Rahmengesetzgebung für Naturschutz, Landschaftspflege und Wasserhaushalt innehatte (VDN 2003: 8), entfielen die bestehenden Bundeszuschüsse, womit die lokale Ebene aktiver werden musste. Gleichwohl verfügten die Naturparke damit erstmals über eine gesetzliche Grundlage (§ 16 BNatSchG von 1976). Vielfach etablierten sie sich als Tourismusförderer, womit sie mit dem in der Retrospektive als bieder geltenden Image des „Wanderwegemarkierers und Parkbankaufstellers“ (Abb. 2) verknüpft wurden und in Teilen bis heute werden (Weber 2013: 47).
Neue Impulse ergaben sich in den 1990er Jahren im Zuge der Wiedervereinigung, was die vierte Phase der Naturparkentwicklung markiert. Noch kurz vor der Wiedervereinigung war in der Deutschen Demokratischen Republik ein System von Großschutzgebieten – Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke – entwickelt worden, was nach 1990 aufgegriffen wurde und eine Welle von Naturpark-Gründungen nach sich zog (Blab 2006: 9; Succow 2000: 63). Entscheidend für die Entwicklung war das Aufgabenspektrum ostdeutscher Naturparke, das umfangreicher als das der westdeutschen ausfiel und neben Umweltbildung und Regionalvermarktung auch die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im ländlichen Raum umfasste. Dieses breitere Aufgabenspektrum wurde durch die Anpassung der „Aufgaben und Ziele“ durch den VDN allgemeingültig für alle deutschen Naturparke formuliert (VDN 2003: 10), womit erstmals Regionalentwicklung als Aufgabe zum Tragen kam, aber noch nicht im Vordergrund stand (VDN 2003: 11, 14).
Die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung wurde schließlich ab dem Jahr 2001, als die Aufgaben und Ziele der Naturparke fortgeschrieben wurden, immer zentraler, indem die „besondere Eignung der Naturparke für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum“ (VDN 2003: 11) herausgestellt wurde und seitdem regelmäßig reproduziert wird. Ab den 2000er Jahren kann von einer neuen Phase der Naturparkentwicklung gesprochen werden, die bis heute anhält. In die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 27) aus den Jahren 2002 und 2010 wurde die nachhaltige Regionalentwicklung explizit mit aufgenommen und zur Kernaufgabe der Naturparke.
Neben Naturschutz, Erholung und nachhaltigem Tourismus ist somit nachhaltige Regionalentwicklung heute eine zentrale Naturpark-Aufgabensäule. Damit ist der Wunsch nach einer Aufwertung und einer Bedeutungssteigerung von Naturparken innerhalb der deutschen Großschutzgebietskulisse verbunden, was durch ein verändertes Agieren des VDN gerahmt wird: Die Geschäftsstelle wurde zur Erhöhung der Sichtbarkeit nach Bonn verlagert, weitere Mitarbeiter wurden eingestellt, die „Qualitätsoffensive Naturparke“ wurde implementiert und die Vermarktungs- und Imagekampagne „Mein Naturpark“ in die Wege geleitet (Liesen et al. 2008; Weber 2013: 50f.). Gerade die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung wird durch den VDN als Möglichkeit eingeschätzt, als wichtiger regionalpolitischer Akteur wahrgenommen zu werden (Weber 2013: 316). Eine Bewertung dieser Position macht eine grundlegende Annäherung an das Aufgabenverständnis der nachhaltigen Regionalentwicklung durch Naturparke notwendig.
3 Die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung – Zugänge und Aufgabenverständnis
Ganz grundsätzlich umfasst der Gedanke der Nachhaltigkeit die Vorstellung, dass ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichberechtigt beachtet und ausbalanciert miteinander verbunden werden (ARL 2000: 4; Erdmann 1998; Erdmann & d’Oleire-Oltmanns 1998: 75; Mose 1989). Zentrale Aspekte sind hierbei auch die intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit sowie die „Chancengleichheit“ (Kühne 2011: 296, Kühne & Meyer 2015): Vereinfacht formuliert sollen die Bedürfnisse der heutigen Generationen befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten und Chancen künftiger Generationen einzuschränken. Ein Ansatzpunkt hierzu wird gerade auf regionaler Ebene gesehen (beispielsweise Herrenknecht & Wohlfarth 1997: 7). In diesem Kontext wird vielfach von nachhaltiger Regionalentwicklung gesprochen: Nachhaltigkeitsziele sollen partizipativ und integrativ auf Regionen angewandt werden, um Entwicklungen anzustoßen – so gerade auch in der Gebietskulisse von Großschutzgebieten (dazu Weber 2013: 79ff.).
Galten und gelten Biosphärenreservate als die Modellräume für eine nachhaltige Entwicklung, so wurde bereits in den 1990er Jahren darauf hingewiesen, dass auch Naturparke zu Vorbildern für eine nachhaltige Regionalentwicklung und zu Ideallandschaften werden könnten (BMU 1994: 27; Job 1993: 130; Kaether 1994: 13). Diese Einstellung schlägt sich in den im Jahr 2009 durch den VDN definierten Aufgaben der Naturparke nieder, in denen nachhaltige Regionalentwicklung als zentral für die Naturparke verankert wurde (dazu auch Liesen et al. 2008: 27). Im Fokus stehen danach die Stärkung der regionalen und der kulturellen Identität. Zudem wird auf Kooperationen und die Aktivierung der Bevölkerung gesetzt. Naturparke sollen die „Rolle von Motoren und Moderatoren für die ländliche Regionalentwicklung wahrnehmen“ (VDN 2009: 14). Zentrale Elemente stellen aus Sicht des VDN das kulturelle Angebot, regionales Wirtschaften und regionale Produkte, Naturpark-Partner-Netzwerke, Siedlungsentwicklung und Baukultur, umweltverträgliche Mobilität und erneuerbare Energien dar (VDN 2010: 84ff.).
Sowohl eine quantitative Befragung aller deutschen Naturpark-Geschäftsführer aus dem Jahr 2011 sowie ergänzende qualitative Befragungen von Naturpark-Akteuren und weiteren Experten im Feld der Großschutzgebiete von 2010 bis 2014 machen deutlich, dass keineswegs Einigkeit über Inhalt und Spektrum der nachhaltigen Regionalentwicklung auf der Umsetzungsebene innerhalb der deutschen Naturparke besteht (ausführlich Weber 2013: 144ff.). Nachhaltige Regionalentwicklung wird als ein „weites Feld“ (AMTVERB-02 – zur Erläuterung der Kürzel siehe Textbox 1) beschrieben, zu dem grundsätzlich alles gezählt werden könne, „was unser tägliches Leben betrifft“ (NP-09). Die Aufgabe wird im Schnittfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem verortet, wobei allerdings nicht hinreichend geklärt erscheint, an welcher Stelle sich Naturparke positionieren sollten und könnten (NP-06). Sie bleibt in der Grunddefinition bei den Naturpark-Geschäftsführern recht unscharf (Weber 2013: 145).
Im Rahmen der quantitativen Befragung beschrieben mehr als ein Fünftel der 56 Naturpark-Geschäftsführer, die sich an der Erhebung beteiligten, nachhaltigen Tourismus und Regionalprodukte als wichtige Arbeitsfelder der nachhaltigen Regionalentwicklung. Mit knapp über 5 % wurden jeweils erneuerbare Energien, Umweltbildung, Naturschutz und Landschaftspflege, nachhaltige Landnutzung sowie Kooperationen und Vernetzungen als entscheidend erachtet (dazu Weber 2013: 146; Abb. 3). Es zeigt sich, dass mit Umweltbildung und Naturschutz grundlegende Aufgaben von Naturparken unter die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung subsumiert werden. Die Diffusität der neuen Aufgabe lässt Grenzen zu bisherigen Aufgaben aufweichen bzw. entsprechende Grenzen lassen sich nicht ziehen. Zudem wurde aus den Untersuchungen deutlich, dass vielfach Umwelt- bzw. Naturaspekte hervorgehoben und dagegen wirtschaftliche sowie soziale Komponenten für eine nachhaltige Regionalentwicklung in Naturparken tendenziell ausgeblendet oder nicht als Aufgabenbereich angesehen werden (NP-01, -02, -04, -06, POL-01; ausführlich Weber 2013: 147, 170ff.).
Die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung wird in Naturparken als wichtig postuliert, aber sie ist nicht klar umrissen und nicht einfach umzusetzen. Es bestehen unterschiedliche Problemlagen, die sie blockieren, aber auch Potenziale, die Naturparke nutzen können, um diese Aufgabe bewusst zu fokussieren.
4 Grundlegende Probleme und Potenziale bei der Umsetzung der nachhaltigen Regionalentwicklung
4.1 Problemlagen bei der Aufgabenwahrnehmung
Ein grundsätzliches Problem bei der Aufgabenwahrnehmung der nachhaltigen Regionalentwicklung durch Naturparke stellt die Begriffsunschärfe dar. Es ist in den Aussagen der Interviewpartner bereits deutlich geworden, dass sehr viel oder nur Fragmente zur Aufgabe gezählt werden kann. Abstrahiert steht dies in Verbindung mit dem „schwammigen“ Begriff der Nachhaltigkeit. Der Bezug auf Nachhaltigkeit wird von Experten als „politisches Kalkül“ bezeichnet, ohne dabei einen passenden Inhalt „konzeptionell zu Ende gedacht“ (UNI-03) zu haben. Darüber hinaus sei nicht klar fixiert, dass Naturparke zwingend im Bereich einer nachhaltigen Regionalentwicklung aktiv werden müssten, was der Formulierung im Bundesnaturschutzgesetz geschuldet sei – faktisch handele es sich um eine „Art Soll-, aber keine Muss-Regel“ (UNI-02). Eine Ignorierung der Aufgabe könne somit nicht sanktioniert werden, was die Zielsetzung des VDN und der Naturpark-Geschäftsführer konterkariere, die als starker Player in diesem Bereich wahrgenommen und akzeptiert werden möchten. Ein vielfach sich vollziehender Fokus der Naturpark-Geschäftsführer auf die grüne Regionalentwicklung befördere den Eindruck, dass keine innovativen Ansätze verfolgt würden (NP-01, POL-01, RM-02). Eher nur im Naturschutz tätig zu werden, ermögliche keine Abgrenzung von Nationalparken und auch keine Positionierung im Vergleich zu Biosphärenreservaten. Als Akteur müsste sich der VDN noch stärker „in Szene“ setzen und „Gewicht erlangen“, was in Anbetracht einer personell begrenzten Geschäftsstelle schwierig erscheint (Anonym).
Naturparke sind in vielen Fällen mit grundlegenden Finanz- und Personalzwängen konfrontiert, die eine Entscheidung notwendig mache, welche Aufgaben erfüllt und welche vernachlässigt werden müssten. In der 2011 durchgeführten quantitativen Befragung der Naturpark-Geschäftsführer (Weber 2013) bemängeln knapp drei Viertel die aktuelle Personal- und die finanzielle Situation (s. Weber 2013: 174). Der Naturparkverband Bayerns ging in einer Resolution 2007 davon aus, dass Naturparke „mit der gegenwärtigen Organisationsstruktur, der Finanz- und Personalausstattung und angesichts derzeitiger Förderpraxis nicht mehr in der Lage [seien], ihren gesetzlichen Auftrag und damit ihre Funktion als Vorbildlandschaften und als Modellregionen für nachhaltige Regionalentwicklung zu erfüllen“ (Naturparkverband Bayern 2007). Bereits in den 1990er Jahren wurde ein Mindestmaß an finanzieller und personeller Ausstattung gefordert (Job 1993: 128), was aber nie eingelöst worden sei. In einigen Bundesländern erhalten Naturparke eine institutionelle Förderung sowie eine Maßnahmenförderung, was aber die Abhängigkeit vom Willen der Landesregierungen mit sich bringe. In anderen Bundesländern müssen sich die Naturparke grundlegend selbst über Mitgliedsbeiträge finanzieren und können über Landeswettbewerbe an Gelder für konkrete Projekte gelangen. Zwar gaben in der durchgeführten Befragung etwa zwei Drittel an, über eine ganze Personalstelle zu verfügen, im Rest der Fälle wird allerdings nur bis hinunter auf zehn Prozent der Arbeitszeit für Naturpark-Aufgaben aufgewendet (Weber 2013: 186f.). In manchen Fällen wird das Amt des Geschäftsführers auch ehrenamtlich vergeben, beispielsweise an einen Bürgermeister, wie bis zum Jahr 2012 im Naturpark Rhein-Westerwald in Rheinland-Pfalz.
Etwa zwei Drittel der Geschäftsführer werden durch eine Verwaltungskraft unterstützt, aber nur noch etwa ein Drittel kann auf mindestens einen Sachmitarbeiter zurückgreifen. Damit wird es zur zentralen Problematik, konkrete Maßnahmen umzusetzen, wenn das strategische Geschäft der Naturparkverwaltung bereits große (Zeit-)Ressourcen in Anspruch nimmt. Gerade mit Nationalparken (beispielsweise rund 80 Mitarbeiter im Nationalpark Eifel bei 10700 ha; 89 Stellen bis 2016 anvisiert im Nationalpark Schwarzwald bei 10190 ha), die teilweise über Mitarbeiterstäbe und ausgeprägte Verwaltungen verfügen, können Naturparke nicht konkurrieren (Naturpark Nordeifel e.V. rund 5 Mitarbeiter bei 200000 ha; Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. mit 8 Mitarbeitern bei 375000 ha) (Nationalpark Eifel 2013, 2015; Naturpark Nordeifel e.V. 2015; Stuttgarter Zeitung 2013; telefonische Auskünfte 02.04.2015). Für die Naturpark-Geschäftsführer ergibt sich die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, was zwingend zu erledigen sei. Da gerade mit der Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung ein hoher Anspruch verknüpft wird und diese viel Zeit benötigt, wird sie eher ignoriert oder nur in Ansätzen verwirklicht (AMTVERB-01, NP-02, -03, -05).
Ein weiteres Problem, das grundlegend, aber im Besonderen mit der Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung in Verbindung steht, ist der bürokratische und verwaltungsintensive Aufwand von Förderanträgen. Eine Idealvorstellung wäre, dass Naturparke auf europäische Fördermittel (wie EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und LEADER – Förderung zur Entwicklung des ländlichen Raums) zur Projektfinanzierung zurückgreifen. Dies setzt voraus, dass die Naturpark-Geschäftsführer die Zeit haben, sich in komplexe Antragsverfahren einzudenken und Anträge zu stellen (AMTVERB-03, NP-03). Soll der Naturpark hier federführend aktiv werden, würde dies vorab eine bessere Personalausstattung erfordern (dazu Weber 2013: 193ff.). Zu berücksichtigen sind auch der hohe Aufwand bei der Mittelabwicklung, also einzuhaltende Förderrichtlinien, die gerade bei EU-Förderung als bürokratisches „Monster“ wahrgenommen werden (NP-01, Anonym).
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Anteilsfinanzierung von Projekten (selten bieten sich umfassende 100-%-Finanzierungen, so dass aus Beständen teilweise geringen Eigenkapitals der Naturparke agiert werden müsste) (Weber 2013: 196ff.). Flankiert werden die beschriebenen Problemlagen durch eine begrenzte öffentliche Wahrnehmung, wohingegen Nationalparke deutlich bekannter seien (u. a. IP-02, -04, Anonym).
Wird nachhaltige Regionalentwicklung als Aufgabe gefasst, über die problemzentriert angepasste Lösungen in einem umfassenden regionalen Abstimmungsprozess erreicht werden sollen (z.B. Ermann 1998, Spehl 2005), sehen sich Naturparke häufig mit zeitlichen Engpässen und Hindernissen durch administrative Grenzen konfrontiert (ausführlich Weber & Weber 2014). Die Initiierung partizipativer Prozesse bedürfe ausführlicher Vorplanung, müsse intensiv betreut werden und koste entsprechend sehr viel Zeit, die nicht zur Verfügung stehe – ohne Partizipation könne man aber anderseits dem Anspruch sozialer nachhaltiger Entwicklung nicht gerecht werden (NP-02, -05, -09, UNI-03). Die Problematik von politischen Grenzen zeige sich zum einen darin, dass Fördermaßnahmen vielfach auf bestimmte Bundesländer ausgerichtet seien, was bundesländerüberschreitendes gemeinsames Handeln stark erschwere (NP-02, -04). Zum anderen sei das Bestreben von Politikern zu berücksichtigen, die vielfach ihre eigenen Interessen durch die Abhängigkeit von Wählerstimmen auf ihr Gemeindegebiet oder ihren Landkreis ausrichteten und damit die Entwicklung anders zugeschnittener Naturparkgebiete nicht automatisch als ihr Ziel ansähen (dazu AMTVERB-03, NP-08, -05).
Es ergibt sich damit ein vielschichtiges Problembündel, das sich gegenseitig bedingt und das ganz grundlegend Naturparke hemmt, die ihnen zugeschriebenen Aufgaben zu erfüllen – und dies gilt besonders für die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung, wenn Ökologie, Ökonomie und Soziales als zu entwickelnde Einheit betrachtet werden. Gleichwohl bestehen auch unterschiedliche Potenziale, die Naturparke als geeignete Akteure der nachhaltigen Regionalentwicklung erscheinen lassen.
4.2 Potenziale für Naturparke
Aus der vielfach bereits langen Tradition von Naturparken resultiert auch ein mögliches Potenzial für Prozesse der Regionalentwicklung. Sie bildeten eine „feste Institution“ (NP-04) und sie bestünden „dauerhaft“ (NP-06). Institutionalisierte Strukturen wie eine Geschäftsstelle seien etabliert worden, bildeten einen Rahmen und stellten eine Verknüpfung zu einer definierten, zugeschnittenen Gebietskulisse dar. Im Gegensatz zu neu eingerichteten Regional- oder Leader-Managements seien sie auf Dauer eingerichtet, in der Region verankert und würden in ihrer Langfristigkeit selten hinterfragt (NP-05). Gerade für die Verstetigung von Projekten könnten Naturparke vom Prinzip her entsprechend sorgen (UNI-01). Durch bereits bestehende Kooperationen müssten Naturparke auch nicht „bei Null anfangen“ und einen „Selbstfindungsprozess“ initiieren, was Vorteile für die Regionalentwicklung bedeuten könne (NP-05).
Wenn der These nachgegangen wird, dass kleinräumige Prozesse der Regionalentwicklung, gerade auf Landkreisebene, als überholt gelten (u.a. NP-09, RM-01; Chilla et al. 2015) und gewinnbringender über großräumigere Ansätze agiert werden soll, könnten Naturparke eine mögliche Gebietskulisse darstellen (grundlegend Kühne & Meyer 2015). Sie gehen über Landkreis- und teilweise über Bundesländergrenzen hinweg und würden durch ein häufiges Verankern an Naturraumvorstellungen – es sei beispielsweise auf den Spessart oder die Vulkaneifel verwiesen – von der Bevölkerung als Einheit wahrgenommen (RM-01). Von interviewten Experten und Naturpark-Geschäftsführern wird Naturparken das Potenzial zugesprochen, „effektiv“ (NP-02) jenseits einer „Kleinstaaterei“ (NP-04) Projekte von regional verankertem Interesse voranzubringen. Durch die bestehende, tradierte Gebietskulisse müssten zudem nicht neue regionale Zuschnitte geschaffen werden, wie bei neu entstehenden Initiativen (NP-08). Eine Vermarktung etablierter Einheiten, gerade von Naturparken, gelinge so einfacher (NP-04, -05).
Ein Potenzial von Naturparken liege auch in der Möglichkeit, unterschiedliche Akteure zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Wenn Naturparke über grüne Aufgaben hinausgingen, könnten sie zur Plattform werden, um verschiedene Akteursinteressen zu koordinieren. In der Praxis zeige sich, dass Naturparke im Verhältnis zu Tourismus, Wirtschaftsförderung und Naturschutz eher seltener als Konkurrenz wahrgenommen würden, da sie deren Hoheit im jeweiligen Bereich nicht in Frage stellen wollten, sondern eher unterstützend agierten (AMTVERB-03, NP-08). Naturparke könnten gerade Nischen, wie den naturnahen Wandertourismus, besetzen und interdisziplinär vernetzend tätig werden (NP-02, RM-01). Sie könnten damit im Idealfall zu Regionalmanagern werden, die Aufgaben der Regionalentwicklung koordinierten. Es ginge dabei gerade darum, Parallelstrukturen – wie im Verhältnis zu Regionalmanagements – zu vermeiden und bestehende Akteure sowie deren Maßnahmenportfolios in Einklang zu bringen (Weber 2013: 301ff.; 2014, 2015).
Schließlich birgt auch die Organisationsstruktur der Naturparke eine Chance für die Übernahme von Aufgaben der Regionalentwicklung: Viele Parke sind als Vereine organisiert, in denen neben Landkreisen und Verwaltungseinheiten wie Kommunen auch andere Vereine und Verbände, Organisationen und Privatpersonen Mitglied sind. Im Idealfall sei dadurch bereits ein breites Akteursspektrum vereint, das es für gemeinschaftliche Projekte zu aktivieren gelte (AMTVERB-03, POL-02).
4.3 Zukünftige Chancen und Anpassungsbedarf
Werden beschriebene Probleme und Potenziale von Naturparken in Bezug auf die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung in Beziehung gesetzt, wird deutlich, dass unter aktuellen Voraussetzungen eine Aufgabenerfüllung, integrativ im Sinne der Nachhaltigkeit verstanden, nicht umfassend erfolgen kann. Grundlegend bedürfte es einer besseren finanziellen und dadurch auch komfortableren personellen Ausstattung – sei es durch die Bundesländer und/oder die Mitgliedsgemeinden. Naturparke, die nur mit einem Geschäftsführer besetzt sind, sind mit Verwaltungstätigkeiten überlastet, womit die Umsetzung konkreter Maßnahmen deutlich erschwert wird. Auf diese Weise können sie auch nicht als relevante Akteure im Bereich der Regionalentwicklung und darüber hinaus wahrgenommen werden und verlieren weiter im Vergleich zu besser ausgestatteten Nationalparken an Bedeutung. In Zeiten leerer Kassen sei die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen bei Kommunen schwer vermittelbar, aber neben einer Erhöhung der Finanzierung durch die Bundesländer wohl unumgänglich, wenn Naturparke nicht von der Landkarte verschwinden sollten (AMTVERB-03, -04, NP-01, -05, -06; ausführlich auch Weber 2013: 251ff.).
In Bezug auf die Einwerbung von Fördermitteln bedürfte es einerseits vereinfachter Antragsverfahren, andererseits zielführender Beratung durch die zuständigen Ministerien und nachgeordneten Behörden. Auf diese Weise könnten Naturparke bei anderen regionalen Akteuren, gerade bei den Naturpark-Mitgliedern wie den Kommunen, an Bedeutung gewinnen, wenn sichtbar würde, dass über sie Gelder in die jeweiligen Regionen zufließen. Der konkrete Naturpark-Nutzen für Regionen müsste entsprechend deutlich werden (AMTVERB-04, NP-06, RM-02).
Darüber hinaus müsste die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung klarer gefasst werden. Im aktuellen Zustand erscheint sie für viele Parke als zu unkonkret und zu wenig greifbar. Will der VDN als wichtiger Akteur wahrgenommen werden, der die Entwicklungsrichtung der Naturparke entscheidend mitbestimmt, müsse er ausführlichere und umsetzbarere Handlungsoptionen entwickeln (u.a. RM-01, UNI-02). Die Aufgabe wäre zudem stärker gesetzlich zu fixieren, um sie von einer Kann- zu einer Muss-Aufgabe werden zu lassen (UNI-02, -03).
Bei Biosphärenreservaten wird ganz automatisch auf die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung rekurriert. Aktuell nehmen auch Nationalparke auf diese Aufgabe Bezug und erweitern ihren Naturschutz-Gedanken, was zu Ungunsten der Naturparke ausgehen könnte. Wird nachhaltige Regionalentwicklung als Zukunftschance für Naturparke gesehen, müsste diese Aufgabe untrennbar mit Naturparken verknüpft werden. Politische Unterstützung wird damit zum nächsten Stichwort. Landräte, Landtagsabgeordnete und prominente Naturpark-Botschafter könnten dazu beitragen, dass Naturparke nicht mehr nur einfach als vorhanden konstatiert, sondern als wichtiges und dynamisches Vehikel für Regionalentwicklung wahrgenommen werden (NP-02, -07, UNI-02). Im Idealfall gingen damit auch eine umfangreichere Berichterstattung in den Medien und folglich eine stärkere Wahrnehmung durch die Bevölkerung einher. Entsprechend dem im regionalpolitischen Kontext vielzitierten Motto „Tue Gutes und rede darüber“ müsste es Naturparken gelingen, sich stärker als relevante Akteure zu vermarkten – ein Verharren im Schattendasein von Nationalparken und Biosphärenreservaten könnte unter Umständen dazu führen, dass ihre Legitimität irgendwann verschwindet und damit auch ihr Bestehen im Dschungel der Gebietskategorien obsolet wird.
5 Fazit: Naturparke zwischen Stillstand und Aufbruch
Naturparke können auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurückblicken. Grundlegend können sie als Pioniere für einen Naturschutz gelten, der gleichzeitig Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung mit einschließt. Nach einer Phase dynamischer Entwicklung und einem deutlichen Anstieg an Naturparken in Deutschland gerieten sie in eine gewisse Lethargie, gekoppelt an das Aufkommen von Nationalparken und Biosphärenreservaten, die bis heute exklusiver erscheinen – sowohl in der Anzahl als auch in der Aufgabenwahrnehmung und in der finanziellen und personellen Ausstattung.
Nach der Wende ergab sich eine gewisse Dynamik durch ein breiteres Aufgabenspektrum sowie die Fixierung der nachhaltigen Regionalentwicklung als Naturpark-Aufgabe. Doch wie steht es aktuell um Naturparke? Die Situation ist vor dem Hintergrund des skizzierten Problembündels nicht einfach. Im Spannungsfeld zu den anderen Großschutzgebieten und in Zeiten angespannter Finanzsituationen von Bund, Ländern und Gemeinden besteht die Gefahr, dass Naturparke zunehmend auf ein „Abstellgleis“ geraten. Wenn sie nur – plakativ formuliert – als Markierer von Wanderwegen und Aufstellern neuer Parkbänke wahrgenommen werden, geht die Legitimationsgrundlage irgendwann verloren. Dann könnte im Umkehrschluss auch gefragt werden, ob ihre Aufgaben nicht anderen Akteuren übertragen werden könnten und sie im Zweifelsfall nur noch auf dem Papier weiterbestünden oder gar aufgelöst würden. Dabei bieten sie Potenziale, die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung wahrzunehmen, also Ansätze zu verfolgen, die eine Vereinbarkeit von Ökologie, Ökonomie und Sozialen anstreben – eine Aufgabe, die seit der Konferenz in Rio de Janeiro 1992 als en vogue bezeichnet werden kann und bis heute (politische) Anziehungskraft ausübt.
Teilweise gelingt dies bereits, wie Beispiele der Naturparke Spessart oder Saar-Hunsrück zeigen (Weber 2013: 158f.; Weber & Weber 2014), doch wird jeweils konstatiert, dass mit besserer Ressourcenausstattung mehr erreicht werden könnte. Dazu wäre es erforderlich, dass die Politik sich klarer zu Naturparken bekennt, ihnen nicht mit Mittelkürzungen droht und sie finanziell und personell besser ausstattet, was auch durch vereinfachte Mitteleinwerbungsmöglichkeiten sowie Unterstützung bei der Suche passender Förderprogramme erfolgen müsste.
Ebenso wäre die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung auszudifferenzieren, um die „Worthülsenhaftigkeit“ zu überwinden. Die Aufgabendefinition durch den VDN (2009, 2010) erscheint vielen Geschäftsführern noch als zu unscharf, um ihnen im alltäglichen Arbeiten hinreichend Unterstützung bieten zu können (Weber 2013: 244 f.). Gleichzeitig dürfen Problemlagen nicht einseitig auf Politik und bestehende Rahmenbedingungen geschoben werden. Naturparke müssten stärker politisches Lobbying betreiben und ihren Nutzen kommunizieren, um die notwendige politische Unterstützung zu erhalten. Unter anderem können kleine Projekte, initiiert mit regionalen Partnern, Aufmerksamkeit bewirken. Auch durch das Gewinnen regionaler Sponsoren oder gemeinsame Positionierungen mittels übergreifender Projekte oder Strategieentwicklungen mehrerer Naturparke könnten diese gegenüber ihren Landesregierungen mehr Gehör erhalten.
Beispielsweise haben alle Naturparke in Baden-Württemberg ein gemeinsames Strategiepapier für die EU-Förderperiode 2014-2020 erarbeitet. Dabei wird dargelegt, welche Aufgaben Naturparke bereits im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wahrnehmen und wo ihre Potenziale liegen, um in der Förderperiode mit Finanzmitteln ausgestattet zu werden. Ebenfalls wurden strategische Ansätze und inhaltliche Schwerpunkte festgelegt (Arbeitsgemeinschaft der Naturparke Baden-Württemberg 2013). Das Strategiepapier der Naturparke war erfolgreich – das Land hat zugesagt, die Fördermittel der Naturparke in Baden-Württemberg von 2,4 Mio. auf 3 Mio. Euro pro Jahr anzuheben (Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 2014).
Naturparke gilt es vor diesem Hintergrund einerseits stärker als bisher als Akteure zu fordern, andererseits setzt dies voraus, sie stärker zu fördern. Nur in einem Wechselspiel können Naturparke ihre Aufgaben und gerade die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wahrnehmen.
Literatur
Arbeitsgemeinschaft der Naturparke Baden-Württemberg (2013): Strategiepapier Naturparke Baden-Württemberg. EU-Finanzperiode 2014-2020. Zaberfeld. http://www.naturpark-suedschwarzwald.de/sites/default/files/upload_imce/strategiepapier_naturparke-badenwuerttemberg_web.pdf (zuletzt abgerufen am 09.12.2014).
ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 2000): Nachhaltigkeitsprinzip in der Regionalplanung: Handreichung zur Operationalisierung. Forschungs- und Sitzungsber. 212, Hannover.
Barthelmess, A. (1988): Landschaft – Lebensraum des Menschen: Probleme von Landschaftsschutz und Landschaftspflege geschichtlich dargestellt und dokumentiert. Orbis academicus Sonderbd. 2/5: Problemgeschichte von Naturschutz, Landschaftspflege und Humanökologie, Freiburg/München.
Blab, J. (2006): Schutzgebiete in Deutschland – Entwicklung mit historischer Perspektive. Natur und Landschaft 81 (1), 8-11.
BMU (Bundesministerium für Umwelt, 1994): Naturparke als Instrument von Naturschutz und Landschaftspflege: Forschungsvorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – Abschlussbericht. Berlin.
Brodda, Y. (2002): Biosphärenreservat im Südharz – eine Chance für die Region? In: Mose, I., Weixlbaumer, N., Hrsg., Naturschutz: Großschutzgebiete und Regionalentwicklung, Naturschutz und Freizeitgesellschaft 5, 19-39.
Chilla, T., Kühne, O., Weber, F., Weber, F. (2015): ,Neopragmatische‘ Argumente zur Vereinbarkeit von konzeptioneller Diskussion und Praxis der ,Regionalentwicklung‘. In: Kühne, O., Weber, F., Hrsg., Bausteine der Regionalentwicklung, Springer VS, Wiesbaden, 13-24.
Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2011): UNESCO-Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald. http://www.unesco.de/vessertal.html (zuletzt abgerufen am 20.12.2011).
Erdmann, K.-H. (1998): Nachhaltige Entwicklung als regionale Perspektive. In: Heinritz, G., Wiessner, R., Wininger, M., Hrsg., Nachhaltigkeit als Leitbild der Umwelt- und Raumentwicklung in Europa, F. Steiner, Stuttgart (51. Deutscher Geographentag Bonn 1997, 2), 90-95.
–, d‘Oleire-Oltmanns, W. (1998): Biosphärenreservate – Schutz von Natur- und Kulturlandschaft durch nachhaltige Entwicklung. HGG-Journal 13, 74-87.
Forst, R., Scherfose, V. (2010): Entwicklungen und Perspektiven deutscher Naturparke. Naturschutz und Biologische Vielfalt 104, 189-195.
Herrenknecht, A., Wohlfarth, J. (1997): Auf dem Weg ins „Nachhaltigkeits-Land“? Was hat der ländliche Raum von der Nachhaltigkeitsdebatte zu erwarten? Pro Regio 20-21, 5-35.
Job, H. (1993): Braucht Deutschland die Naturparke noch? Eine Stellungnahme zur Diskussion um Großschutzgebiete. Naturschutz und Landschaftsplanung 25 (4), 126-132.
– (2000): Naturparke – Erholungsvorsorge und Naturschutz. In: Institut für Länderkunde, Hrsg., Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland: Freizeit und Tourismus, Heidelberg/Berlin, 34-37.
Kaether, J. (1994): Großschutzgebiete als Instrumente der Regionalentwicklung. Arbeitsmaterial der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 210, Hannover
Kühne, O. (2010): Das UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau: Entwicklungen, Beteiligungen und Verfahren in einer Modellregion. STANDORT 34 (1), 27-33.
– (2011): Heimat und sozial nachhaltige Landschaftsentwicklung. Raumforschung und Raumordnung 69 (5), 291-301.
–, Meyer, W. (2015): Gerechte Grenzen? Zur territorialen Steuerung von Nachhaltigkeit. In: Kühne, O., Weber, F., Hrsg., Bausteine der Regionalentwicklung, Springer VS, Wiesbaden, 25-40.
Liesen, J., Köster, U., Porzelt, M. (2008): 50 Jahre Naturparke in Deutschland: Das Petersberger Programm der Naturparke setzt internationale Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (1), 26-32.
Lommel, E. (1974): Naturparke in Deutschland. In: Stöhr, R., Hrsg., Ideen und Taten: Festschrift für Alfred Toepfer zum 80. Geburtstag, Hamburg, 95-112.
Mayring, P. (2003): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Beltz, Weinheim/Basel.
– (2007): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, U., Kardorff, E. von, Steinke, I., Hrsg., Qualitative Forschung: Ein Handbuch, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 468-475.
Mose, I. (1989): Eigenständige Regionalentwicklung – Chancen für den peripheren ländlichen Raum? Geogr. Zeitschr. 77 (3), 154-167.
Nationalpark Eifel (2013): Leistungsbericht. http://www.nationalpark-eifel.de/data/inhalt/LB2013_Web version_1427719558.pdf (zuletzt abgerufen am 02.04.2015).
– (2015): Herzlich Willkommen im Nationalpark Eifel. http://www.nationalpark-eifel.de/go/eifel/german/Willkommen/Willkommen.html (zuletzt abgerufen am 02.04.2015).
Naturpark Nordeifel e.V. (2015): Lage und Anreise. http://www.naturpark-eifel.de/go/eifel/german/Lage_und_Anreise/Lage_und_Anreise.html (zuletzt abgerufen am 02.04.2015).
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord (2014): Naturparkförderung 2015. http://www.naturparkschwarzwald.de/home/foerderung (zuletzt abgerufen am 09.12.2014).
Naturparkverband Bayern (2007): Beschluss: Naturparke in Bayern – eine Erfolgsgeschichte vor dem Aus? Bayerische Naturparke als Stiefkinder der bayerischen Landespolitik (pdf-Dokument). http://www.naturparke.de/system/librarydownloads/113/original/Naturparke_in_Bayern_-_Resolution.pdf?1298632525 (zuletzt abgerufen am 20.10.2014).
Spehl, H. (2005): Nachhaltige Raumentwicklung. In: ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung), Hrsg., Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover, 679-685.
Stakelbeck, F. (2011): Vorbilder für die umweltgerechte Landnutzung: Naturparke können Motoren einer nachhaltigen Regionalentwicklung sein. Unser Bayern (Beilage der Bayerischen Staatszeitung) 60 (8/9), 18-21.
Stuttgarter Zeitung (2013): Finanzierung von Nationalpark steht. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nordschwarzwald-finanzierung-von-nationalpark-steht.326a280b-31e4-4950-aa4e-e81c3273a52e.html (zuletzt abgerufen am 06.04.2015).
Succow, M. (2000): Der Weg der Großschutzgebiete in den neuen Bundesländern: Die Weiterentwicklung des Nationalparkprogramms von 1990. Naturschutz und Landschaftsplanung 32 (2-3), 63-70.
Toepfer, A. (1956): Naturschutzparke – eine Forderung unserer Zeit. Mitt. Ver. Naturschutzparke 1956, 172-174.
VDN (2003): 40 Jahre Verband Deutscher Naturparke: 1963-2003. Bispingen.
– (2009): Naturparke in Deutschland: Aufgaben und Ziele. Bonn.
– (2010): Qualitätsoffensive Naturparke. Bonn
Weber, Fr. (2013): Naturparke als Manager einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Probleme, Potenziale und Lösungsansätze. Wiesbaden.
Weber, F. (2014): Naturparke als Manager einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Ein Blick auf den Naturpark Nagelfluhkette am Alpennordrand. In: Chilla, T., Hrsg., Leben in den Alpen, Verstädterung, Entsiedlung und neue Aufwertungen, Haupt, Bern, 133-150.
– (2015): Nachhaltige Regionalentwicklung: Naturparke im Spannungsfeld zwischen Idealvorstellungen und Grenzen in der Praxis. Naturschutz und Biologische Vielfalt: Aktuelle Beispiele der Naturparkarbeit in Deutschland – Qualitätsoffensive Naturparke. Im Druck.
–, Weber, F. (2014): Naturparke als Regionalmanager – Instrumente einer grenzüberwindenden und „nachhaltigen“ Regionalentwicklung. Arbeitsber. ARL 10, 48-61.
Widmann, W. (1963): Naturschutzpark Lüneburger Heide. Ein Bildbericht über den ersten deutschen Naturschutzpark. Franckh’sche Verlagshandl., Stuttgart.
Anschriften der Verfasser: Dr. Friedericke Weber, Naturpark Rhein-Westerwald e.V., Dierdorfer Straße 62, D-56564 Neuwied, E-Mail friedericke.weber@gmail.com; Dr. Florian Weber, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Am Hofgarten 4, D-85354 Freising, E-Mail florian.weber@hswt.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen





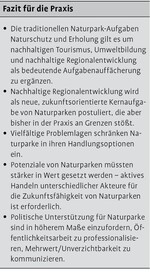
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.