Nationalparks in Deutschland: Es ist Zeit, die Potenziale zu nutzen
Im Jahr 2007 traf sich im Auftrag des Bundesumweltministers, tatkräftig unterstützt vom Bundesamt für Naturschutz, mehrmals eine Arbeitsgruppe im Park Wilhelmshöhe bei Kassel. Ihre Aufgabe lautete, der Bundesregierung dabei zu helfen, die deutsche Biodiversitätsstrategie als Umsetzung der 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen Biodiversitätskonvention zu verfassen. Dabei ging es auch um die Frage, welche zusätzlichen Gebiete als potenzielle Nationalparkflächen in Betracht kommen würden. Gemeinsam wurden damals 25 bis 30 solcher Räume zusammengetragen. Nach aktuellem Kenntnisstand müssten einige Standorte gestrichen werden, da sie den mittlerweile erarbeiteten Mindestkriterien (siehe auch Stöcker et al. in diesem Heft) nicht entsprechen.
- Veröffentlicht am
Als besonders fleißiger Kenner geeigneter Flächen zeichnete sich damals Edgar Reisinger von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie aus, der auch den wunderbaren Satz aussprach: „Wenn einer von uns vor 25 Jahren gesagt hätte, wir würden in einem Viertel-Jahrhundert über zehn Nationalparke in Deutschland verfügen, hätte man ihn in die Anstalt eingewiesen!“ Das war völlig richtig analysiert und sicherlich hat die einzige demokratisch legitimierte DDR-Regierung, die 1990 in ihrer letzten Sitzung vor der Selbstauflösung mit ihrem Nationalparkprogramm gleich fünf neue Gebiete einbrachte, an der aus Sicht des Naturschutzes sehr positiven Entwicklung ganz erheblichen Anteil.
1995 beschloss die Raumordnungsministerkonferenz (also nicht die Umwelt- und Naturschutzminister), 10 bis 15 % der nicht besiedelten Fläche Deutschlands bis 2020 zu ökologischen Vorrangflächen weiter zu entwickeln. Damit ging sie sogar über die wissenschaftlich abgeleitete 10- %Forderung der Theorie der differenzierten Landnutzung (Wolfgang Haber) hinaus.
In der nationalen Biodiversitätsstrategie von 2007 hat die Bundesregierung das Ziel formuliert, 5 % der Fläche Deutschlands ebenfalls bis 2020 zu Wildnisgebieten zu entwickeln. Der Anteil der Fläche aller deutschen Nationalparke erreicht noch nicht einmal 0,6 % der Landesfläche. Es bleibt also in den nächsten sechs Jahren viel zu tun, auch wenn den Wildnisgebieten nicht allen die Kategorie Nationalpark nach §24 des Bundesnaturschutzgesetzes zugesprochen werden wird, weil sie nicht alle Mindestqualitätsanforderungen (s.o.) werden erfüllen können.
Die Fachzeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung möchte diesen Prozess begleiten und gibt deshalb dieses Schwerpunktheft „Nationalparke in Deutschland“ heraus:
Norbert Panek und Martin Kaiser berichten über ihre Vorstellungen eines zukünftigen Nationalparkprogramms für Deutschland als Bestandteil eines Verbundsystems von Rotbuchenwäldern. Diese Vorschläge wurden im Rahmen eines Gutachtens für eine große Umweltschutzorganisation entwickelt. Selbst wenn alle vorgeschlagenen Gebiete als Wildnisgebiete umgewandelt werden könnten, würden die geforderten 5 % der Biodiversitätsstrategie noch nicht erreicht werden.
Harald Egidi stellt den neuen Nationalpark „Hunsrück/Hochwald“ als Gemeinschaftsprojekt der beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland vor. Bemerkenswert ist der dabei zur Anwendung gekommene Partizipationsprozess, der zum Teil auf Schweizer Erfahrungen aufbauen konnte und als ein Modell für zukünftige Nationalparkausweisungen dienen könnte. Auch die im Nationalparkgesetz festgelegte vollständige Inklusion ist hervorzuheben.
Ein Autorenteam um Isabel Stöcker leitet anhand der nunmehr gültigen Mindeststandards den Steigerwald als möglichen dritten Nationalparkstandort im Bundesland Bayern ab. Dieses Gebiet ist mit Sicherheit dazu geeignet, außerdem von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt zu werden. Leider haben sich der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer und die zuständige Umweltministerin Ulrike Scharf gegen den Nationalpark ausgesprochen. Sogar ein 775 ha großes Schutzgebiet wird aufgehoben (SZ vom 18.11.2014; siehe auch Seite 30 in diesem Heft). Trotz alledem wird die Anerkennung zum Welterbe weiterverfolgt. Wie das juristisch funktionieren soll, ist völlig ungeklärt. Bleibt zu hoffen, dass die zuständigen Gremien der UNESCO intelligenter und weitsichtiger sind als die bayerische Staatsregierung.
Die Ziele für Deutschland hat die Bundesregierung mit ihrer Biodiversitätsstrategie definiert. Auswahlkriterien und geeignete Gebiete sind bekannt. Was fehlt, ist allein ein deutlich größerer (politischer) Wille zur Umsetzung. Es ist an der Zeit, die Potenziale zu nutzen!
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

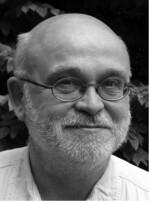
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.