Von der Heide zum Acker – und zurück?
Abstracts
Zur Kompensation der mit einem Windpark bei Midlum im Landkreis Cuxhaven verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im Umfeld des Windparks auf einer Ackerfläche von ca. 9 ha in mehreren Schritten Maßnahmen zur Entwicklung einer trockenen Sandheide auf langjährigen Ackerstandorten durchgeführt (oberflächennaher Bodenabschub, Ausbringung von gemähter Besenheide mit Samenständen). Der Beitrag fasst die Ergebnisse einer von 2008 bis 2012 durchgeführten Erfolgskontrolle zusammen, die Aufschluss über die Entwicklung der Vegetation sowie die faunistische Besiedlung gibt.
Nach einer vier- bis fünfjährigen Pionierphase hat sich auf der sandig-kiesigen Rohbodenfläche die Besen-Heide (Calluna vulgaris) fest etabliert und bietet zugleich einer artenreichen Pionier- und Ruderalvegetation mit vielen Magerkeitszeigern Entwicklungsmöglichkeiten. Der Anteil an Zielarten in der Vegetation nahm bis 2012 deutlich zu, darunter als gefährdete Arten Behaarter und Englischer Ginster (Genista pilosa, G. anglica). Sehr positiv ist die Entwicklung bei der Laufkäferfauna. 2012 wurden auf der Heideentwicklungsfläche 81 Laufkäferarten erfasst, darunter 30 Charakterarten für Sand- und Heidebiotope. Die hohe faunistische Bedeutung solcher Standorte für die Biodiversität belegen auch die Erfassungen der Stechimmen-Fauna in 2012 mit 153 nachgewiesenen Arten.
Folgerungen ausd den Ergebnissen für Heideentwicklungsmaßnahmen sowie Anforderungen an die Pflege- und Unterhaltung werden diskutiert.
From Heathland to Arable Field – and Back? Accompanying investigations on the development of heathland as compensation measure
For the establishment of a wind power plant close to Midlum in the district of Cuxhaven impacts into nature and landscape had to be compensated. The compensation scheme comprised the development of a dry sandy heathland on long-standing arable fields in the surrounding of the wind park on an area of 9 ha in several steps. Measures included removal of the topsoil and distribution of hay from mowed heather including seed heads. The paper summarises the results of a success monitoring conducted from 2008 to 2012 on the development of the vegetation and faunistic colonisation. After a pioneer phase of 4 to 5 years heather (Calluna vulgaris) has well established on the sandy-gravelly raw soil, and it provides habitats for a species-rich ruderal vegetation with many indicators of nutrient-poor sites. The share of target species in the vegetation significantly increased up to 2012, including endangered species such as hairy greenweed and petty whin (Genista pilosa, G. anglica). The ground beetles also show a very positive development. In 2012 81 species of carabidae have been identified on the heathland development site, with 30 species being character species for sandy and heathland biotopes. The high faunistic significance of such sites for biodiversity has been underlined by mappings of the vespidae, with 153 species being recorded in 2012. The paper discusses consequences for development measures on heathland and requirements for maintenance.
- Veröffentlicht am

1 Einführung
Zwergstrauch-Heiden hatten in Nordwestdeutschland ihre größte Verbreitung im 18. Jahrhundert, als sie zum Höhepunkt der Entwaldung fast die gesamten Geestgebiete mit sandigen Böden einnahmen (von Drachenfels 1996). Bis auf die ausgedehnten Heideflächen im NSG Lüneburger Heide und auf einigen Truppenübungsplätzen sind sie in Niedersachsen heute nur noch kleinflächige Relikte der historischen Kulturlandschaft. Dies trifft auch auf die Stader Geest im Landkreis (LK) Cuxhaven zu, wo im Übergangsbereich zur Wurster Küste nur noch alte Flurnamen wie Dorumer und Padingbütteler Heide auf die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts verbreiteten Sand- und Küstenheiden (GfN 1997) verweisen, während die aktuelle Landnutzung vor allem durch großflächigen Ackerbau – zunehmend mit Mais für Agrargasanlagen – geprägt ist.
Aufgrund der günstigen Exposition und Windhöfigkeit handelt es sich um einen bevorzugten Landschaftsraum für die Errichtung von Windenergieanlagen. Der Windpark „Hohe Geest“ östlich der Ortschaft Midlum (Abb. 1) wurde 1999 errichtet und umfasst 70 Windkraftanlagen (WKA) auf rund 300 ha Fläche (mdl. Mitt. S. König 2008, Vorhabensträger UMP GmbH). Die zur Kompensation für die mit dem Windpark verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen konzentrieren sich auf die Vergrößerung einer benachbarten Restheidefläche. Hierzu wurde vom Vorhabensträger eine Ackerfläche von rund 9 ha Größe erworben, die erst in den 1950er Jahren durch Tiefumbruch aus einer alten Heidefläche entstanden ist und an Bestände einer teilweise verbuschten Sandheide angrenzt (Alt-Heide). Zielsetzung ist somit die Rückführung einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Nutzfläche (Maisacker) zu einer Heidefläche. Durch die Kompensationsmaßnahme soll eine Aufwertung des Naturhaushalts (Verbesserung der Biotopfunktionen und des Biotopverbunds, Minderung von Schadstoffeinträgen) sowie eine Verbesserung des Landschaftsbilds erreicht werden.
Die in mehreren Phasen in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des LK Cuxhaven durchgeführten landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Initiierung einer Heideentwicklung wurden im Wesentlichen 2006 abgeschlossen. Der vorliegende Beitrag dokumentiert nach einer kurzen Maßnahmenbeschreibung die weitere Entwicklung der Heideentwicklungsfläche von 2008 bis 2012, die durch die Verfasser im Auftrag des derzeitigen Windpark-Betreibers (Das Grüne Emissionshaus GmbH, Freiburg) mit vegetationskundlichen und faunistischen Untersuchungen zur Erfolgskontrolle begleitet wurde.
2 Maßnahmenbeschreibung und Begleituntersuchungen
Die Heideentwicklungsmaßnahme erfolgt auf einer von Sanden und Kiesen gebildeten saaleeiszeitlichen Grundmoräne (Geschiebesand über Schmelzwasserablagerungen; Bodenkundlich-Geologische Karte der Marschgebiete des NLfB Blatt 2217). Im Bereich der alten Heidefläche liegt zudem eine lokale Flugsandbildung auf.
Während mit der historischen Heidebauernwirtschaft mit (Schaf-)Beweidung, Streu- und Plaggengewinnung über lange Zeiträume ein konstanter Nährstoff-Export verbunden war (Keienburg & Prüter 2006), war der nachfolgende Umbruch und die Ackernutzung mithilfe synthetischer Düngemittel mit einem massiven Nährstoff-Input verbunden. Die besondere Problemstellung für die Erreichung des Kompensationsziels lag daher in der Rückführung der Eutrophierung und der Schaffung eines besonders für die Etablierung von Besenheide (Calluna vulgaris) geeigneten sandigen Substrates. Unter fachlicher Beratung von Herrn G. Köster, der seine Erfahrungen aus der Heidepflege und regeneration aus der Lüneburger und Fischbecker Heide einbrachte, wurden vom damaligen Vorhabensträger UMP GmbH die folgenden Teilmaßnahmen durchgeführt:
1. In einem ersten Maßnahmenabschnitt wurde 2001 auf einem 10 m breiten Streifen entlang der Alt-Heide der Oberboden ca. 20 cm tief abgetragen und als Abgrenzung zu seitlichen Ackerflächen als Wall abgelegt. Auf der ca. 0,5 ha großen Sukzessionsfläche wurden aufkommende Pioniergehölze wiederholt entfernt und Anfang 2005 zur Beschleunigung der Heideentwicklung eine dichte Schicht von Schnittgut und oberer Rohhumusschicht der Besenheide aufgebracht (ca. 90 m3). Dieses so genannte Schopper-Material stammt von größeren Heidebeständen im Raum Lüneburg und wird bei Pflegemaßnahmen zur Regeneration überalterter Heideflächen mit einer starken Rohhumusauflage gewonnen. Bei diesem Vorgang wird überalterte Heide einschließlich der nicht vergrasten Rohhumusauflage mit einem speziell zur Heidepflege entwickelten Gerät aufgenommen und von der Fläche entfernt (Koopmann & Mertens 2004). Bereits 2006 konnten dann zahlreiche Keimlinge von Calluna festgestellt werden.
2. Auf der über 8 ha großen Hauptfläche erfolgte Ende 2006 ebenfalls der Abschub und Abtransport des gesamten Oberbodens, nachdem zwischenzeitlich zur Bodenaushagerung Roggen ohne Düngung und Pflanzenbehandlungsmittel angebaut wurde. Die Maßnahme wurde kostenfrei von einem an Oberboden interessierten Erdbauunternehmer aus der Region durchgeführt (Verwendung für Rekultivierung/Gartenbau etc.) Der Oberboden wurde soweit abgetragen, dass nur eine wenige Millimeter dicke Schicht des humifizierten Ah-Horizonts übrig blieb (Abschub meist bis knapp über dem Pflughorizont). Durch unterschiedliche Entnahmetiefen, Fahrspuren, freigelegte Kieslagen etc. ergab sich ein strukturreiches Mikrorelief. Anfang 2007 erfolgte zur Initialbegrünung mit Calluna vulgaris ebenfalls ein großflächiger, aber schütterer Auftrag von Schopper-Material (insgesamt ca. 570 m3).
Eine erste Erfolgskontrolle auf beiden Teilabschnitten wurde für die Vegetationsperiode 2008, also im dritten bzw. ersten Folgejahr nach dem Auftrag von Heide-Material veranlasst. Folgende Untersuchungen wurden mit gleicher Methode 2008, 2010 und 2012 auf beiden Abschnitten vorgenommen:
Vegetation (Bearbeitung: A. Tesch):
Vegetationsbeschreibung und Artenliste der Gefäßpflanzen mit Angabe von fünf Abundanzklassen nach Dierschke (1994) für die Gesamtfläche; Nomenklatur und Gefährdung der Gefäßpflanzen nach Garve (2004).
Vegetationsaufnahmen auf sechs quadratischen Dauerbeobachtungsflächen von je 16 m2 Größe (DQ); drei DQ im Bereich der ersten Abschiebung und Heideansiedlung 2005 (zwei mit Heide-, ein mit Grasdominanz) und drei DQ im Bereich der zweiten Bodenabschiebung und Heideaufbringung von 2007 (2008 überwiegend Rohboden); die Artmächtigkeit wurde aus einer Kombination von Deckung und Individuenzahl in neun Klassen erfasst (Dierschke 1994).
Fauna (Bearbeitung: U. Handke):
Aufgrund ihrer indikatorischen Eignung und der Besiedlungsdynamik wurde zur faunistischen Erfolgskontrolle eine Erfassung der Laufkäfer-Fauna beauftragt. Hierzu wurden zwei Reihen von je fünf Bodenfallen (BF) in der ersten (BF 1) und zweiten Maßnahmenfläche (BF 2/3/4) und eine Referenzfläche (BF 5) mit fünf Bodenfallen in der angrenzenden Alt-Heide eingerichtet. Die Fallenreihen wurden zwischen Ende März und Ende Mai und Anfang Juli bis Ende August aufgestellt, mit Äthylenglykol versehen und alle 14 Tage geleert.
Um eine breite Absicherung der Ergebnisse und eine umfassende ökologische Bewertung zu ermöglichen, wurden zusätzlich folgende Artengruppen auf der Heideentwicklungsfläche sowie zum Vergleich auf der angrenzenden Alt-Heide erfasst:
Brutvögel: Revierkartierung mit sieben Exkursionen zwischen Ende März und Mitte Juli. Die Auswertung erfolgte nach den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (Südbeck et al. 2005).
Reptilien: Registrierung aller Beobachtungen auf den Begehungen.
Tagfalter: Auf drei Exkursionen im Mai, Juli und August wurde an den Standorten für die Laufkäferuntersuchungen auf ca. 25 m langen und 10 m breiten Transekten die Häufigkeit aller Arten in Häufigkeitsklassen (1 Ex., 2-5 Ex., 6-20 Ex., > 20 Ex.) geschätzt. Fundpunkte der selteneren Arten wurde in eine Karte eingetragen.
Heuschrecken: Wie bei den Tagfaltern erfolgte eine Häufigkeitsabschätzung an den fünf Bodenfallenstandorten auf 25 x 10 m großen Flächen im Juli und August. Außerhalb dieser Probefläche wurden alle Einzelbeobachtungen seltener und gefährdeter Arten notiert.
Stechimmen: 2010 und 2012 wurden auf jeweils zehn Exkursionen im Sommerhalbjahr im Untersuchungsgebiet mit Netzfängen Aculeate Hautflügler (Bienen, Wespen und Ameisen) gefangen. Außerdem wurden die Beifänge des Bodenfallenmaterials ausgewertet. Zu Vergleichszwecken wurden jeweils auch die Heideflächen der näheren Umgebung mit einbezogen und dort ebenfalls das Bodenfallenmaterial ausgewertet.
3 Ergebnisse
3.1 Vegetation
Während der erste Maßnahmenstreifen mit konzentriertem Auftrag von Schopper-Material bereits 2008 als Pionierstadium einer Sandheide (Genisto-Callunetum) mit Magerrasen-Elementen zu bezeichnen war, stellt sich die Hauptfläche im zweiten Entwicklungsjahr nach Oberbodenabschub und Auftrag von Heide-Material noch als spärlich bewachsener Rohboden dar (Abb. 2). Erst ab 2010 war dann auch großflächig die Etablierung von Calluna-Keimlingen und Jungpflanzen festzustellen, die einen guten Zuwachs hatten, so dass im August 2012 die Gesamtfläche eine intensive Heideblüte zeigte (Abb. 3).
Der Deckungsgrad von Calluna liegt fünf Jahre nach Initialbegrünung noch deutlich unter 50 %. Neben Calluna treten daher eine Vielzahl weiterer Gefäßpflanzen und Kryptogamen auf. Von 2008 bis 2012 wurden auf der Gesamtfläche insgesamt 100 Gefäßpflanzen-Sippen erfasst. Neben den offenkundig durch den Auftrag des Heide-Materials eingebrachten Ginster-Arten konnte eine erstaunlich große Zahl von weiteren Pflanzenarten den neu geschaffenen Rohboden langfristig besiedeln oder zumindest kurzzeitig als „Trittstein“ nutzen. Naturgemäß ist der Anteil an ausbreitungsstarken Pionier- und Ruderalarten mit vielen Therophyten hoch, aber auch zahlreiche Pflanzen eher nährstoffarmer Grünländer fanden sich trotz der isolierten Lage innerhalb der durch intensiven Ackerbau geprägten Geest ein. Invasive Neophyten, wie das Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inaequidens), traten hingegen nur in geringer Abundanz auf. Anspruchsvollere Kräuter, auch Leguminosen (z.B. Weiß-Klee Trifolium repens), konnten sich im Untersuchungszeitraum auf Bodenpartien mit etwas höherem Humusanteil zwar halten, erreichten aber nur in den ersten Jahren eine höhere Deckung. Dies gilt auch für Gräser, einschließlich der anspruchslosen Schwingel-Arten und der Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), die sich im hier beobachteten Pionier- und Aufbaustadium der Heide (s.a. Pott 1995) auf dem Mineralboden nicht gegenüber der aufkommenden Besenheide durchsetzen konnten.
Während die relativ kleine Fläche hinsichtlich der Pflanzenarten eine bemerkenswerte Biodiversität aufweist, blieb die Zahl der in Niedersachsen gefährdeten Gefäßpflanzen mit drei Arten gering. Es sind die beiden gefährdeten Ginster-Arten (Genista anglica, G. pilosa), die mit Sicherheit durch das Schopper-Material eingebracht wurden, sowie die stark gefährdete Arnika (Arnica montana), die aus einem direkt benachbarten Bestand in der Alt-Heide einwandern konnte. Auf der Vorwarnliste stehen noch einige weitere in Nordwestdeutschland allgemein abnehmende Arten nährstoffarmer, sandiger Standorte (ohne Einzelfunde): Echtes Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea, vermutlich spontan eingewandert), Krähenbeere (Empetrum nigrum, evtl. durch Vögel aus Küstenheide-Beständen eingetragen) und Borstgras (Nardus stricta, vermutlich mit Heidematerial eingebracht oder aus Alt-Heide eingewandert). Insgesamt wurden zwölf Arten festgestellt, die als typische Arten von Sandheiden als Zielarten im engeren Sinne bezeichnet werden können, sowie 21 Arten von Magerrasen bzw. allgemeine Magerkeitszeiger, die als Zielarten im weiteren Sinne eingestuft werden (Tab. 1).
Anhand der sechs Dauerbeobachtungsflächen (DQ) kann die genannte Entwicklung im Detail nachvollzogen werden. Die erste Maßnahmenfläche (Heideauftrag Januar 2005) repräsentiert in Abb. 3 das DQ 2, die Hauptfläche mit dem späteren Bodenabtrag und Heideauftrag (Winter 2006/2007) das DQ 6.
Innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre nach dem Auftrag von samenhaltigem Schopper-Material auf den freigelegten Rohboden kann die Keimungsrate noch sehr gering sein. Eine deutlich erkennbare Etablierung der zunächst nur wenige Millimeter bis Zentimeter großen Heide-Sämlinge erfolgte jedoch auf beiden Maßnahmenflächen spätestens im dritten Entwicklungsjahr. 2008 bzw. 2010 lag der Deckungsgrad dann zumeist um die 20 %.
Die weitere, nahezu exponentielle Zunahme der Deckung innerhalb des bzw. der beiden folgenden Untersuchungsjahre ist vor allem auf das schnelle Größenwachstum der früh etablierten Calluna-Sämlinge zurück zu führen (Ausbildung von Kurz- und Langtrieben). Neue Keimlinge sowie Adventivbewurzelung zwischen den größeren Heidepflanzen waren dann nur noch selten festzustellen. Nach fünf Entwicklungsjahren liegt der Deckungsgrad zwischen 30 % und 50 % (im Mittel bei 40 %). Unter günstigen Umständen konnte, wie bei den DQ 2 und 3, nach sieben Jahren ein Calluna-Deckungsgrad von 60 % erreicht werden.
Der Gesamtdeckungsgrad wird durch die Kompartimente Kräuter/Gräser (inkl. Therophyten), sonstige Gehölze (Pioniergehölze) und Moose/Flechten bestimmt und hat sich innerhalb der sechs DQ deutlich unterschiedlich entwickelt und ist offenbar stark zufallsabhängig (Ablagerung von samenhaltigem Boden in der Herstellungsphase).
Insbesondere bei geringer Ausbreitungsdichte des Heidematerials wurde der feste Sandboden von trockenheitsresistenten Moosen (bes. Polytrichum piliferum, P. juniperinum) sowie einer so genannten „biologischen Kruste“ aus diversen Mikrophyten (Algen bzw. Krustenflechten) bedeckt und damit vor Erosion geschützt. Diese mikrobiotischen Bodenoberflächenkrusten waren über den Untersuchungszeitraum recht konstant und beeinflussen offenbar deutlich die Etablierung und Sukzession mit höheren Pflanzen, wie dies aus vielen Trockengebieten weltweit bekannt ist (Prasse 1999). Besonders im Übergang zwischen Heide-Polstern und anderen Pflanzen und den Übergängen zu den offenen Moosrasen und Krusten siedelten sich bereits in den ersten Entwicklungsjahren Cladonia-Flechten an (s.a. Fottner et al. 2004), die das charakteristische Artenspektrum der Heidevegetation ergänzen, aber nicht näher bestimmt wurden.
Zur Ansiedlung von typischen Gefäßpflanzen der Silbergrasfluren wie Silbergras (Corynephorus canescens) und Sand-Segge (Carex arenaria) kam es aufgrund des für diese Arten ungeeigneten, sehr dicht gelagerten sandig-kiesigen Rohboden nicht.
3.2 Ergebnisse – Fauna
3.2.1 Brutvögel
Während in den ersten beiden Untersuchungsjahren nur die Feldlerche innerhalb der Kompensationsfläche brütete, hat sich die Anzahl der Brutvogelarten 2012 auf fünf Vogelarten erhöht. Mit Rebhuhn, Heidelerche, Baumpieper und Dorngrasmücke sind vier Vogelarten hinzugekommen, die zuvor im Umfeld der Kompensationsfläche brüteten. Besonders hervorzuheben ist das Vorkommen der Heidelerche, einer charakteristischen Art der Heideflächen (Südbeck et al. 2005), die in Niedersachsen als gefährdet eingestuft wird (Krüger & Oltmanns 2007).
3.2.2 Reptilien
Auf der Heideentwicklungsfläche wurden drei Reptilienarten nachgewiesen: Blindschleiche (Anguis fragilis), Zauneidechse (Lacerta agilis) und Waldeidechse (Zootoca vivipara). Während Blindschleiche und Waldeidechse in Nordwestdeutschland noch weit verbreitet sind, hat die Zauneidechse ihren Verbreitungsschwerpunkt in Sand- und Heideflächen und wird in Niedersachsen als gefährdet eingestuft (Blanke 2004, Podloucky & Fischer 1994). Im ersten Untersuchungsjahr beschränkte sich das Vorkommen der beiden Eidechsenarten noch weitgehend auf die Randflächen, die benachbart zu älteren Heideflächen lagen, 2012 wurde aber mit zunehmenden Deckungsmöglichkeiten der Heidepflanzen auch die Gesamtfläche mit rund 25 (Zauneidechse) bzw. 40 (Waldeidechse) Exemplaren besiedelt. Bei einer Untersuchung von neuangelegten Heideflächen im Münsterland wurden hingegen nur die älteren deckungsreichen Heideflächen besiedelt und die jungen Flächen noch gemieden (Schwartze et al. 2010). Die schnellere Besiedlung bei Midlum steht vielleicht mit der geringeren Flächengröße in Zusammenhang. Die in den älteren Heideflächen als Einzelfund nachgewiesene Schlingnatter (Coronella austriaca), die in Niedersachsen stark gefährdet ist (Podloucky & Fischer 1994), konnte bisher nicht auf der neuen Heidefläche nachgewiesen werden.
3.2.3 Heuschrecken
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt neun Heuschreckenarten festgestellt. Charakteristisch für Heideflächen ist insbesondere die Kurzflügelige Beißschrecke (Metrioptera brachyptera) (Grein 2008). Im ersten Untersuchungsjahr besiedelte die Kurzflüglige Beißschrecke nur die Randzonen, 2012 wurde aber die gesamte Fläche besiedelt (ca. 30 Ex.). Weitere häufige Arten waren typische Heuschreckenarten von Trockenstandorten, wie die Gefleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculatus) und der Braune Grashüpfer (Chorthippus brunneus), Im Vergleich zu anderen Heidegebieten in Bremen oder in der Lüneburger Heider (Grein 2008, Handke & Menke 2013) ist die Heuschreckenfauna der Untersuchungsfläche aber relativ artenarm. Dies gilt aber auch für die benachbarten älteren Heidestandorte, da einige charakteristische Heuschreckenarten von Heidestandorten (z.B. Warzenbeißer Decticus verrucivorus, Kleiner Heidegrashüpfer Stenobothrus stigmaticus) zwischen Bremen und Hamburg ihre Verbreitungsgrenze erreichen (Grein 2008). Alle Heuschreckenarten, die auf den älteren Heidestandorten der Umgebung nachgewiesen wurden, konnten auch auf der Heideentwicklungsfläche erfasst werden.
3.2.4 Tagfalter und Widderchen
Bei den Tagfaltern und Widderchen wurden neben Ubiquisten und zugeflogenen Arten von Gehölzstandorten auch mehrere typische Arten von Trockenstandorten nachgewiesen: Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus), Argus-Bläuling (Plebeius argus), Gemeines Grünwidderchen (Adscita statices) und Gemeines Blutströpfchen (Zygaena filipendulae). Vom Gemeinen Blutströpfchen wurden nur Einzeltiere beobachtet. Die übrigen drei Arten hielten sich in den ersten beiden Untersuchungsjahren noch in den Randbereichen auf, besiedelten aber 2012 die gesamte Fläche. Der Argus-Bläuling kann als Charakterart von Heideflächen bezeichnet werden, da die Raupen neben Schmetterlingsblütlern auch Calluna-Pflanzen fressen (Settele et al. 2005).
3.2.5 Stechimmen (Aculeata)
Auf der Heideentwicklungsfläche konnten insgesamt 153 Stechimmenarten festgestellt werden, darunter sechs Goldwespen-, vier Dolchwespen-, zwölf Ameisen-, sechs Lehmwespen-, sechs Faltenwespen-, 17 Wegwespen-, 29 Grabwespen- und 73 Bienenarten. Von 2010 auf 2012 war im Untersuchungsgebiet ein deutlicher Anstieg der Artenzahl von 92 auf 142 Arten zu beobachten, die Artenzahl lag aber noch deutlich unter der älterer Heidestandorte in der Umgebung (190 Arten). In anderen Heidestandorten bei Cuxhaven konnten bisher 222 Bienen- und Wespenarten nachgewiesen werden (Sprichardt 2010). In älteren Heidebiotopen kommen insbesondere noch Arten vor, die in Holz oder Stängeln nisten und auf der jungen Heideentwicklungsfläche noch keine geeigneten Habitate vorfinden. Gerade auch einige kleinere Arten (z.B. einige Specodes-Arten) kommen nur auf älteren Standorten vor. Viele Bienenarten haben einen relativ kleinen Aktionsradius (wenige hundert Meter) und besiedeln daher neue Flächen vergleichsweise langsam (Westrich 1989).
Bereits im ersten Untersuchungsjahr traten Bienen- und Grabwespen auf, die offene Bodenstellen besiedeln (z.B. Ammophila sabulosa, Colletes cunicularius, Crossocerus wesmaeli, Oxybelus uniglumis, Specodes albilabris). 2012 wurden aber auch die nur an Heidekraut Pollen sammelnden Bienenarten Andrena fuscipes und Colletes succinctus sowie deren Brutparasiten Epeolus cruciger und Nomada rufipes festgestellt. Insgesamt konnten auf der Heideentwicklungsfläche 17 Arten festgestellt werden, die auf den Roten Listen Deutschlands oder Niedersachsens stehen (Schmidt-Egger 2011, Theunert 2002, Westrich 2011): Lasius psammophilus, Ammophila pubescens, Andrena barbilabris, A. fuscipes, A. gravida, A. humilis, Bombus hortorum, B. jonellus, Colletes fodiens, C. marginatus, Dryudella stigma, Hylaeus confusus, Nomada fuscicornis, N. leucophthalma, N. rufipes, Osmia leiana und Panurgus banksianus. Besonders erwähnenswert sind die Nachweise von Colletes marginatus, einer in Niedersachsen vom Aussterben bedrohten Bienenart, die vor allem in Küstennähe vorkommt und der in Niedersachsen seltenen Goldwespe Holopyga generosa und der seltenen Grabwespe Dryudella stigma (Riemann & Homann 2005, Sprichardt 2010).
Neben der Besenheide haben insbesondere Glockenblumen und verschiedene Korbblütler und Schmetterlingsblütler eine hohe Bedeutung für nahrungssuchende Bienenarten (z.B. einige spezialisierte Arten wie Colletes marginatus: Schmetterlingsblütler, Panurgus banksianus: Korbblütler). Mit Ausnahme der älteren Heidestandorte der Umgebung sind in der Nähe kaum noch geeignete Nahrungshabitate für Wildbienen vorhanden, da die Kulturlandschaft der Umgebung extrem blütenarm ist.
3.2.6 Laufkäfer
Laufkäfer sind eine überwiegend am Boden und räuberisch lebende Käfergruppe, die sich aufgrund der sehr verschiedenen Ansprüche an Mikroklima und Vegetationsstruktur hervorragend als Indikatorgruppe eignet (Schmidt & Melber 2004).
Auf der Heideentwicklungsfläche wurden zwischen 2008 und 2012 insgesamt 85 Laufkäferarten festgestellt. Die meisten Laufkäferarten sind sehr gut flugfähig (Turin 2000) und waren daher in der Lage, das Untersuchungsgebiet schnell zu besiedeln. Die Gesamtartenzahl hat sich zwischen 2008 und 2012 nur wenig geändert. Zu den häufigsten Arten zählten 2012 Carabus cancellatus (Individuenanteil 22,1 %), Poecilus lepidus (18,1 %), Poecilus versicolor (7,9 %), Calathus erratus (7,7 %), Cicindela hybrida (6,3 %), Carabus nitens (6,0 %) und Calathus erratus (5,8 %).
Insgesamt konnten auf der Heideentwicklungsfläche seit 2008 17 Laufkäferarten nachgewiesen werden, die auf den Roten Listen Deutschlands (Trautner et al. 1998) oder Niedersachsens stehen (Assmann et al. 2002). Hervorzuheben sind vor allem die Nachweise der Arten Cicindela maritima (NS/HB: vom Aussterben bedroht), Calosoma aureopunctatum, Carabus nitens, Calathus mollis und Amara quenseli (jeweils NS/HB: stark gefährdet). Cicindela maritima ist eine typische Laufkäferart der Küstendünen, deren Vorkommen in Niedersachsen auf Sandflächen in der Nähe zum Meer beschränkt ist (Turin 2000). Von den Rote-Liste-Arten können vor allem Carabus nitens, Nothiophilus germinyi und Bradycellus ruficollis zu den charakteristischen Arten von Heideflächen gezählt werden (Falke & Assmann 2001); Bradycellus ruficollis ist eine Laufkäferart, die sich vor allem von Calluna-Samen ernährt (Schmidt & Melber 2004).
Der Individuenanteil typischer Laufkäferarten von Sand- und Heideflächen (s. Tab. 2 und Abb. 5) ist auf der Heideentwicklungsfläche im Mittel von 26,5 % (2008) auf 52,1 % (2010) angestiegen und danach wieder leicht gesunken (48,7 % in 2012). Im ersten Untersuchungsjahr waren noch typische Arten offenerer Sandflächen wie z.B. Cicindela hybrida und Broscus cephalotes sehr häufig vertreten. Ab 2010 wurden aber typische Arten von Heideflächen und dichter bewachsenen Sandflächen wie Carabus nitens und Poecilus lepidus deutlich häufiger. Im Vergleich zu dem älteren Heidestandort der Umgebung fehlen auf der Heideentwicklungsfläche noch charakteristische Arten von Heideflächen (Schmidt & Melber 2004) wie Bembidion nigricorne und Cymindis vaporariorum, die dort aber auch nur in wenigen Exemplaren gefunden wurden. Arten die offenere Lebensräume bevorzugen (Cicindela hybrida, Carabus cancellatus, Poecilus lepidus) waren in der Heideentwicklungsfläche häufiger vertreten. Arten wie Abax parallepipedus und Pterostichus niger, die typisch für Brachen oder Gehölze sind (Turin 2000) waren an dem älteren Heidestandort häufiger. In Untersuchungen in Heideflächen der Lüneburger Heide und im Emsland wurden noch Amara infima, Bradycellus caucasicus, Cymindis humeralis, Dicheirotrichus cognatus, Harpalus solitaris und Miscodera arctica als Charakterarten von Heideflächen festgestellt (Falke & Assmann 2001, Schmidt & Melber 2004).
4 Diskussion
Sandheiden sind ein sehr selten gewordener Lebensraumtyp in der heutigen Agrarlandschaft, so dass der Naturschutz neben dem Erhalt durch ein effizientes Biotopmanagement zunehmend auch eine Vergrößerung der verbliebenen Restbestände anstrebt und damit die Wiederherstellung von Calluna-Heiden, bevorzugt auf sandigen Ackerflächen, die als historische Heidestandorte bekannt sind (Prüter 2004, Symes & Day 2003, Van der Ende 1993). Untersuchungen zur Heideregeneration belegen die besondere Bedeutung von offenem, humusarmem Sandboden für die Neuetablierung von Calluna-Sämlingen (Lindner 2008, Tornede & Harrach 1998). Während eine extensive Acker- oder Grünlandnutzung ohne Düngung allenfalls sehr langfristig zur Reduktion von im Oberboden akkumulierten Nährstoffen führt (besonders hinsichtlich der Phosphat- und Stickstoffgehalte, Warming 1996, Broll et al. 2000), wird durch einen weitgehenden Abtrag des Oberbodens – wie beim Plaggen überalterter Heideflächen – unmittelbar ein geeignetes Substrat als Keimbett für die Heidevegetation geschaffen (Härdtle et al. 2009, Mertens in Kirmer et al. 2006). Die Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit anderen Studien (s.a. Ketner-Oostra et al. 2012, Pywell et al. 2011, Schwarze et al. 2010, Verhagen et al. 2001 zit. in Härdtle et al. 2009), wonach eine erfolgreiche und nachhaltige Heideregeneration am besten durch die Kombination von Oberbodenabschub (top soil removal) und Auftrag von samenhaltigem Heidematerial aus der mechanischen Heidepflege möglich ist. Bei kleinflächigen Maßnahmen im Umfeld von intakten Sand- und Feuchtheiden ist auch eine eigenständige Einwanderung der Zielarten innerhalb weniger Jahre möglich (Nagler 1999).
Die Ergebnisse der Begleituntersuchungen zur Kompensationsmaßnahme in Midlum von 2008 bis 2012 zeigen, dass die Maßnahme zur Vergrößerung der bestehenden Alt-Heide auf einem Ackerstandort erfolgreich war. Etwa fünf Jahre nach dem nahezu vollständigen Abschub und Abfuhr des Oberbodens und dem Auftrag von samenhaltigem Heideaufwuchs mit Oberboden aus der Heidepflege (Schoppermaterial) ging auf beiden Maßnahme-Teilflächen die Pionierphase mit der ersten Etablierung der Besen-Heide in eine stabile Aufbauphase über, in der die Gesamtdeckung von Calluna und weiteren heidetypischen Arten stark zunahm. Die relativ „grob“ durchgeführte Beseitigung des durch Ackerbau eutrophierten und homogenisierten Oberbodens hatte zur Folge, dass ein vielfältiges Mikrorelief mit kleinteiligen Unterschieden hinsichtlich der Verteilung des sandig-kiesigen Mineralbodens und Einschlüssen von Oberbodenresten sowie frei gelegten leicht stauenden Bodenschichten entstand. Diese kleinräumige Standortvielfalt hat sich sehr positiv auf die Biodiversität in der Pionierphase ausgewirkt. Wo im Untergrund eine leichte Stauwirkung, z.B. durch Ortstein oder Lehmschichten, vorhanden ist, könnten sich zukünftig Übergänge zur so genannten „Lehmheide“ bzw. „Feuchten Sandheide“ einstellen, die sich durch hinsichtlich der Nährstoffversorgung etwas anspruchsvollere Pflanzenarten sowie Feuchtezeiger wie die Glocken-Heide (Erica tetralix) auszeichnet (s.a. Ellenberg & Leuschner 2010, GfN 1997, Köster 1986).
Die Prognosen für die weitere Entwicklung sind somit günstig, wenn auch weiterhin eine regelmäßige Begrenzung der Ausbreitung von Pioniergehölzen erfolgt. Besonders Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) und Sand-Birke (Betula pendula) werden vermutlich überwiegend durch Samenflug aus umgebenden Gehölzbeständen eingetragen und konnten sich auf dem freigelegten Rohboden in großer Anzahl entwickeln (Abb. 3). Eine Entkusselung ist bei nahezu allen Binnenheiden – in Kombination mit anderen Pflegemaßnahmen – erforderlich, um eine frühzeitige Sukzession in Richtung Wald zu verhindern (s. Rode 1998). Während in der Pionierphase zur Schonung der Calluna-Jungpflanzen keine Beweidung sinnvoll war, sollte zukünftig vor allem zur Verdrängung von Gehölzen eine kurzfristige, aber intensive Beweidung bevorzugt mit Heidschnucken erfolgen.
Auch aus faunistischer Sicht war die Maßnahme sehr erfolgreich. Heideflächen zeichnen sich durch das Vorkommen vieler wärmeliebender und gefährdeter Tierarten aus (Schmidt & Melber 2004). Bisher liegen nur wenige Untersuchungen über die faunistische Entwicklung von neu geschaffenen Heidestandorten vor (Borchard et al. 2013, Schwartze et al. 2010). Bereits nach sehr kurzer Zeit hat sich auf den in dieser Studie untersuchten Flächen eine hohe Anzahl gefährdeter Tierarten angesiedelt. Hervorzuheben sind insbesondere Heidelerche, Zauneidechse, Argus-Bläuling, jeweils 17 Rote-Liste-Arten bei Laufkäfern und Stechimmen (z.B. Cicindela maritima, Carabus nitens, Colletes marginatus, Dryudella stigma). Mit Ausnahme der Stechimmen, bei denen die Besiedlung etwas langsamer erfolgt, wurde bei den übrigen Tiergruppen ein sehr hoher Anteil der Arten festgestellt, die in den älteren Heidebeständen der Umgebung beobachtet wurden. Begünstigt wurde die schnelle Entwicklung bei der Fauna durch die räumliche Nähe zu älteren Heidestandorten. Untersuchungen an Spinnen an neugeschaffenen Heidestandorten im Münsterland kamen zu dem Ergebnis, das bei dieser Tiergruppe die Besiedlung mit heidetypischen Arten sehr langsam erfolgt (Schwartze et al. 2010). Im gegenwärtigen Stadium wird bei der Fauna der Heideentwicklungsfläche Midlum eine hohe Diversität mit vielen typischen Arten von Heide- und Sandstandorten durch den kleinräumigen Wechsel zwischen Heideflächen und offenen Bodenflächen erreicht. Daher ist auch aus faunistischer Sicht die Durchführung regelmäßiger Pflegemaßnahmen erforderlich, die das Aufkommen von Gehölzen verhindern und auch in regelmäßigem Abstand offene Bodenstellen neu erzeugen.
Außerhalb bestehender Schutzgebiete sind naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen zur Finanzierung, Umsetzung und Unterhaltung einer Heideentwicklung besonders geeignet. Die Kosten-Nutzen-Effizienz für top soil removal wird aufgrund der langfristigen Wirksamkeit des Nährstoffaustrags und der Verminderung von Folgekosten für die Unterhaltung als hoch eingeschätzt, insbesondere wenn der Oberboden – wie in Midlum – einer landwirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden kann (s.a. Härdtle et al. 2009). Die positiven Erfahrungen im Landkreis Cuxhaven sollten zu einer vermehrten Durchführung entsprechender Heideentwicklungsmaßnahmen ermuntern. Derartige Entwicklungsmaßnahmen sollten möglichst in räumlicher Nähe zu Heide- und Magerrasenrelikten durchgeführt werden. Sie können so einen wertvollen Beitrag zum Biotopverbund in der zunehmend verarmten Agrarlandschaft leisten.
Dank
Für Informationen zum Vorhaben bedanken wir uns herzlich bei S. König (UMP GmbH) sowie W. Rusch und P. Müller (LK Cuxhaven – Naturschutzbehörde). Für die gute Zusammenarbeit und die Finanzierung der Untersuchungen bedanken wir uns bei B. Wieland (Das Grüne Emissionshaus) und dem Windpark Midlum.
Literatur
Assmann, T., Dormann, W. , Främbs, H., Gürlich, S., Handke, K. , Huk, T., Sprick, P., Terlutter, H. (2002): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Sandlaufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) mit Gesamtartenverzeichnis. Inform.d. Naturschutz Nieders. (2), 70-95.
Bauer, H.G., Berthold, P. , Boye, P. , Knief, W., Südbeck, P., Witt, K. (2002): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. Ber. Vogelschutz 39, 13-60.
Blanke, I. (2004): Die Zauneidechse – zwischen Licht und Schatten. Beih. Zeitschr. Feldherp. 7, 1-160.
Boll, G., Franz, S., Teutenberg, S. (2000): Aushagerung einer Pufferzone zum Schutz eines Heide-Naturschutzgebietes. Naturschutz und Landschaftsplanung 32 (4), 112-116.
Borchard, F., Schulte, A.M., Fartmann, T. (2013): Rapid response of Orthoptera to restoration of montane heathland. Biodiversity and Conservation 22, 687-700.
Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie: Grundlagen und Methoden. UTB, Ulmer, Stuttgart.
Drachenfels, O.v. (1996): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen in Niedersachsen. Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 34.
Ellenberg, H., Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Ulmer, Stuttgart, 1345 S..
Falke, B., Assmann, T. (2001): Zur Käferfauna von Sandtrockenrasen und Heidegesellschaften in Hudelandschaften des Emslandes (Nordwestdeutschland) (Coleoptera: Carabidae, Elateridae, Byrrhidae et Tenebrionidae). Drosera 2001, 35-52.
Fottner, S., Niemeyer, T., Sieber, M., Härdtle, W. (2004): Zur kurzfristigen Entwicklung auf Pflegeflächen in Sand- und Moorheiden. Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland, Bd. 17, 126-136.
Garve, E. (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen – 5. Fassung vom 1.3.2004. Inform. d. Naturschutz Nieders. 24 (1), 1-76.
GFN mbH (1997): Pflege- und Entwicklungsplan „Krähenbeer-Küstenheiden im Raum Cuxhaven“ – Band I Grundlagen. Unveröff. Gutachten i.A. LK Cuxhaven, Amt für Naturschutz und Landschaftspflege.
Grein, G. (2008): Fauna der Heuschrecken (Ensifera & Caelifera) in Niedersachsen. Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 46, 1-185.
Handke, U., Menke, K. (2013): Ergebnisse zoologischer Untersuchungen an verschiedenen Tiergruppen (Amphibien, Reptilien, Libellen, Tagfalter und Heuschrecken) in den unbebauten Flächen von Bremen Nord 2006. Abh. Naturwiss. Verein Bremen 41 (1), 63-84.
Härdtle, W., Assmann, T., van Diggelen, R., von Oheimb, G. (2009): Renaturierung und Management von Heiden. In: Zerbe, S., Wiegleb, G., Hrsg., Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, 317-347.
Keienburg, T., Prüter, J. (2006): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Erhalt und Entwicklung einer alten Kulturlandschaft. Mitt. NNA 17, Sonderh. 1, 65 S.
Ketner-Oostra, R., Aptoot, A., Jungerius P., Sykora, K. 2012: Vegetation sussession and habitat restoration in Dutch lichen-rich inland drift sands. Tuexenia 32, 245-268.
Kirmer, A., Tischew, S. (Hrsg., 2006): Handbuch naturnahe Begrünung von Rohböden. Teubner, Stuttgart.
Koopmann, A., Mertens, D. (2004): Offenlandmanagement im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ – Erfahrungen aus Sicht des Vereins Naturschutzpark. NNA-Ber. 17 (2), 44-61.
Köster, G. (1986): Naturheidegebiete im Raume Cuxhaven. Ber. Botan. Verein Hamburg 8.
Krüger, T., Oltmanns, B. (2007): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel. Inform.d. Naturschutz Nieders. (3), 131-175.
Müller-Motzfeld, G. (2004): Adephaga 1 Carabidae (Laufkäfer) In: Freude, H., Harde, K., Lohse, G., Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 2, 530 S.
Nagler, A. (1999): Bemerkenswerte Vegetationsentwicklung nach Abtrag des Oberbodens in verschiedenen bremischen Schutzgebieten. Abh. Naturwiss. Verein Bremen 44 (2/3), 579-592.
Podloucky, R., Fischer, C. (1994): Rote Liste der gefährdeten Amphibien und Reptilien in Niedersachsen und Bremen. Inform.d. Naturschutz Nieders. (4), 109-120.
Prasse, R. (1999): Experimentelle Untersuchungen an Gefäßpflanzenpopulationen auf verschiedenen Geländeoberflächen in einem Sandwüstengebiet. Universitätsverlag Rasch.
Prüter, J. (2004): Schutz und Erhaltung der Heide – aktuelle Ansätze aus europäischer Perspektive. NNA-Ber. 17 (2), 22-26.
Pywell, R.F., Meek, W.R., Webba N.R., Putwain, P.D., Bullock, J.M. (2011): Long-term heathland restoration on former grassland: The results of a 17-year experiment. Biol. Conserv. 144, 1602-1609.
Rode, W. (1998): Sukzession in Heidegebieten – Grenzen und Definitionen eines prozeßorientierten Naturschutzes in einer Kulturlandschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (8/9), 285-290.
Schmidt, L., Melber, A. (2004): Einfluss des Heidemanagements auf die Wirbellosenfauna in Sand- und Moorheiden Nordwestdeutschlands. NNA-Ber. (2), 145-164.
Schwartze, M., Kreuels, M., Beulting, A., Noel, N.M., Soller, C. (2010): Flora und Fauna in einer neu geschaffenen Heide. Natur in NRW 3, 26-31.
Settele, J., Steiner, R., Reinhardt, R., Feldmann, R. (2005): Schmetterlinge – die Tagfalter Deutschlands. Ulmer, Stuttgart, 256 S.
Sprichardt , J. (2010): Bienen und Wespen naturnaher Restheiden im Raum Cuxhaven. Drosera 2010 (1/2), 77-102.
Südbeck, P., Andretzke, H. , Fischer, S., Gideon, K. Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell, 777 S.
Symes, N., Day, J. (2003): A practical guide to the restoration and management of Lowland Heath. RSPB (ed.).
Tornede, D., Harrach, T. (1998): Effizienzkontrolle von Heidepflegemaßnahmen. Erste Ergebnisse von Dauerbeobachtungsflächen auf dem TÜP Senne. Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (7), 205-210.
Trautner, J., Müller-Motzfeld, G., Bräunicke, M. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae Deutschlands. In: Bundesamt f. Naturschutz, Hrsg., Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 55, 159-167.
Turin, H. (2000): De Nederlandse loopkevers, verspreiding en ecologie (Coleoptera: Carabidae) – Nederlandse Fauna 3, Leiden, 666 S.
Van der Ende, M. (1993): Heidemanagement in Schleswig-Holstein. Ber. NNA 6 (3), 53-62.
Verhagen, R., Klooker, J., Bakker, J.P., Diggelen, R. van (2001): Restoration success of low-production plant communities on former agricultural soils after top-soil removal. Appl. Veg. Sci. 4, 75-82.
Warming, D. (1996): Die Entwicklung von Vegetation und Boden auf ehemaligen Ackerflächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Ergebnisse einer Chronosequenzanalyse. Tuexenia 16, 451-496.
Westrich, P. (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart, 972 S.
Anschriften der Verfasser: Dr. Andreas Tesch, Planungsbüro Tesch, Mahlstedtstraße 45, D-28759 Bremen, E-Mail tesch@planung-tesch.de; Uwe Handke, Welsestraße 26, D-27753 Delmenhorst, E-Mail uhand@t-online.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen







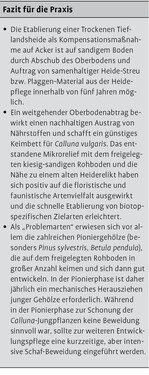
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.