Aktive Partizipation – Bürger als Freiwillige in der Landschaftspflege
Abstracts
Lokale Landschaftspflegeeinsätze mit Freiwilligen aus der Region stehen im Mittelpunkt der hier vorgestellten Forschungsarbeit. Ausgehend von der Überlegung, dass die Landschaft dynamisch ist und dass die Ausführung oder das Wegfallen von bestimmten Handlungen Veränderungen in dieser Dynamik mit sich bringen, werden Initiativen analysiert, in denen Bürger aktiv in dieser Gestaltung und Erhaltung der Landschaft beteiligt werden. Dafür wurden zwei Initiativen anhand einer qualitativen Fallstudie untersucht. In dieser Fallstudie wurden die qualitativen Erhebungsmethoden „narratives Interview“ und „teilnehmende Beobachtung“ mit einer quantitativen Fragebogenerhebung kombiniert. In beiden Fällen arbeiten Bürger als Freiwillige in der Landschaftspflege mit, im ersten Fall als direkte Unterstützer von Landwirten bei der Heuernte in der Gemeinde Frastanz in Vorarlberg und im zweiten Fall als Teil organisierter Pflegeeinsätze in mehreren Kommunen am Hesselberg in Mittelfranken. Die Motivationen für die Beteiligung sind vielfältig: eine individuelle Liebe zur Natur oder die Bereitschaft, etwas für die Kommune zu leisten. Auch die Erhaltung der Landschaft an sich kann dabei motivierend wirken. Die Arbeitseinsätze können aber auch das Verhältnis der Freiwilligen zur Landschaft verändern, beispielsweise über das Verstehen der dahinterliegenden Prozesse.
Active Participation – Citizens as Volunteers of Landscape Maintenance. Motivation, effects and framework conditions
The research focussed on the active participation of volunteers in landscape development by maintenance work, based on the thesis that landscape is a dynamic concept influenced by human action. The method chosen was a qualitative, descriptive case study with two cases. The first case is the local community of Frastanz in Austria that works with volunteers supporting farmers in hay harvesting. The other case is a project on organised collective maintenance actions in various villages in the Hesselberg region in Middle Franconia, Germany. For data collection the research combined the qualitative methods of participatory investigation and interviews with a quantitative survey amongst the volunteers. The qualitative data were analysed by using the method of content analysis and the quantitative survey was evaluated using descriptive statistics tools. The motivation of the volunteers for participation has proven to be multifaceted: individual love for nature or the willingness to support the local community. The idea of preserving the landscape can also be motivating. Concerted actions can also change the relationship to landscape of the volunteers, e.g. due to the understanding of the underlying natural processes.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Schwielen an den Händen, eine ordentliche Brotzeit bei Sonnenuntergang und das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben – auch das ist Partizipation an Landschaft, und zwar in Form von freiwilligen Arbeitseinsätzen in der Landschaftspflege. Diese besondere Form der Beteiligung steht im Mittelpunkt dieses Beitrags, der Teile eines Dissertationsprojekts (Mühlmann 2009) wiedergibt, das im Zuge des Doktoratskollegs Nachhaltige Entwicklung an der Universität für Bodenkultur durchgeführt wurde.
Das Forschungsinteresse an Landschaftspflegeeinsätzen mit Bürgern entstand durch die Beobachtung, dass viele Gemeinden vor dem Problem stehen, dass sie ihre Landschaft erhalten oder aufwerten wollen, die Landwirtschaft aber die dazu nötigen Pflegeleistungen nicht aufbringen kann oder will (vgl. Hodge 2007, Hunziker 2000). In vielen Gemeinden konzentriert sich das Land auf wenige Landwirte, die auf eine intensivere Bewirtschaftung umstellen und für viele Pflegeleistungen (Hecken, steile Hänge, Einzelbäume) keine Zeit haben, so dass die Landschaft verarmt. Gleichzeitig wird eine gepflegte Landschaft bzw. eine schöne Umgebung als Teil der Lebensqualität am Wohnort immer stärker eingefordert. Eine aktiv genutzte Freizeit ist für den Menschen wichtig, körperliche Ertüchtigung und geistiger Ausgleich stehen dabei oft im Mittelpunkt (Bosshart & Frick 2006, Degenhardt & Buchecker 2012), und dafür soll Landschaft als Teil des Lebensumfelds die adäquaten Rahmenbedingungen bieten.
Nun stellt sich die Frage, wie die langfristige Erhaltung und Pflege der Landschaft gesichert werden kann. Eine Möglichkeit, die sich in diesem Zusammenhang bietet, wäre es, genau diese Freizeitnutzer stärker miteinzubeziehen und sie in ihrer Freizeit aktiv an der Landschaftserhaltung oder -gestaltung zu beteiligen. Dabei arbeiten sie als Freiwillige an der Landschaftspflege mit und stellen ihre Arbeitsleistung ohne monetäre Vergütung zur Verfügung. Ein Ansatz, der in der Praxis bereits Anwendung findet und auf Interesse bei anderen Gemeinden/Regionen stößt (Hirnschall 2009), der aber wissenschaftlich noch kaum untersucht wurde.
Sucht man in der Literatur nach Beteiligung von Bürgern oder Freizeitnutzern an der Landschaftserhaltung, so findet man vor allem Beispiele für kooperative Planungs- und Steuerungsprozesse (Enengel 2009, Höppner et al. 2007, Luz 1993). Kulturlandschaftsentwicklung wird als akteurs-, projekt- und umsetzungsorientierter Raumentwicklungsprozess verstanden (Gailing et al. 2007) und Partizipation als Instrument, das Umweltziele zu Nachhaltigkeitszielen macht (Feindt & Newig 2005). Neuere Literatur weist darauf hin, dass Partizipation im Sinne von Mitbestimmung das Verantwortungsempfinden für die umgebende Landschaft stärken kann, was wiederum den Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung darstellt (Buchecker et al. 2003). Es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass direkte Mitarbeit an der Landschaftsgestaltung eine ähnliche oder sogar stärkere Wirkung auf die Verantwortung hat.
Was aber kann Bürger dazu motivieren, sich aktiv an der Landschaftspflege zu beteiligen, wie wirkt sich dieses auf ihr Verantwortungsgefühl aus und was machen solche Landschaftspflegeaktionen zu einem Erfolg? Diese Fragen stellt sich das Forschungsvorhaben und konzentriert sich dabei auf die Arbeit mit ortsansässigen Freizeitnutzern/Bürgern (im Folgenden als Freiwillige bezeichnet). Damit wird die touristische Nutzung von Freiwilligenarbeit ausgeklammert und stärker auf die Beziehung der Freiwilligen zu ihrer Alltagslandschaft eingegangen.
Wo lässt sich diese Art der Beteiligung aber nun im aktuellen Diskurs über die Gestaltung einer zukünftigen Landschaft einordnen? Ein möglicher Ansatz ist dabei, von der Landschaft als kollektivem Gut auszugehen, das von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Nutzungs- und Verfügungsrechten belegt wird (Apolinarski et al. 2004, Fürst 2006) und von unterschiedlichen Handlungslogiken geprägt ist. Dieser Ansatz bezieht sich auch auf die kollektiven Arbeitseinsätze auf Allmenden (Buchecker et al. 1999, Niederer 1996), wie sie wohl besonders prominent in den letzten Jahren durch die Nobelpreisträgerin Eleonore Ostrom diskutiert wurden (Ostrom 1999, 2000).
In Zusammenhang mit Landschaft sind die Freizeitnutzer eine gesellschaftliche Gruppe, die zwar von der Erhaltung dieses Kollektivguts profitiert, selbst aber bislang nur begrenzt direkten Einfluss auf dessen Erhaltung und Pflege nimmt. Wird diese Aufgabe nun aber wahrgenommen, so stellt sich die Frage, wo in den gesellschaftlichen Handlungslogiken diese eingeordnet werden kann. Als gesellschaftliche Handlungslogiken können prinzipiell drei Bereiche unterschieden werden: „Hierarchie“ (= idealtypisch dem staatlichen Sektor zuzuordnen), „Markt“ (= Wirtschaft) und „Solidarität“ (= Zivilgesellschaft) (Fürst 2006). Freizeitnutzer, die losgelöst von staatlichen Steuerungsmechanismen und marktwirtschaftlichen Anreizen agieren, sind demnach dem Bereich der ‚Solidarität‘ bzw. Zivilgesellschaft zuordenbar (vgl.Vogt 2005). Es ist demnach anzunehmen, dass Freizeitnutzer sich motivieren lassen, an der Landschaftspflege mitzuarbeiten, da sie die Landschaft als Teil ihres Lebensraums betrachten. Gleichzeitig dürfte diese Mitarbeit ihr Bewusstsein stärken, dass sie für die Entwicklung ihrer Landschaft mitverantwortlich sind. Inwieweit diese Annahmen zutreffen, soll die hier vorgestellte Untersuchung zeigen.
2 Methode
2.1 Transdisziplinarität als Forschungsparadigma
Für die wissenschaftliche Untersuchung war Transdisziplinarität das forschungsleitende Organisationsprinzip. Angeleitet durch das Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung wurde in Anlehnung an die Gestaltungsprinzipien von Pohl & Hirsch Hadorn (2006) folgendes transdisziplinäres Verständnis der Forschungsarbeit zu Grunde gelegt: Transdisziplinarität bedeutet, dass Akteure aus der Praxis über den gesamten Forschungsprozess hinweg in die wissenschaftliche Arbeit miteinbezogen werden und in die Projektphasen Problemidentifikation (I), Problembearbeitung (II) und In-Wert-Setzung (III) integriert werden. Dieser Ansatz wurde gewählt, weil es sich bei dem Thema um ein wissenschaftliches Interesse mit transdisziplinärem Charakter handelt, das sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis gleichermaßen von Relevanz ist.
2.2 Eine Fallstudie mit zwei Fällen
Die Untersuchung wurde in Anlehnung an Scholz & Tietje (2002) als integrierte Fallstudie mit zwei Fällen durchgeführt. Die Fallstudie hat dabei einen beschreibenden bzw. erklärenden Charakter, der sich von der Fragestellung nach den Motiven und Erfolgsfaktoren ableiten lässt. Es wurde ein Ansatz mit zwei Fällen gewählt, um diese miteinander zu vergleichen, aber auch um die Wirkung unterschiedlicher Organisationsformen zu untersuchen. Der Fallstudienansatz wurde in diesem Fall als umfassende Forschungs- und Erhebungsstrategie, die sich unterschiedlichster Techniken und Methoden bedient, verstanden (vgl. Yin 2003). Darin kombiniert wurden die qualitativen Erhebungsmethoden der teilnehmenden Beobachtung und des qualitativen Interviews mit einer quantitativen Fragebogenerhebung. Die teilnehmende Beobachtung wurde dabei als Erhebungsmethode während der Arbeitseinsätze eingesetzt. In der teilnehmenden Beobachtung wurde in den Arbeitseinsätzen die Rolle eines Freiwilligen eingenommen und in Form von mündlichen Protokollen während des Einsatzes und schriftlichen Protokollen nach dem Einsatz dokumentiert. Hauptziel dabei war es, die Sichtweisen und Empfindungen von Freiwilligen in einem Einsatz nachvollziehen zu können. Die Interviews wurden in beiden Fällen nicht nur mit Freiwilligen, sondern mit allen Beteiligten geführt, beispielsweise auch den Organisatoren der Initiativen. Diese wurden in Form von offenen, durch einen Leitfaden unterstützte Gespräche realisiert, um den Interviewten einerseits genügend Raum für ihre Erzählungen zu geben und andererseits eine Konsistenz über die Interviews hinweg zu gewährleisten. Die Aussagen der Freiwilligen wurden zusätzlich in Form einer Fragebogenerhebung, die aufbauend auf ersten Ergebnissen aus den Interviews konzipiert wurde, auf breiterer Basis untersucht.
2.3 Analyse
Aus den beiden Fällen wurden insgesamt 33 Interviews mit Beteiligten und zwei Beobachtungsprotokolle von Arbeitseinsätzen in die qualitative Analyse aufgenommen. Dabei orientierte sich diese Analyse an den Prinzipien einer qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2007). Nach der Transkription aller Interviews wurde die qualitative Analyse mit dem Computerprogramm Atlas.ti durchgeführt. In diesem Programm können einzelne Passagen der Aufzeichnung in Bezug auf ein Kategorienset codiert werden, um deren Inhalte dann weiter in Bezug auf die Fragestellung und damit verbundene Hypothesen zu analysieren. Im weiteren Verlauf wurden diese dann in Beziehung zueinander gesetzt, verworfen oder vertiefend untersucht.
Bei der Entwicklung des Kategoriensets wurde, wie in der qualitativen Forschungspraxis durchaus üblich, eine Kombination aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung angewandt (vgl. Gläser & Laudel 1999). Es wurde also mit bereits aus der Theorie und der Fragestellung abgeleiteten Kategorien bzw. Codierungen gearbeitet. Im Laufe der Analyse sind aber auch neue Kategorien dazugekommen und somit wurden gewisse Erkenntnismuster über die Interviews hinweg herausgearbeitet, die schließlich zu den qualitativen Ergebnissen geführt haben.
Diese qualitative Vorgehensweise wurde zusätzlich durch die quantitative Auswertung der Fragebögen, insgesamt 76, aus zwei Befragungen unterstützt. In den Fragebögen wurden vor allem die Einstellungen zu Aussagen aus den Interviews abgefragt. Die Analyse wurde dann mit Werkzeugen der deskriptiven Statistik durchgeführt.
Zusätzlich wurden Informationsmaterial, Dokumente, Bilder und Zeitungsartikel studiert, diese sind aber nicht in die strukturierte Analyse aufgenommen worden, sondern dienten zur Beschreibung der Fälle.
2.4 Die Fälle – Aktion Heugabel und Landschaftspflegeaktionen Region Hesselberg
Für die Fallstudie wurden, aufbauend auf vorangegangenen Forschungsarbeiten, die in Mühlmann (2009) nachvollzogen werden können, zwei Fälle ausgewählt: die Aktion Heugabel in Vorarlberg und die Landschaftspflegeaktionen in der Region Hesselberg/Mittelfranken. Diese beiden Fälle waren von besonderem Interesse, da beide Initiativen in einem lokalen Kontext (Gemeinde/Region) mit ortsansässigen Freiwilligen aktiv sind, dabei auf zwei unterschiedlichen Organisationsformen aufbauen, mit dem klaren Ziel der lokalen Landschaftserhaltung.
Die Aktion Heugabel wurde 1996 ins Leben gerufen. Der Grundgedanke bei der Gründung war, ein besseres Verständnis zwischen Naturschützern und Landwirten in der Vorarlberger Gemeinde Frastanz zu schaffen und gleichzeitig die Landschaft der Gemeinde zu schützen. In Zusammenhang mit Landschaft ist die Erhaltung der Magerheuwiesen von besonderem Interesse. In der Aktion Heugabel werden Landwirten freiwillige Helfer für die Arbeit vermittelt. Dabei wird die Hilfe vor allem bei der Magerheuernte in Anspruch genommen. Vereinzelt unterstützen die Freiwilligen die Landwirte auch bei anderen Arbeiten, wie beispielsweise dem Aufräumen und Einzäunen von Flächen. Wie die Arbeitseinsätze genau ausgestaltet werden, mit wie vielen Personen welche Arbeiten auf welchen Flächen erledigt werden, ist von Arbeitseinsatz zu Arbeitseinsatz unterschiedlich. Auch ob und wie die Freiwilligen von den Landwirten dafür entlohnt werden, liegt im eigenen Ermessen jedes Landwirts.
Die allgemein gültige Anerkennung der freiwilligen Arbeit durch die Aktion Heugabel sind Tombolalose, die für jeden halben Arbeitstag ausgestellt werden. Am Ende der Saison werden dann beim Heugabel-Abschlussfest Preise verlost. Die Aktion Heugabel hat keine formale Organisationsform, ist also beispielsweise kein eingetragener Verein oder eine Stiftung. Der Gründer und Organisator der Aktion, Günter Stadler, hat darauf bewusst verzichtet, da der formale Aufwand für ihn zu groß erschien und er die Arbeitsleistung lieber direkt in die Organisation der Aktion fließen lassen wollte. Die Aktion hat bereits Nachahmer gefunden und wird schon in einer Gemeinde in Liechtenstein umgesetzt.
Die Landschaftspflegeaktionen Region Hesselberg wurden 1997 vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken und dem für dieses Gebiet verantwortlichen Landschaftspfleger Norbert Metz in Kooperation mit den betroffenen Gemeinden initiiert. Landschaftspflegeverbände sind freiwillige Zusammenschlüsse der für Landschaft relevanten Akteure in einer Region, wobei der partizipative Gedanke und die Vermittlung unterschiedlicher Interessen zum Wohle der Landschaft darin eine besonders wichtige Rolle spielen (vgl. Metzner 2013, in diesem Heft). Der Landschaftspflegeverband Mittelfranken steht dabei stellvertretend für eine Reihe von LPVs deutschlandweit, hat sich in seiner Arbeit besonders auf die Integration von Freiwilligen in die Landschaftspflege spezialisiert.
Das Hauptziel dieser Pflegeaktionen ist die Offenhaltung der Landschaft am Hesselberg. Der Hesselberg ist die höchste Erhebung Mittelfrankens und für die Gegend ein prägendes Landschaftselement. Er ist Aktionsraum für verschiedene Vereine, die auch immer wieder bei Aktionen mithelfen, wie z.B. der Deutsche Alpenverein. Die Landschaftspflegeaktionen finden jeweils an einem Halbtag statt, meist am Vormittag von Samstagen. Dabei gilt es, möglichst viele Bürger zu mobilisieren, die ihre Zeit und Arbeitskraft der Aktion zur Verfügung stellen.
Welche Arbeiten anstehen, wird vorab von den Experten des Landschaftspflegeverbandes gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort bestimmt. Die Arbeitseinsätze finden dann, abhängig von der Gesamtgruppengröße, aufgeteilt in Arbeitstrupps von ca. 10 bis 15 Personen statt. Für die Arbeitstrupps gibt es je eine hauptverantwortliche Person, die mit speziellem Werkzeug, wie beispielsweise der Motorsäge, umgehen kann. Die Arbeitseinsätze starten jeweils um 9.00 Uhr und enden gegen 13.00 Uhr. Danach gibt es ein gemeinsames Essen. Mittlerweile werden die Landschaftspflegeaktionen nicht mehr nur am Hesselberg durchgeführt, sondern auch in anderen Orten in der Region.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die beiden Fälle von ihrer geographischen Lage und den topographischen Gegebenheiten unterscheiden. Die Aktion Heugabel in Frastanz/Vorarlberg liegt in den Alpen, die Landschaft ist geprägt von einer hügeligen Topographie und der Lage am Hang. Die besonders schützenswerten Magerheuwiesen liegen über das ganze Gemeindegebiet verteilt und sind im Landschaftsbild nicht auffällig. In der Region Hesselberg hingegen ist eben dieser Berg mit einer Höhe von 689m das landschaftsprägende Element. Aus der ihn umgebenden flacheren Agrarlandschaft kann er von vielen Stellen aus wahrgenommen werden. In beiden Fällen werden die Initiativen durch zwei Organisatoren federführend geleitet und die Landschaftspflegeeinsätze mit Freiwilligen aus dem jeweiligen Ort durchgeführt, wobei in Frastanz die Arbeit eher auf die Unterstützung des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes bei der Heuernte ausgerichtet ist und in der Region Hesselberg die kollektive Arbeit an der Offenhaltung des Berges im Vordergrund steht.
3 Ergebnisse
3.1 Motivation der Freiwilligen: Ich, die Landschaft und das Wir
Nach Max Weber ist der Begriff des Motivs als Sinnzusammenhang, welcher dem Handelnden selbst oder dem Beobachtenden als sinnvoller Grund eines Verhaltens erscheint (Weber 1984: 28) zu verstehen. Motivationen hingegen sind Bündel an Motiven, die situationsabhängig zu konkreten Handlungen führen, bereits Teil dieser individuellen Handlung sind oder am Beginn dieser stehen (vgl. Spitzl 2001).
In der Untersuchung konnten aus den Interviews verschiedene Motive für die Freiwilligenarbeit herausgearbeitet werden. Dabei wurde festgestellt, dass es wohl auch in diesem Fall die Kombinationen verschiedener Motive sind, also Motivationen, welche die Freiwilligen antreiben.
Auf Grund der Intensität der Erzählungen konnte aber in Interviews immer wieder festgestellt werden, dass es wohl Hauptmotive gibt, die dabei besonders im Vordergrund stehen. Prinzipiell ist es aber eine Wechselbeziehung aus unterschiedlichen Motiven, welche die Beteiligung der Freiwilligen antreiben. Das nachfolgende Zitat eines Freiwilligen zeigt das ganz deutlich:
„Das alles zusammen ist toll. Miteinander gearbeitet, man hat gesehen, dass man was geschafft hat. Ich denk, das ist was ganz Besonderes, die Leute sehen heute ja oft nicht mehr, was sie in ihrer Arbeit schaffen, und da sieht man das Ergebnis … Es gibt wieder freie Blicke, neue Ausblicke, die Landschaft ist wieder schön. Das gemeinsame Schaffen, das Lob und gute Gefühl danach. Das gemeinsame Essen danach und dass alle möglichen Menschen da sind, die man sonst auch nicht unbedingt trifft … und jeder ist stolz, er war am Tag für’n Berg dabei.“
Durch dieses Zitat, das beispielhaft für viele ähnliche Aussagen steht, lässt sich bereits ein erster Eindruck über die Motivation zur Beteiligung gewinnen. Die Motive bzw. Motivationen lassen sich dabei in landschaftsbezogene, ich- bzw. erlebnisbezogene und soziale Motivationen einteilen.
Ich- bzw. erlebnisbezogene Motivation
Die Landschaftspflegeeinsätze sind in beiden Fällen für die Freiwilligen ein motivierendes Erlebnis. Ein Erlebnis ist etwas, das sich vom Alltag abhebt und vom Erlebenden als „besonders“ empfunden wird (vgl. Jahn 2003 in Matz 2008). Das Erlebnis berührt, ergreift und beschäftigt dabei die Erlebenden. Die Landschaftspflegeeinsätze sind für die Freiwilligen solch ein Erlebnis. Sie machen dabei Arbeiten, die in der Regel nicht alltäglich sind, werden in Gemeinschaft mit anderen körperlich gefordert und nehmen einen starken persönlichen Eindruck von den Einsätzen mit. In den Interviews wurden die Arbeitseinsätze zumeist sehr lebendig und ausführlich beschrieben.
„… und es ist einfach schön und erfüllend, am Abend auf das Geschaffte zurückzublicken und das Ergebnis direkt zu sehen, was man alles gemeinsam erreichen kann. Man ist müde, aber gleichzeitig unglaublich zufrieden. Es sind besondere Tage im Jahr und es macht einfach großen Spaß.“
Die Freiwilligen haben Vergnügen an der Arbeit und nach dem Einsatz das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben. Dieses Gefühl, die erbrachte Leistung nach der Arbeit direkt zu sehen, wurde von den Freiwilligen immer wieder angesprochen. Auch in der Fragebogenerhebung konnte dieses Ergebnis bestätigt werden. So stimmten 80 % der Freiwilligen in der Aktion Heugabel und über 90 % der Freiwilligen in der Region Hesselberg der Aussage zu, dass es ein gutes Gefühl ist, nach dem Einsatz die geschaffte Arbeit zu sehen. Auf die Aussage nach der sportlichen Herausforderung im Arbeitseinsatz haben 11 % der Freiwilligen in der Region Hesselberg und 27 % der Aktion Heugabel angegeben, dass sie die Einsätze als sportliche Herausforderung verstehen. Die Aussage, dass der Einsatz Körper und Geist gleichermaßen gut tut, wurde am Hesselberg von 44 % der Befragten als sehr zutreffend bewertet, in der Aktion Heugabel waren es sogar 52 %. Ihr starkes individuelles Erleben von besonderen physischen und psychischen Eindrücken hebt sich ab vom Alltag. Besonders die körperlich harte Arbeit sowie die intensive Erfahrung in Form von manueller Tätigkeit verstärken bei vielen diese bewusste Erfahrung. Interessant ist, dass sich durch dieses Erlebnis für einige auch eine andere Sichtweise auf Landschaft erschließt, nämlich, dass Landschaft als Teil des Lebensraums nicht einfach da ist, sondern dass es sich dabei um etwas Dynamisches handelt, das in direktem Zusammenhang mit der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Menschen entsteht.
soziale Motivation
Als wichtiges Motiv erwies sich auch der soziale Austausch. Hier zeigten sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Fällen. In der Aktion Heugabel ist es vor allem die Beziehung zwischen Landwirten und Freiwilligen, die im Vordergrund steht. Die Arbeit wird unter anderem als Nachbarschaftshilfe verstanden bzw. als Unterstützung der Landwirtschaft am eigenen Wohnort.
„Wir wohnen gleich neben dem Hof und haben gesehen, wie viel Arbeit gerade bei der Heuernte anfällt, und da wollten wir helfen.“
Die Freiwilligen arbeiten meist am selben Betrieb mit und über die Jahre sind freundschaftliche Beziehungen entstanden. So antworteten 56 % der Freiwilligen der Aktion Heugabel, dass sie eine freundschaftliche Beziehung zu den Landwirten verbindet, und für 59 % ist es Nachbarschaftshilfe. Gemeinsam mit anderen Bürgern zu arbeiten, ist nur für 7 % wichtig. Die Gemeinschaftlichkeit durch die Aktion Heugabel wird aber dennoch geschätzt, da sie mehr ist als die individuelle Hilfestellung für den Landwirt. Die Aktion wertschätzt die Arbeit der Freiwilligen und setzt sie zueinander in Beziehung.
In den Landschaftspflegeaktionen Region Hesselberg ist das gemeinsame Tun mit anderen Gemeindebürgern zentral. An den Aktionstagen kommen unterschiedliche Menschen zusammen, sowohl junge als auch ältere Freiwillige mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen.
„[…] und das ist ein richtig schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ergibt sich alles von selbst. Es gibt keine großen Rädelsführer und jeder beginnt einfach, ohne lange nachzufragen. Der Zusammenhalt ist einmalig […]“
Auf die Aussage, ob das gemeinsame Arbeiten mit anderen Bürgern ein Hauptgrund für die Teilnahme an den Landschaftspflegeaktionen ist, haben 20 % der Freiwilligen angegeben, dass dieses sehr für sie zutrifft, und 47 % haben angegeben, dass dieses eher für sie zutrifft.
Egal, wie sich die Beziehung zwischen den Beteiligten genau ausgestaltet, es zeigt sich in beiden Fällen, dass Landschaft nicht nur als Schutzobjekt verstanden wird, sondern dass Landschaft die Arena ist, in der sich soziale Beziehungen bilden und verstärken. Die Arbeitseinsätze sind dabei das verbindende Element. Die Landschaft wirkt über die Arbeitseinsätze sozio-emotional identitätsstiftend. Die Menschen fühlen sich als Teil einer Gemeinschaft, die auf Grund der gemeinsamen Arbeit entsteht. Sie fühlen sich zusammengehörig und zu einem gewissen Ort verbunden.
Landschaftsbezug als Motivation
Als weiterer motivierender Faktor für die Teilnahme an den Landschaftspflegeaktionen erwies sich, dass die Freiwilligen die Landschaft als Teil ihres Lebens- und Erholungsraums schätzen, sich mit ihr verbunden fühlen und diese deshalb erhalten möchten. Das zeigte sich in beiden Aktionen, obwohl sich hinsichtlich der landschaftlichen Qualität (z.B. Heuwiesen in alpiner Lage, Solitärerhebung in ebener Agrarlandschaft) deutlich unterscheiden. Doch die Freiwilligen assoziieren Landschaft und ihre Bedeutung mit ihren Aktivitäten, mit Emotionen und Werten. Die Freiwilligen haben in den Interviews nicht immer explizit von Landschaft gesprochen, sondern zugleich andere Begriffe wie Natur, Wiese, Berg oder Umgebung verwendet.
„Ich sehe die Wiesen jeden Tag und im Sommer blühen sie so herrlich und das [ihre Erhaltung] war mir ein Anliegen.“
„Es ist schön, in so einer Landschaft zu spazieren. Die Landschaft hier ist etwas ganz Besonderes […] Beim Spazieren bekomme ich wieder Kraft und entspanne mich.“
„Ich sehe den Berg von meinem Küchenfenster aus, jeden Tag, seit ich ein Kind bin, und erfreue mich an ihm.“
Landschaft wird wahrgenommen im Alltag, aber auch in Form von Erinnerungen/Erzählungen. In den Interviews werden Alltagserlebnisse beschrieben, oft in Verbindung mit aktiver Freizeitgestaltung, wie sportlichen Aktivitäten oder Entspannung. Immer wieder wird auch darauf referenziert, wie die Landschaft früher ausgesehen hat, welche Erlebnisse damit verbunden werden und wie sich diese heute verändert hat. Der Bezug zur Landschaft als Motiv konnte auch in der Fragenbogenerhebung nachvollzogen werden. So haben über 80 % der Freiwilligen in der Aktion Heugabel und knapp 60 % der Freiwilligen in der Region Hesselberg angegeben, dass es für sie sehr zutrifft, dass sie mit ihrem Einsatz zur Erhaltung und Pflege der Landschaft beitragen wollen. Erwähnenswert ist, dass keiner der Befragten grundsätzlich diese Aussage verworfen hat.
Verantwortung für Landschaft – eine besondere Motivation
Als weiteres relevantes Motiv zeigte sich die Mitverantwortung für die Landschaft, wobei diese sich gleichzeitig als Motiv sowie auch als Wirkung erwies. Die Arbeit als Freiwilliger kann durch ein Mitverantwortungsgefühl für die Erhaltung motiviert sein, gleichzeitig können die Einsätze auch verantwortungsstiftend sein. Es scheint sich also um einen selbstverstärkenden Faktor zu handeln. Sieht man sich die beiden Fälle etwas genauer an, wird das Verantwortungsgefühl unterschiedlich wahrgenommen. In den Interviews in der Region Hesselberg verspürten die Freiwilligen eine stärkere gemeinschaftliche Verantwortung für den Berg. In der Aktion Heugabel hingegen standen eher die Verantwortung und Unterstützung gegenüber den Landwirten im Mittelpunkt. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Fragebogenerhebung wider (siehe Abb. 5). Dabei lässt sich in den Aussagen sowohl über das Verantwortungsgefühl für die Landschaft ganz allgemein als auch über die Verantwortung für die Flächen, auf denen die Freiwilligen gearbeitet haben, eine ähnliche Tendenz erkennen, nämlich dass das Verantwortungsgefühl in den Landschaftspflegeaktionen Region Hesselberg höher ist.
Um dieses Ergebnis zu verstehen, wurden nochmals relevante Passagen der qualitativen Interviews analysiert. Dieses lieferte Hinweise darauf, dass diese Ergebnisse in Zusammenhang mit dem Wissen und Bewusstsein über die Besitzverhältnisse in der Landschaft stehen könnten. So wurde in den Interviews in der Region Hesselberg stärker über den gesamten Berg als Teil der Gemeinde gesprochen, als Ort, der zur Freizeit- und Erholungsnutzung für alle Bürger zur Verfügung steht. Wem am Berg welche Flächen gehören, ist dabei nicht bekannt bzw. bewusst. In der Aktion Heugabel haben die Freiwilligen den Arbeitseinsatz stärker mit dem jeweiligen Landwirt als Besitzer der Flächen erlebt, so dass ihnen auch die Besitzverhältnisse in der Landschaft deutlicher bewusst sind.
Zusätzlich zur Einschätzung des individuellen Verantwortungsgefühls für Landschaft wurde auch nach einer Einschätzung über die Verantwortung anderer lokaler Gruppen gefragt (Abb. 6).
Hier lässt sich das unterschiedliche Verständnis über die Verantwortung für Landschaft in den beiden Fallstudien aufzeigen. Prinzipiell ist es interessant, dass es mit ca. 60 % am Hesselberg und knapp 40 % in der Aktion Heugabel ein hohes gemeinschaftliches Verantwortungsgefühl gibt, dass jeder, der die Landschaft nutzt, einen Beitrag zur Erhaltung dieser leisten soll. Diese Aussage wurde von keinem Befragten als „nicht zutreffend“ beurteilt. Auffällig ist, dass in der Aktion Heugabel den Landwirten eine stärkere Verantwortung für die Landschaft zugeschrieben wird als in der Region Hesselberg. Nur 4 % in der Region Hesselberg erachten es als sehr zutreffend, dass die Landwirtschaft die Landschaft pflegen soll. Hingegen stimmen 21 % der Befragten in der Aktion Heugabel dieser Aussage sehr zu. Nimmt man noch die 39 % dazu, die dieser Aussage eher zustimmen, kommt man über die Hälfte aller Befragten, die dieser Aussage positiv gegenüber stehen. Die Rolle der Gemeinde wird dabei ähnlich wahrgenommen, wobei am Hesselberg die Gemeinde im Verhältnis zu den Landwirten als wichtiger eingestuft wird. Zusammenfassend lässt sich wohl feststellen, dass sich die Freiwilligen als am stärksten verantwortliche Gruppe fühlen.
4 Ausblick
4.1 Erfolgsfaktoren für die Beteiligung von Bürgern an der Landschaftspflege
Motivierte Freiwillige sind wohl ein entscheidender Faktor zum Erfolg einer Initiative; deren Motive gut zu kennen, ist von Vorteil. Allerdings stehen diese Freiwilligen in Wechselbeziehung mit den Rahmenbedingungen, die ihnen die Möglichkeit geben, aktiv zu werden. In beiden Fällen konnten zwei spezielle Rahmenbedingungen vorgefunden werden, die zum Erfolg der beiden Initiativen beitragen. Einerseits werden die Einsätze von Menschen organisiert, die als Motor der Initiative verstanden werden können, und andererseits wird die Initiative durch Schlüsselpersonen in der Gemeinde/Region unterstützt. Die Organisatoren sind von der Idee der Landschaftserhaltung durch freiwillige Arbeitseinsätze überzeugt und geben das auch so weiter. Dabei ist ihnen nicht nur die Landschaftserhaltung an sich wichtig, sondern auch die Bewusstseinsbildung für Natur- und Landschaftsschutz unter den Freiwilligen. Sie sind bei den Einsätzen dabei und beteiligen sich aktiv. Das macht sie glaubwürdig und die Freiwilligen vertrauen Ihnen. Die Wertschätzung der Freiwilligenarbeit durch Schlüsselpersonen ist auch wichtig. Die Organisatoren wirken als Vorbilder für die Freiwilligen. Die Kombination aus diesen Gegebenheiten, aus den organisationsinternen Verantwortlichen, die als Motor der Initiative wirken und dem positiv gestimmten lokalen Umfeld, schafft funktionierende Rahmenbedingungen.
4.2 Einschätzung der Übertragbarkeit der beiden Fälle
Die beiden gewählten Fälle zeigen zwei Beispiele auf, die auf unterschiedliche Organisationsformen aufbauen. Die eine ist stark an der Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft und den damit zusammenhängenden landschaftlichen Besonderheiten interessiert, die andere basiert auf gemeinschaftlichen Arbeitseinsätzen von Bürgern zur Erhaltung des landschaftsprägenden Hausberges. Trotz dieser unterschiedlichen Ausgangsbasis lassen sich gemeinsame Schlüsse ziehen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass, obwohl die Landschaftspflegeeinsätze in der gewohnten Umgebung der Freiwilligen, also in ihrer Alltagslandschaft, stattfinden, die Arbeit als ein ganz besonderes Erlebnis empfunden wird. Aber auch der Wunsch nach Erhaltung der Landschaft und der soziale Austausch erwiesen sich als wichtige Motive. Zudem fanden sich deutliche Hinweise darauf, dass die Freiwilligenarbeit teilweise auch das Bewusstsein und das Verantwortungsgefühl für die Landschaft verändert. In den Pflegeeinsätzen ist die Landschaft dabei sowohl Erlebnisraum, Identifikationsraum, Begegnungsraum, aber auch verbindendes Element für neue oder intensiver werdende soziale Beziehungen. Es konnte somit aufgezeigt werden, dass diese Modelle nicht nur eine Möglichkeit zur Landschaftserhaltung darstellen, sondern zugleich auch positive Effekte auf die sozialen Beziehungen und die Beziehung zur Landschaft in den Gemeinden haben können.
Überlegt man nun abschließend, welche der beiden Fallstudienmodelle leichter auf andere Regionen und Gemeinden übertragbar ist, wird klar, dass dieses stark vom Kontext abhängig ist. Das heißt, dass für eine mögliche Übernahme eines Modells die Voraussetzungen genau analysiert werden müssen. Vor welchen Herausforderungen steht die zukünftige Landschaftserhaltung in der jeweiligen Region/Gemeinde? Wie wird das Potenzial an Freiwilligen eingeschätzt? Auf welche Weise können diese einfach und ohne viel Risiko in die Erhaltungsmaßnahmen eingebunden werden? Wie gestaltet sich die Landschaftserhaltung?
Ist es vor allem die Landwirtschaft als landschaftsprägender Faktor, bei der noch viel Arbeit „per Hand“ verrichtet werden muss, so ist eine Vermittlung von Freiwilligen denkbar, wie es in der Aktion Heugabel geleistet wird. Allerdings braucht es, damit sich der Aufwand der Organisation auch lohnt, genügend Landwirte, die bereit sind, mit Freiwilligen zu arbeiten. Wird die Landschaft als Gemeingut erlebt, das durch die Bürger genutzt wird, ist das Format der Landschaftspflegeaktionen Region Hesselberg interessant. Es braucht keine speziellen landschaftlichen Voraussetzungen, sondern vor allem motivierte Gemeindebürger und Organisatoren. Das Format der Landschaftspflegeeinsätze Region Hesselberg ist entsprechend auf viele Gemeinden/Regionen mit ganz unterschiedlichen Landschaften anwendbar und daher möglicherweise leichter übertragbar. Diese Form der Partizipation bietet also ein vielversprechendes Instrument, um die Beziehung der Bevölkerung zu ihrer Alltagslandschaft zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung der Landschaft zu ermöglichen.
Dank
Das Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung (dokNE) wurde finanziert durch die Universität für Bodenkultur (BOKU), das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Forschungsprogramm proVISION), das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die Länder Niederösterreich und Steiermark sowie die Stadt Wien. Vielen Dank dafür.
Literatur
Amann, G., Burtscher, M., Rausch, G. (2006): Landschaftsentwicklung Frastanz. Biotoppflege Stutzberg, Frastanz.
Apolinarski, I., Gailing, L., Röhring, A. (2004): Institutionelle Aspekte und Pfadabhängigkeiten des regionalen Gemeinschaftsgutes Kulturlandschaft. Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner.
Bosshart, D., Frick, K. (2006): Die Zukunft des Ferienreisens – Trendstudie. Gottlieb-Duttweiler-Institut im Auftrag von Kuoni, Rüschlikon.
Buchecker, M., Hunziker, M., Kienast, F. (1999): Mit neuen Möglichkeiten der partizipativen Landschaftsentwicklung zur Aktualisierung des Allmendgedankens. Forum für Wissen 1, Biosphärenpark Ballungsraum, 13-19.
–, Hunziker, M., Kienast, F. (2003): Participatory landscape development: overcoming social barriers to public involvement. Landscape and Urban Planning 64 (1-2), 29-46.
Degenhardt, B., Buchecker, M. (2012): Everyday self-regulation in nearby nature. Leisure Sciences 34, 450-469.
Enengel, B. (2009): Partizipative Landschaftssteuerung – Kosten-Nutzen-Risiken-Relationen aus Sicht der Beteiligten. Diss., Kolleg Nachh. Entwicklung, BOKU Wien.
Feindt, P.H., Newig, J. (Hrsg., 2005) Partizipation, Öffentlichkeitsbeteiligung, Nachhaltigkeit. Perspektiven der politischen Ökonomie. Ökologie und Wirtschaftsforschung 62, Metropolis, Marburg.
Fürst, D. (2006): Institutionelle Aspekte und Pfadabhängigkeiten des regionalen Gemeinschaftsgutes Kulturlandschaft. Hannover.
Gailing, L., Kaim, K.-D. (2006): Analyse von informellen und dezentralen Institutionen und Public Governance mit kulturlandschaftlichem Hintergrund in der Beispielregion Barim. Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin.
Gläser, J., Laudel, G. (1999): Theoriegeleitete Textanalyse? Das Potential einer variablenorientierten qualitativen Inhaltsanalyse. Veröffentlichungsreihe der Arbeitsgruppe Wissenschaftstransformation des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Vol. 99-401.
Höppner, C., Frick, J., Buchecker, M. (2007): Assessing psycho-social effects of participatory landscape planning. Landscape and Urban Planning 83 (2/3), 196-207.
Hodge, I. (2007): The Governance of Rural Land in a Liberalised World. Journal of Agricultural Economics 58 (3), 409-432.
Hunziker, M. (1995): The spontaneous reafforestation in abandoned agricultural lands: Perception and aesthetic assessment by locals and tourists. Landscape and Urban Planning 31, 399-410.
– (2000): Einstellung der Bevölkerung zu möglichen Landschaftsentwicklung in den Alpen. Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf.
Hirnschall, F. (2009): Landschaft – Wahrnehmung und Bereitschaft zum Engagement. Unveröff. Dipl.-Arb., BOKU-Universität Wien.
Luz F. (1993): Zur Akzeptanz landschaftsplanerischer Projekte. Europäische Hochschulschriften, Peter Lang, Kiel.
Jahn, T. (2003): Soziale Ökologie, kognitive Integration und Transdisziplinarität. Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 14 (2), 32-38.
Matz, S. (2008): Landwirtschaft erleben. Zur Vermittlung agrarischer Umweltbildungsinhalte. oekom, München.
Mayring, P. (2007): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 9. ed. Beltz, UTB, Weinheim [u.a.].
Metzner, J. (2013): Landschaftspflegeverbände – Markenzeichen des kooperativen Naturschutzes in Deutschland. Strukturen, Arbeitsweise und Potenzial. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11).
Mühlmann P. (2009): Zivilgesellschaftliches Engagement – das Modell freiwilliger Arbeit in der Landschaftspflege, Diss., Kolleg Nachh. Entwicklung, BOKU Wien.
Niederer, A., (1996): Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung und Wandel: Ausgewählte Arbeiten aus den Jahren 1956 bis 1991. Berne, Haupt.
Ostrom, E. (1999): Die Verfassung der Allmende. Mohr Siebeck, Tübingen.
– (2000): Collective Action and the Evolution of Social Norms. Journal of Economic Perspectives 14 (3), 137-158.
Pohl, C., Hirsch Hadorn, G. (2006): Gestaltungsprinzipien transdisziplinärer Forschung, Oekom, München.
Scholz, R.W., Tietje, O. (2002): Embedded case study methods: Integrating quantitative and qualitative knowledge. Sage Publ., Thousand Oaks, London, New Delhi.
Spitzl, W.M. (2001): Motive für ehrenamtliche Mitarbeit beim Wiener Roten Kreuz. Unveröff. Dipl.-Arb., Universität Wien.
Vogt, L. (2005): Das Kapital der Bürger. Campus, Frankfurt am Main.
Weber, M. (1984): Soziologische Grundbegriffe. UTB, Tübingen, 6. Aufl.
Yin, R.K. (2003): Application of Case Study Research. Sage Publ., Newbury Park, London, New Delhi.
Anschrift der Verfasser(in): Dr. Pamela Mühlmann, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Leopoldring 3, D-79098 Freiburg, sowie dokNE – Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung, Universität für Bodenkultur, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Peter-Jordan-Strasse 82, A-1190 Wien, E-Mail pamela.muehlmann@iclei.org; Dr. Matthias Buchecker, Gruppe Sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung, Einheit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL, CH-8903 Birmensdorf, E-Mail matthias.buchecker@wsl.ch.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen





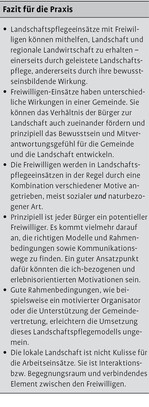
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.