Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie in Großschutzgebieten
Abstracts
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) spielt heute im Zusammenhang mit Web-2.0-Werkzeugen und mobilen Endgeräten in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Grundsätzlich eröffnet ihre Nutzung großes Potenzial: Nutzer können besser und umfassender informiert werden, es kann mit ihnen interaktiv in Austausch getreten werden und sie können (leichter) in Entscheidungsprozesse involviert werden. Diese Aspekte sind auch für Großschutzgebiete bedeutsam, da Informations- und Kommunikationsarbeit im Rahmen von Zielsetzungen wie Bilden und Erholen einen zentralen Stellenwert einnimmt. Doch wie ist der momentane Stand der Nutzung von modernen IKT in Großschutzgebieten? Wie wird das bestehende Potenzial genutzt? Welche Empfehlungen können weitergehend für den Einsatz moderner IKT durch Großschutzgebiete ausgesprochen werden? Diesen Fragen wird am Beispiel von Großschutzgebieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) nachgegangen.
Modern Information and Communication Technology in Large Protection Areas – Use and significance in the ’DACH’-region
Modern information and communication technology (ICT) has gained an important role in the context of Web 2.0 tools and mobile terminals in all areas of life. Generally their utilisation offers a large potential: users can receive better and more comprehensive information, the tools allow interactive processes and users can be better involved into decision-making processes. These aspects are also important for large protection areas since information and communication processes play a decisive role in the context of targets such as education and recreation. What is the current state of ICT use in large protection areas? How has the existing potential been used? Which recommendations can be given for the application of modern ICT in large protection areas? The study investigates these questions using the example of Germany, Austria and Switzerland (DACH).
- Veröffentlicht am

1 Hintergrund und Fragestellung
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) durchdringt heute alle Lebensbereiche. Für private Zwecke sowie in Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Verwaltungen findet sie breite Verwendung (URL 1) und beeinflusst auf vielfältige Weise unseren Alltag (Schnorr-Bäcker 2004, WORK 2010). Moderne IKT bezieht sich dabei auf die sogenannten neuen Medien, d.h. netzbasierte Technologien und vor allem das Internet (OECD 2003, Schnorr-Bäcker 2004). Moderne IKT steht insbesondere mit Web 2.0 in engem Zusammenhang. Dieses beinhaltet als Oberbegriff eine Reihe von Applikationen, die den interaktiven Austausch sowie die Kooperation zwischen verschiedenen Nutzern über das Netz gestatten (ZEW 2010). Ihre Verwendung beruht mittlerweile oft auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets, deren Verbreitung in der Bevölkerung in den letzten Jahren stark gestiegen ist (TNS Infratest 2012, URL 2).
Wie in der Literatur vielfach herausgestellt (vgl. u.a. Meckel 2008, Schnorr-Bäcker 2004), verändern sich durch moderne IKT die zwischenmenschlichen Informations- und Kommunikationsstrukturen: Sie unterstützen z.B. eine zeitnahe und umfassende Informationsbereitstellung. Durch digitale Medien können deutlich mehr Inhalte (Verlinkungen, Multimedia etc.) angeboten werden als dies durch traditionelle Printmedien erfolgen kann. Dabei erwarten Nutzer heute einerseits schnellen Zugang zu verschiedenen, adäquat aufbereiteten Informationen. Andererseits haben sich Nutzer in den letzten Jahren von passiven Informations-Konsumenten hin zu aktiven Informations-Produzenten entwickelt, die eigene Ansichten, Erfahrungen und Bewertungen (sog. user generated content) einbringen wollen (Lange 2007). Damit eröffnen sich neue Chancen für Diskussionen, Bewertungsverfahren, Kontaktaufnahme und -pflege sowie community building und dadurch für Partizipation und Kollaboration.
Das Potenzial, das sich durch moderne IKT erschließt, ist auch für Großschutzgebiete (Naturparke, Nationalparke und Biosphärenreservate) bedeutsam. Dieses bezieht sich speziell auf die vielfältigen Informations- und Kommunikationsaufgaben, die im Kontext der zentralen Zielsetzungen Bilden und Erholen stehen. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Hinblick auf Erholungsaktivitäten bzw. Tourismus, Umweltbildung, Besucherinformation und Öffentlichkeitsarbeit lassen sich erkennen. Überdies belegen Untersuchungen eine ständige Zunahme der Internetnutzung und wachsende Nachfrage nach digitalen Auskünften auf Seiten von Schutzgebietsbesuchern (vgl. u.a. Eberle 2009, Hennig & Riedl 2012).
Doch wie gestaltet sich gegenwärtig die Nutzung von moderner IKT in Großschutzgebieten? Wie werden verschiedene Aspekte des Web 2.0 eingesetzt? Welche Rolle spielen mobile Endgeräte bzgl. Apps, eGuides oder Geocaching? Wie wird das Potenzial moderner IKT hinsichtlich der Zielsetzungen von Großschutzgebieten genutzt? Welche Empfehlungen können für diese Gebiete ausgesprochen werden? Diesen Fragen wird im Folgenden am Beispiel von Gebrauch und Bedeutung moderner IKT in Großschutzgebieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) nachgegangen.
2 Methodenbeschreibung
Ein Einblick in die Nutzung moderner IKT in Großschutzgebieten in der DACH-Region wurde durch eine Befragung dieser Einrichtungen im ersten Halbjahr 2012 gewonnen. Mittels SurveyMonkey ( http://www.surveymonkey.com ), einem kostenlosen Tool für Online-Umfragen, wurde ein kompakter Fragebogen erstellt und versendet. Er fokussierte zwei Teilbereiche:
(1) Nutzung moderner IKT durch Großschutzgebiete hinsichtlich ausgewählter Komponenten (vgl. Kasten 1):
a. Multimedia (Fotos, Videos, auditive Elemente, virtuelle Besichtigungstouren),
b. Geomedien (statische und dynamische Internetkarten, Web-GIS, Routenplaner),
c. Social Web Komponenten (Blogs/Foren, Newsletter, Social Media Plattformen),
d. mobile Endgeräte bzgl. Apps, eGuides oder Geocaching;
(2) Bewertung der Relevanz moderner IKT hinsichtlich:
a. verschiedener Zielsetzungen von Großschutzgebieten,
b. Aufnahme und Pflege von Kontakten zu am Schutzgebiet Interessierten.
Die erhobenen Daten wurden aufbereitet und statistisch ausgewertet (SPSS). Basierend auf den Befragungsergebnissen wurden dann die Internetauftritte einzelner Großschutzgebiete konkret bzgl. der Präsenz moderner IKT und Web-2.0-Anwendungen gesichtet. Aspekte wie Inhalt, Struktur bzw. Organisation und Verfügbarkeit von Web-2.0-Komponenten standen dabei im Mittelpunkt. Diese Gegenüberstellung der Befragungsdaten und der Analyse der Internetauftritte gestattete es, quantitative und qualitative Gesichtspunkte zur Nutzung moderner IKT gleichsam zu betrachten.
Zu betonen ist, dass moderne IKT momentan einer sehr dynamischen Entwicklung unterliegt. Bereits im Laufe dieser Untersuchung wurde beobachtet, dass die Schutzgebiete neue Anwendungen und Inhalte bereitstellten und bestehende veränderten oder entfernten. Ein Anliegen dieses Beitrags ist es daher (basierend auf einer detaillierten Momentaufnahme), grundsätzlich ein Bewusstsein bezüglich moderner IKT und sich damit erschließender Chancen zu wecken bzw. zu verbessern.
3 Überblick zur Nutzung moderner IKT in Großschutzgebieten
3.1 Grundlagen
Von den insgesamt 138 angeschriebenen Großschutzgebieten haben 62 (45 %) an der Befragung teilgenommen. Vor allem bei Nationalparks lag die Rücklaufquote hoch (80 %), während diese bei Biosphärenreservaten geringer (67 %) und bei Naturparks deutlich geringer (32 %) war. Grundsätzlich zeigt die Befragung, dass moderne IKT durch Großschutzgebiete vielfältig eingesetzt wird (vgl. Abb. 1, Tab. 1). Speziell Fotos und statische Karten sind weit verbreitet. Klares Interesse besteht an Apps und eGuides, dynamischen Karten, auditiven Elementen sowie virtuellen Besichtigungstouren. Das Verhältnis zu Social-Web-Komponenten ist als eher zwiegespalten zu beschreiben: Die einen sehen Potenzial im Gebrauch dieser Tools, die anderen bewerten sie als unerheblich für ihre Zwecke. Der konkrete Einsatz von Multimedia, Geomedien, Social-Web-Komponenten und der Bezug zu mobilen Endgeräten wird im Folgenden detaillierter vorgestellt.
3.2 Multimedia
Ein Großteil der befragten Schutzgebiete setzt Multimedia-Elemente in ihrem Webauftritt ein. Nutzungsumfang und -art variieren: Fotos, eigens in Bildergalerien oder Diashows organisiert, finden sich in den Internetpräsenzen fast aller Schutzgebiete (79 %). Es wird außerdem auf externe Lösungen wie Flickr zurückgegriffen.
Wesentlich weniger vertreten sind Videos bzw. Video-Podcasts. Nur in etwas mehr als einem Drittel der Weblösungen stehen diese Multimedia-Elemente zur Verfügung. Technisch wird dieses durch eingebettete (Film-)Objekte oder Verlinkungen zu Youtube umgesetzt. Eine weitere Form von Video-Präsentationen – die zwar in der Befragung nicht explizit erfasst wurde, aber in zunehmendem Maße in den Internetseiten der Schutzgebiete anzutreffen ist – sind Webcams.
Auditive Elemente sind zum Zeitpunkt der Umfrage lediglich von 19 % der befragten Schutzgebiete in ihren Weblösungen integriert. Jedoch planen 51 % der befragten Gebiete die Bereitstellung von Audio-Files bzw. bewerten diese als interessantes Medium. Gerade auditive Elemente spielen eine wichtige Rolle in der Umsetzung barrierefreier Internetseiten, da sie u.a. die Möglichkeit bieten, sich den Seiteninhalt automatisiert vorlesen zu lassen.
Nur 13 % der befragten Einrichtungen bieten derzeit virtuelle Besichtigungstouren an; 50 % der befragten Gebiete sind jedoch an diesen interessiert. Solche zumeist komplex multimedialen Produkte, die einen Einblick in ausgewählte Bereiche im Gebiet erlauben, sind technisch sehr verschieden realisiert. Beispiele sind 3D-Flüge, interaktive Panoramabilder oder Google Earth Animationen (vgl. Tab. 1).
3.3 Geomedien
Internetkarten sind im Webauftritt der meisten Schutzgebiete implementiert. Deutlich überwiegen statische Karten (Bilddateien: 65 %; pdf: 58 %). Nur 29 % der befragten Einrichtungen haben dynamische Internetkarten integriert. Als Lösung dominieren Google Maps-Objekte, die in die jeweilige Website eingebettet sind. An einer Umsetzung von dynamischen Internetkarten als Bestandteil ihres Internetauftritts sind 48 % der Schutzgebiete durchaus interessiert. Statische und dynamische Karten beschreiben Lage und/oder Anfahrt zu den Gebieten oder zu den lokalen räumlichen Infrastrukturen in den Schutzgebieten. Sie dienen des Weiteren der Kommunikation von Nutzungsmöglichkeiten oder informieren über den Zustand von Infrastrukturen vor Ort. Web-GIS-Anwendungen haben lediglich 13 % der befragten Einrichtungen umgesetzt. Diese beinhalten in der Regel sehr umfassende Informationen zum Gebiet, die sowohl für Besucher als auch für Experten relevant sein können. Routenplaner stellen 27 % der Schutzgebiete in ihrem Internetauftritt bereit. Sie unterstützen einerseits die Anreise zum Großschutzgebiet, anderseits Ausflüge im Gebiet.
3.4 Social-Web-Komponenten
Im Vergleich zu Multimedia-Elementen und Geomedien kommt Social-Web-Komponenten in den befragten Großschutzgebieten ein geringer Stellenwert zu. Überraschend niedrig wird der Mehrwert von Blogs und Foren beurteilt: 42 % erachten diese als uninteressant; nur 6 % der befragten Großschutzgebiete unterhalten solche. Vergleichsweise hoch ist die Bedeutung von Newslettern (u.a. als SMS-Service), die von 45 % der befragten Einrichtungen versendet und von 30 % als relevant bewertet werden. Trotz der Rolle, die Social-Media-Plattformen mittlerweile sowohl für private wie wirtschaftliche Zwecke spielen (ZEW 2010), ist das Interesse der befragten Großschutzgebiete an diesen eher gering. Nur 24 % gaben an, diese Tools zu nutzen. Allerdings planen oder bedenken weitere 42 % einen zukünftigen Einsatz. Hierfür besitzen die Gebiete in der Regel einen Facebook-Account. Ein Link („Facebook-Button“) findet sich zumeist im jeweiligen Internetauftritt implementiert und leitet die Nutzer entsprechend weiter.
3.5 Mobile Endgeräte
Gerade die Anzahl mobiler Endgeräte hat in der Bevölkerung in den letzten Jahren stark zugenommen (TNS Infratest 2012). Auch Großschutzgebiete räumen mobilen Endgeräten im Rahmen von Apps, eGuides oder Geocaching Bedeutung ein. Als relevant beurteilen sie v.a. die Verfügbarkeit von Apps (81 %), d.h. sie haben solche bereits umgesetzt, planen deren Angebot oder bewerten solche Lösungen als interessant. Eigene Apps waren zum Befragungszeitpunkt jedoch nur von sieben Großschutzgebieten (11 %) realisiert (vgl. Tab. 2).
Zwar wird der Einsatz von eGuides (zumeist an die Verfügbarkeit spezieller, gebietseigener Geräte gebunden; acht Gebiete geben an, über solche Geräte zu verfügen) als weniger wichtig im Vergleich zu Apps bewertet, aber immer noch 54 % erachten diese als interessante Lösungen. Das ist insofern überraschend, weil davon ausgegangen werden kann, dass eGuides in Zukunft gewiss von Apps im Zusammenspiel mit mobilen Endgeräten wie Smartphones abgelöst werden.
Am geringsten ist das Interesse im Kontext mobiler Endgeräte an Geocaching, einer Art internetbasierter GPS-Schnitzeljagd. Obwohl dieses Phänomen in Teilen der Bevölkerung großen Zuspruch erfährt und diesem in den letzten Jahren seitens Tourismus, Umweltbildung und Planungsvorhaben zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt wird (Weber & Haug 2012), bieten nur 14 Einrichtungen Informationen und/oder Daten hierzu an. Dabei sind Caches, wie Abb. 2 verdeutlicht, auch in Schutzgebieten von der Geocaching-Community angelegt. Dieses erfolgt aber unabhängig von den jeweiligen Schutzgebietsverwaltungen (d.h. in Folge oft ohne Berücksichtigung ökologisch sensibler Bereiche und von Besucherlenkungskonzepten etc.).
4 Bewertung und Diskussion zur Nutzung moderner IKT in Großschutzgebieten
Die Befragung zeigt, dass Großschutzgebiete moderne IKT vielfältig nutzen. Nachfolgend sollen ausgewählte Beispiele aufzeigen, wie bestehendes Potenzial zusätzlich wahrgenommen werden kann.
4.1 IKT-Nutzung in Bezug auf ausgewählte Zielsetzungen
Die befragten Großschutzgebiete beurteilen die Bereitstellung digitaler Informationen zwar als durchaus bedeutsam, aber nicht als sehr wichtig. Im Hinblick auf Besucherinformation und Öffentlichkeitsarbeit wird moderner IKT ein größerer Stellenwert eingeräumt als im Kontext von Erholungsnutzung und Tourismus oder für die Umweltbildungsarbeit (vgl. Abb. 3). Moderne IKT eröffnet jedoch Chancen für alle Bereiche gleichermaßen: Während es bspw. speziell mobile Endgeräte ermöglichen, innovative Lösungen für die Umweltbildungsarbeit zu entwickeln, bieten sich durch Geomedien alternative Informations- und Kommunikationskanäle für Erholungsaktivitäten und Tourismus an.
Moderne IKT und Umweltbildung: Involvieren vor Ort
Großschutzgebiete erachten derzeit besonders Apps als attraktive Komponenten. Wie Tab. 2 zeigt, unterstützen die aktuell verfügbaren Apps primär die Informationsvermittlung. Dabei gilt grundsätzlich, dass durch Apps Besuchern verschiedenste Auskünfte und ergänzende Angaben (über Verlinkungen) zum Schutzgebiet, zur Region, zu Infrastrukturen und Naturbesonderheiten (zeitnah und aktuell) unmittelbar vor Ort angeboten werden. Direkt in der Natur beobachtbare Aspekte lassen sich umfassend und – unterstützt durch Multimedia und Geomedien – anschaulich erklären. Die bestehende Informationsbereitstellung vor Ort kann optimiert und ausgebaut werden. Interaktive Funktionalitäten erlauben verschiedene Arten der Informationsaufbereitung und -vermittlung. Diverse Zugänge sind möglich: spielerische (z.B. Quiz), wissenschaftliche (z.B. eigenes Erforschen), emotionale (z.B. Einsatz aller Sinne). Hier kann der Fokus beliebig gesetzt werden: Information kann in Art, Tiefe und Medium variieren und zielgruppenabhängig angeboten werden. Weiterhin können Nutzer eingeladen werden, eigene Inhalte, Meinungen, Erfahrungen vor Ort online zu veröffentlichen. Als Beispiel für die Vermittlung und Erarbeitung von Wissen, unterstützt durch den Einsatz verschiedener Web-2.0-Komponenten – auch im Gelände –, soll hier das Projekt „Moor-Expedition“ ( http://www.expedition-moor.de/ ) genannt werden.
Zu betonen ist, dass durch geeignete Applikationen und Inhalte für mobile Endgeräte speziell Kinder und Jugendliche angesprochen werden können. Gerade diese Zielgruppe ist von modernen IKT-Anwendungen sehr angetan. Unbestritten ist deren Begeisterung für Geocaching. Kubat (2012) sieht in Geocaching generell einen Mehrwert für (Umwelt-)Bildungszwecke. Dabei eröffnen sich Optionen, indem über den Zugang „Technik“ Besucher und v.a. Kinder und Jugendliche für Naturinhalte begeistert werden können. Dieses verlangt allerdings nach didaktischen Konzepten, um diese neuen Medien effektiv in die bestehende Arbeit zu integrieren und auch zielgruppen- und zweckgerecht zu implementieren. Ansätze hierzu bieten u.a. Konzepte aus dem Bereich des e-Learnings und des Lernens mit Geoinformation (bspw. Jekel et al. 2011).
Ein gelungenes Beispiel zum Gebrauch mobiler Endgeräte im Kontext Bildung und Geocaching ist der Multi-Cache „Salzburgs wehrhafte Geschichte“, der zum Erkunden der Stadt Salzburg einlädt. Hier werden die Geocacher anhand von zahlreichen Stationen durch Salzburg geführt. An den einzelnen Standorten werden sie spielerisch und interaktiv zur Stadtgeschichte informiert (nur mit Login: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=026e9146-34a5-4f63-8f48-fd4e3d 520e97 ).
Moderne IKT und Erholungsaktivitäten bzw. Tourismus: Kommunikation via Karten
Im Internet sind Geomedien mittlerweile ein wichtiger Bestandteil. Besonders Anzahl und Stellenwert von Online-Karten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ihre Bereitstellung wird heute vielfach als Selbstverständlichkeit betrachtet (Thielmann et al. 2012). Dynamische Internetkarten (mit Google Maps als populärem Vertreter) sowie viele Web-GIS-Applikationen dienen primär der Unterstützung von Navigation, Orientierung und der Suche von Orten bzw. Adressen. Das spiegeln auch die in den Webauftritten der Schutzgebiete integrierten Karten wider (vgl. Tab. 1).
Zu bedenken ist jedoch, dass Karten für Informations- und Kommunikationsprozesse einen darüber hinausgehenden Stellenwert besitzen. Zum einen ist in Karten die Verständlichkeit der kommunizierten Informationen durch ihre räumliche Kontextualisierung erhöht; zum anderen sorgt v.a. der visuelle Zugang für eine schnelle und wirkmächtige Vermittlung, da visuell kommunizierte Inhalte deutlich zugänglicher sind als textliche Ausführungen (Wood 2010). Durch die typischen interaktiven Standardfunktionalitäten dynamischer Internetkarten (vgl. Kasten 1) kann ein Gebiet unabhängig von einem Besuch erkundet werden. Jekel & Jekel (2010) stellen heraus, dass digitale Karten heute wesentliche Funktionen erfüllen, um Informationen durch Interaktionen zu vermitteln.
Diese Aspekte sind auch für die Schutzgebiets-Zielsetzungen von Bedeutung: Entsprechend realisierte Internetkarten eröffnen die Möglichkeit, sich umfassend zu präsentieren. Informations- und Bildungsangebote können dem Nutzer nicht nur verräumlicht kommuniziert, sie können von diesem auch eigenständig erkundet werden, indem zur Region, zum Schutzgebiet oder zu ausgewählten Attraktionen und Infrastrukturen Zusatzinformationen, Links und Beurteilungen anderer Besucher verfügbar sind. Ausflüge können bereits bei der Planung wesentlich unterstützt werden. Aber auch Besucherlenkung kann erfolgen.
Die Sichtung der Internetauftritte der Schutzgebiete zeigt, dass die Qualität der Umsetzungen von Internetkarten erheblich variiert. Prinzipiell sollten dynamische Internetkarten in Inhalt, Design und interaktiven Funktionalitäten auf den angestrebten Zweck ausgerichtet und angemessen in Webauftritten integriert und platziert sein. Obwohl das Angebot an Web-Mapping-Tools (z.B. Google Maps, ScribbleMaps, uMapper) es heute einfach macht, digitale Karten zu erzeugen und in Internetseiten einzubetten, bedarf eine qualitativ hochwertige und zielgerichtete Umsetzung Fähigkeiten im Kontext Internet- und Multimediakartographie.
4.2 Ansprache, Austausch und Kontakt mit Besuchern und Nutzern
Nach wie vor greifen Großschutzgebiete für Austausch und Kontakt mit Außenstehenden überwiegend auf traditionelle Medien zurück. Trotz ihres Potenzials spielen Web-2.0-Komponenten für diese Einrichtungen immer noch eine geringe Rolle (vgl. Abb. 4). Es scheint, dass die Chancen, die sich durch diese ergeben, stärker wahrgenommen werden könnten. Beispiele sind zielgruppenspezifische Informations- und Kommunikationsstrategien sowie die Nutzung von user generated content und von online communities.
Zielgruppen und Kommunikationskanäle
Neben der Möglichkeit, sich durch Multimedia eindrucksvoll zu präsentieren, leisten diese Elemente einen wichtigen Beitrag, Inhalte unterschiedlichen Zielgruppen angemessen zur Verfügung zu stellen. Durch den Einsatz verschiedener Medien können verschiedene Informationskanäle verwendet und folglich verschiedene Sinne angesprochen werden. Das ist insbesondere im Hinblick auf die persönlichen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Präferenzen der einzelnen Zielgruppen ein wichtiger Punkt (Neuschmid et al. 2012).
Gerade bzgl. Barrierefreiheit eröffnen multimediale Elemente wesentliche Optionen (Neuschmid et al. 2012). Das zeigt der Internetauftritt des Nationalparks Eifel, in dem zahlreiche Interaktionen implementiert sind, um Zugang und Lesbarkeit der Seite zu verbessern: Es können Schriftgröße und Kontrast (Schriftfarbe und Hintergrundfarbe) verändert und es kann zu einer rein textbasierten und einer Version mit leichter Sprache gewechselt werden. Multimedia-Elemente wie Videomaterial sind verfügbar und bieten Inhalte in Gebärdensprache an (vgl. Abb. 5).
User generated content und online communities
Web-2.0-Komponenten bieten generell die Möglichkeit, eigene Inhalte, Meinungen und Erfahrungen zu veröffentlichen. Diesen Daten kommt als user generated content in vielerlei Hinsicht Bedeutung zu. Ein Beispiel sind PP-GIS (Public Participation GIS), die u.a. von australischen Nationalparks eingesetzt werden. Diese Gebiete greifen zur Unterstützung von Managementfragen auf Inhalte zurück, die von Besuchern geomedial bereitgestellt werden, d.h. Besucher tragen nach ihrem Aufenthalt im Gebiet Informationen zur Sichtung von Tieren, Störungen oder Bewertungen von Infrastrukturen etc. in entsprechende dynamische Internetkarten ein (Brown & Weber 2011). Trotz berechtigter Fragen z.B. zur Datenqualität stehen für Entscheidungsfindungen somit umfangreichere (und aktuellere) Informationen zur Verfügung, als dieses ohne den Beitrag der Besucher möglich wäre.
Hinsichtlich user generated content kommt Social-Media-Plattformen (wie z.B. Facebook) besondere Relevanz zu: Allgemein wird diesen Anwendungen für Kommunikationszwecke steigende Bedeutung eingeräumt (URL 1). Begründet ist das u.a. darin, dass sie gegenwärtig von großen Teilen der Gesellschaft regelmäßig und oft genutzt werden (Heidemann 2010).
Grundsätzlich basieren diese Plattformen in ihren Funktionalitäten auf sog. Social Networking Services (SNS), die letztlich Grundlage für Benutzerregistrierung, Identitätsmanagement, Kontaktmanagement, Austausch sowie Gruppenbildung sind (Ebersbach et al. 2008). Mit Bezug auf die sich durch SNS eröffnenden Möglichkeiten betonen Körnig-Pich et al. (2010), dass durch Social Media Plattformen äußerst hilfreiche Daten generiert werden können. Zum Teil sind diese bereits vorhanden (Kontaktmanagement, Posts etc.) und müssen lediglich erkannt werden. Zudem bieten diese Portale eine geeignete Basis, um gezielte Informationen direkt bei den Nutzern zu erfragen. Dieses eröffnet auch für Schutzgebiete Chancen. Bspw. können Fragen zu ihren Zielgruppen beantwortet werden: Wer sind die Schutzgebietsbesucher und was interessiert sie? Das sind relevante Aspekte für die Erarbeitung vieler Maßnahmen im Schutzgebiets- bzw. Besuchermanagement (vgl. u.a. Hennig & Großmann 2010).
Dabei lassen sich insbesondere durch Möglichkeiten des online community buildings Diskussionen und Kommunikationsprozesse fördern, da direkter Kontakt und das Kennen der Teilnehmer wichtige Grundlagen für jeden Informationsaustausch sind (Evans-Cowley 2010, Hofmann & Jarosch 2011). Dieser Gesichtspunkte sind sich Wirtschaftsunternehmen seit geraumer Zeit bewusst und nutzen die sich eröffnenden Vorteile (Dörfel & Schulz 2011). So stellt das ZEW (2010) die Bedeutung von gezielter Online-Werbung anhand dieser Tools heraus. Dementsprechend bietet sich Großschutzgebieten die Chance, Bekanntheit sowie Bindung und Identifizierungen in der Gesellschaft zu verbessern – eine wichtige Zielsetzung u.a. im Kontext der Umweltbildungsarbeit dieser Einrichtungen.
5 Fazit und Ausblick
Die Umfrage zeigt, dass Großschutzgebiete in der DACH-Region moderne IKT grundsätzlich vielfältig nutzen und dabei gesellschaftliche Trends aufgreifen. Das bestehende Potenzial scheint derzeit allerdings noch nicht voll ausgeschöpft. Oft sind die einzelnen Elemente hinsichtlich ihrer (technischen und gestalterischen) Umsetzung noch (zu) wenig koordiniert und auf Ziele und Zielgruppen der jeweiligen Schutzgebiete abgestimmt. Es gilt: Je mehr Elemente verfügbar sind, desto wichtiger ist deren Auswahl, Anordnung und Layout. Die Vielzahl an Web-2.0-Komponenten, eingebunden in die Internetauftritte der Großschutzgebiete, erschwert es oft, einen Überblick zu behalten. So sind informative und gut realisierte Videobeiträge mitunter nicht leicht zu finden. Bell (2009) unterstreicht, dass erfolgreiche Applikationen eine Kombination einer kleinen Anzahl nützlicher Werkzeuge sind. Hier besteht Bedarf, Großschutzgebieten u.a. durch adäquate und entsprechend adaptierte Ansätze und Konzepte zu unterstützen.
Seitens der befragten Einrichtungen wurde vielfach auf mangelnde Ressourcen zur Umsetzung und Wartung von modernen IKT-Anwendungen hingewiesen. Die Frage ist, wie dem in Anbetracht knapper Mittel entsprochen werden kann. In diesem Zusammenhang muss die Bedeutung eines Erfahrungsaustausches zwischen den Schutzgebieten betont werden. Dies ist ein Aspekt, der im Zuge der Befragung von diversen Großschutzgebieten vermehrt angesprochen wurde.
Literatur
Bell, G. (2009): Building Social Web Applications. O’Reilly Media.
Brown, G., Weber, D. (2011): Public Participation GIS: A new method for national park planning. Landscape and Urban Planning, doi:10.1016/j.landurbplan.2011.03.003.
Dörfel, L., Schulz, T. (2011): Social Media in der Unternehmenskommunikation. Berlin.
Eberle, T. (2009): Touristische Bedarfsanalyse und Implementierung eines WebGIS in das touristische Gesamtkonzept Nationalpark Bayerischer Wald. Unveröff. Magisterarb., Otto-Friedrich Universität Bamberg, Institut für Geographie.
Ebersbach, A., Glaser, M., Heigl, R. (2008): Social Web. UVK Verlagsges., Konstanz.
Evans-Cowley, J. (2010): Planning in the age of Facebook. GeoJournal Springer Science + Business Media B.V.
Gryl, I., Jekel, T., Donert, K. (2010): GI and Spatial Citizenship. In: Jekel, T., Koller, A., Donert, K., Vogler, R., eds., Learning with Geoinformation V, Wichmann, Berlin, 2-11.
Heidmann, J. (2010): Online Social Networks – ein sozialer und technischer Überblick. Informatik-Spektrum 33 (3), 262-271.
Hennig, S., Grossmann, Y. (2009): Erholungsuchende und Besuchermanagement. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (8), 237-244.
–, Riedl, N. (2012): Natursportarten verträglich ausüben. Einsatz typgerechter Kommunikationsstrategien am Beispiel des Kanufahrens auf der Wiesent. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (4), 115-124.
Hofmann, J., Jarosch, J. (2011): IT-gestütztes Lernen und Wissensmanagement. In: Hofmann, J., Jarosch, J., Hrsg., IT-gestütztes Lernen und Wissensmanagement, HMD Praxis der Wirtschaftsgeographie, 6-17.
Jekel, T., Jekel A. (2010), Stichwort: Digitale Globen. In: Sandner, W., Besand, A., Hrsg., Handbuch Medien in der politischen Bildung. Wochenschau, Schwalbach, 159-168.
–, Koller, A., Donert, K., Vogler, R. (2011): Learning with GI 2011. Implementing Digital Earth in Education. Wichmann, Berlin.
Körnig-Pich, R., Kebbedies, G., Zeile, P. (2010): Die Potenziale aktueller WebGIS- und Web-2.0-Entwicklungen als Planungsinstrumente – der Planer als Eichhörnchen. CORP 2010 Proceedings. Vienna, 18-20 May 2010.
Kubat, C. (2012): Möglichkeiten zur Umweltbildung mit GPS: Konzeption eines Natura2000-GPS-Erlebnispfades für das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz.
Lange, C. (2007): Web 2.0 zum Mitmachen. Die beliebtesten Anwendungen. O’Reilly.
Meckel, M. (2008): Aus Vielen wird das Eins gefunden - wie Web 2.0 unsere Kommunikation verändert. Aus Politik und Zeitgeschichte 39/2008.
Neuschmid, J., Hennig, S., Schrenk, M., Wasserburger, W., Zobl, F. (2012): Barrierefreiheit von online Stadtplänen: das Beispiel AccessibleMap. In: Strobl, J. et al., Hrsg., Angewandte Geoinformatik 2012, Beiträge zum 24. AGIT-Symposium, Salzburg, Wichmann, Berlin, 339-347.
OECD (2003): Document No. DSTI/ICCP/IIS/M(2003)1, 12. September 2003.
Schnorr-Bäcker, S. (2004): Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien in Deutschland 1995 bis 2003. Teil 1: Informations- und Kommunikationstechnologien in der Wirtschaft. In: Statistisches Bundesamt, Hrsg., Wirtschaft und Statistik 7/2004.
Thielmann, T., van der Velden, L., Fischer, F., Vogler, R. (2012) Dwelling in the Web. Towards a googlization of space. HIIG Discussion Paper Series No. 2012-03. Berlin.
TNS Infratest (2012): Mobile Internetnutzung. Entwicklungsschub für die Gesellschaft? Eine Sonderstudie im Rahmen des (N)ONLINER Atlas 2012.
Weber, K., Haug, S. (2012): Geocaching und Raumnutzung. Freizeitbeschäftigung mit KonfliktPotenzial. Standort 36, 17-24.
Wood, D. (2010): Rethinking the Power of Maps. New York.
WORK (2010): Life 2 – Vernetztes Arbeiten in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Studie.
Zeile, P., Exner, J., Höffken, S., Streich, B. (2010): Web 2.0 in Lehre und Forschung – Chancen und Potenziale für die räumliche Planung. CORP 2010 Proceedings, Vienna, 18-20 May 2010.
ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2010): Interaktiv, mobil, international – Unternehmen im Zeitalter von Web 2.0. IKT Report, 9/2010.
URL-Verzeichnis
URL 1: http://www.amt24.de/PM/portal/de/service/web_2_0_studie/index.html; Zugriff: 26.11. 2012.
URL 2: http://www.schaffrath.de/medien-entwicklung/mobil/app-entwicklung/news-detail/article/apps-fuer-mobile-geraete-2012-wichtiger-markttrend-fuer-unternehmen/; Zugriff: 26.11.2012.
Anschrift der Verfasser(in): Dr. Sabine Hennig, Robert Vogler und Prof. Dr. Matthias Möller, IFFB Geoinformatik-Z_GIS, Paris Lodron Universität Salzburg, Schillerstraße 30, A-5020 Salzburg, Österreich, E-Mail sabine.hennig@sbg.ac.at, robert.vogler@sbg.ac.at und matthias.moeller@sbg.ac.at.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen







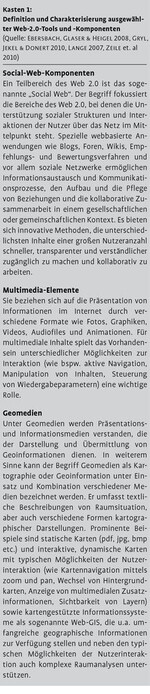

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.