Was bringt uns die Bundeskompensationsverordnung?
Abstracts
Seit April 2013 liegt der zweite Entwurf für eine Bundeskompensationsverordnung zur Umsetzung einer bundeseinheitlichen Standardisierung der Eingriffsregelung vor. Der Entwurf wurde bereits durch das Bundeskabinett beschlossen, bedarf aber noch der Zustimmung des Bundesrates. Der vorliegende Beitrag stellt die wesentlichen Inhalte des Verordnungs-Entwurfs und seiner umfangreichen Anhänge dar und bewertet das zugrunde liegende Kompensationsmodell aus Sicht der Planungspraxis.
Neben den positiven Aspekten der vorgestellten Neuregelungen werden Defizite des Entwurfs aufgezeigt sowie Vorschläge für weitergehende Konkretisierungen und wünschenswerte Anpassungen formuliert, die die praktische Umsetzbarkeit des Verordnungs-Entwurfs verbessern könnten.
What to Expect from the Compensation Regulations for Interventions into Nature? The Draft Regulation of the Federal Ministry of the Environment from a planner’s point of view
In April 2013 the second draft for a Ordinance on the Compensation for Interventions in Nature has been presented in order to implement a federal standardisation of the impact regulation. The draft has already passed the Federal Cabinet but still needs acceptance of the Federal Assembly. The paper outlines the major content of the draft ordinance and its comprehensive appendices, and it evaluates the basic compensation model from a viewpoint of practical planning. Beside positive aspects of the new regulations it identifies deficits of the draft, and it suggests additional concretions and desirable adaptations which could improve its practicability.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Der im April 2013 durch das Bundeskabinett vorgelegte zweite Entwurf einer Bundeskompensationsverordnung (BKompV-E) (BMU 2013a) unternimmt den zu begrüßenden Versuch, bundeseinheitliche Standards zur Methode der Eingriffsregelung einzuführen. Der Entwurf macht detaillierte Vorgaben zur schutzgut- und funktionsbezogenen Erfassung und Bewertung des Ausgangszustands von Natur und Landschaft und gibt neue Kriterien und Bewertungsrahmen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs vor.
Durch die Kompensationsverordnung soll die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung insgesamt „transparenter und effektiver“ gestaltet werden. Vor allem sollen die Verpflichtungen zur Vermeidung und Kompensation bei Eingriffen „weiter konkretisiert und bundesweit standardisiert“ werden. Hierdurch sollen Investitionsbedingungen verbessert, Verwaltungsverfahren beschleunigt, behördliche Entscheidungen transparenter und Planungs- und Rechtssicherheit privater wie öffentlicher Vorhaben erhöht werden. Darüber hinaus soll im Rahmen des Vermeidungsgebots die Flächeninanspruchnahme im Allgemeinen sowie die Nutzungsaufgabe land- und forstwirtschaftlicher Flächen im Besonderen minimiert werden. Schließlich soll den Herausforderungen der Energiewende, vor allem des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und des Netzausbaus, Rechnung getragen werden (BMU 2013b).
Die bundeseinheitliche Standardisierung der Eingriffsregelung ist – nachdem sich der erste Ansatz Mitte der 1990er Jahre (LANA 1996) nicht durchgesetzt hatte – lange überfällig und mittlerweile auch Vorgabe des § 15 Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).
Nach dem Entwurf des Bundesumweltministeriums (BMU) vom 05.11.2012 und einer Verbändeanhörung hat das Bundeskabinett am 24.04.2013 einen zweiten, erheblich veränderten Entwurf einer „Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bundeskompensationsverordnung – BKompV)“ beschlossen. Der Entwurf bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates.
2 Kernpunkte der Neuregelung
2.1 Grundsätzliches
Der BKompV-E regelt das Nähere zur Kompensation von Eingriffen im Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG, insbesondere zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie zur Höhe der Ersatzzahlung und zum Verfahren zu ihrer Erhebung (§ 1 Abs. 1 BKompV-E). Er gliedert sich in fünf Abschnitte und enthält
allgemeine Regelungen zum Anwendungsbereich sowie zu den Anforderungen an die Kompensation (Abschnitt 1, §§ 1 und 2),
Regelungen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs (Abschnitt 2, §§ 3 bis 6)
sowie zu Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen, insbesondere unter Berücksichtigung agrarstruktureller Belange, von Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen, von Maßnahmen zur Entsiegelung und Wiedervernetzung sowie von Unterhaltung und rechtlicher Sicherung (Abschnitt 3, §§ 7 bis 11),
Vorgaben zu Voraussetzungen und Höhe der Ersatzzahlung (Abschnitt 4, §§ 12 bis 14) und
abschließend in Abschnitt 5 (§§ 15 und 16) Aussagen zur Übergangsregelung und zum Inkrafttreten.
Die Schritte der Kompensationsermittlung (Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter, Bewertung der Eingriffsintensität, Ermittlung des Kompensationsbedarfs, Ermittlung der Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz bzw. Höhe des zu zahlenden Ersatzgeldes) werden mit Hilfe von sechs zum Teil sehr umfänglichen und ausdifferenzierten Anlagen geregelt. Insbesondere werden sehr detaillierte Vorgaben zur schutzgut- und funktionsbezogenen Erfassung und Bewertung des Ausgangszustands von Natur und Landschaft, zu räumlichen und funktionalen Anforderungen an Ausgleich und Ersatz sowie an die Eignung von Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen im Rahmen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung als Kompensationsmaßnahmen gemacht.
Neu strukturiert und gegenüber dem ersten Entwurf der BKompV ergänzt ist Abschnitt 2 zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs, in dem einleitend das grundsätzliche Vorgehen geregelt wird. So sind der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft im Einwirkungsbereich des Vorhabens sowie die zu erwartenden Beeinträchtigungen zu ermitteln und zu bewerten. Hierzu sind in jedem Fall die im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegenden Biotope zu erfassen. Weitere Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima oder Luft und Landschaftsbild) sind nur dann zu erfassen, wenn für diese erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere bzw. für das Landschaftsbild erhebliche Beeinträchtigungen prognostiziert werden (§ 3 Abs. 3 BKompV-E). Vorhabenbezogene Wirkungen, die naturschutzrechtlich als sehr gering eingeschätzt werden, bleiben unberücksichtigt (§ 3 Abs. 1 BKompV-E).
2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter
Mit Anlage 1 zu § 3 Abs. 3 Satz 1 und § 5 Abs. 1 BKompV-E wird für die Bewertung der Bedeutung der Funktion der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Lebensgemeinschaften/Biotope, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild eine Tabelle zur Verfügung gestellt, die die Funktionen der Schutzgüter im Naturhaushalt beschreibt sowie Erfassungskriterien und einen Bewertungsrahmen vorgibt. Die Bewertung ist schutzgutspezifisch anhand einer sechsstufigen Skala von „hervorragend“ bis „sehr gering“ durchzuführen.
Der Bewertungsrahmen bei Pflanzen und Tieren orientiert sich am Vorkommen von gefährdeten bzw. bundes- und/oder landesweit bedeutenden Tier- bzw. Pflanzenarten. Beim Schutzgut Boden erfolgt die Bewertung nach dem Gefährdungsgrad in Bezug auf die wissenschaftliche, naturgeschichtliche, kulturhistorische oder landeskundliche Bedeutung des jeweiligen Bodentyps, die natürlichen Bodenfunktionen und die natürliche Bodenfruchtbarkeit, wobei sich die Erhebung vorwiegend auf vorhandene Bodeninformationssysteme stützen soll. Die Bewertung des Schutzguts Wasser erfolgt differenziert für Oberflächengewässer, Grundwasser und Hochwasserschutz- bzw. Retentionsfunktion. Für die Oberflächengewässer ist hierfür der ökologische Zustand oder das ökologische Potenzial zugrunde zu legen oder – soweit diese Einstufung noch nicht erfolgt ist – die Gewässergüte anhand der Gewässergüte- und Strukturgüteklassen. Die Bewertung des Grundwassers erfolgt abweichend von der sechsstufigen Bewertungsskala auf Grundlage der jeweiligen Informationssysteme bzw. der landesbezogenen Bewertungsvorgaben. Die Hochwasserschutz- und Retentionsfunktion ist anhand des Bemessungshochwassers und der festgesetzten oder vorgesehenen Überschwemmungsbiete zu bewerten.
Im Bereich Klima/Luft sind die klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen und die Klimaschutzfunktionen durch Treibhausgassenken zu bewerten. Das Landschaftsbild wird anhand einer Zuordnung zu den Landschaftstypen „Naturlandschaften“, „Historisch gewachsene Kulturlandschaften“, „Naturnahe Landschaften ohne wesentliche Prägung durch technische Infrastruktur“ und „Besonders bedeutsame Einzellandschaften“ bewertet. Neben der Ausprägung dieser Landschaftskategorien ist die überregionale, deutschlandweite oder europaweite Bedeutung der Landschaft als wesentliches Bewertungsmerkmal hinzuzuziehen.
Für die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima/Luft werden die Erfassungsnotwendigkeit und erforderliche Erfassungsparameter wirkungsspezifisch konkretisiert.
Die Grundbewertung des Schutzgutes Biotope erfolgt nach § 4 BKompV-E in Verbindung mit Anlage 2. Zunächst sind sämtliche betroffenen Biotope den Biotoptypen der Anlage 2 zuzuordnen und auf der Grundlage der in Spalte 3 der Anlage enthaltenen Biotoptypenwerte zu bewerten. Dabei können im Einzelfall Abweichungen um bis zu drei Wertpunkte nach oben oder nach unten vorgenommen werden. Zudem soll den Ländern die Möglichkeit eingeräumt werden, weitere Biotoptypen aufzunehmen und innerhalb der vorgegebenen Systematik zu bewerten. Auf dieser Grundlage ist die Bedeutung jedes Biotops von „sehr gering“ (Biotopwerte 0 bis 4) bis „hervorragend“ (Biotopwerte 22 bis 24) einzuordnen.
2.3 Bewertung der Eingriffsintensität
Als Voraussetzung für die Ermittlung des erforderlichen Kompensationsumfangs ist im nächsten Schritt die Schwere des Eingriffs zu ermitteln. Sie leitet sich anhand einer vorgegebenen Matrix (Anlage 3 zu § 4 Abs. 3 Satz 2 und § 5 Abs. 2 Satz 2 BKompV-E, s. Tab. 1) aus der Verschneidung der Bedeutung der Schutzgüter mit der Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen ab. Hierbei sind sowohl die erfassten und bewerteten Biotope als auch diejenigen weiteren Schutzgüter und Funktionen, für die erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere (bzw. für das Landschaftsbild erhebliche Beeinträchtigungen) gemäß § 3 Abs. 3 BKompV-E prognostiziert wurden, zu berücksichtigen.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 BKompV-E ist die Beeinträchtigung eines Biotops durch Versiegelung in der Regel als „hoch“ zu bewerten. Mittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf Biotope soll dagegen ein Faktor zwischen 0,1 und 1 zugeordnet werden. Nach der Begründung (BMU 2013c; zu § 4) müssen entsprechende Regelungen auf normativer Ebene notwendigerweise abstrakt bleiben, so dass für die Praxis explizit Konkretisierungen an Hand von Fallgruppen oder repräsentativen Einzelbeispielen in Form eines Leitfadens empfohlen werden.
Zudem werden in Anlage 3 Feststellungen der Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen getroffen, wonach eine erhebliche Beeinträchtigung ab einer Größe von 300 m2 vorliegt. Bei einer Versiegelung oder einem Bodenabtrag von bisher unversiegelten Flächen ab einer Größe von 10000 m2 muss geprüft werden, ob eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere vorliegt.
2.4 Ermittlung des Kompensationsbedarfs
Bei den Biotopen, bei denen mindestens eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist, ist der biotopwertbezogene Kompensationsbedarf zu ermitteln. Hierzu ist bei Flächeninanspruchnahmen eine Bilanzierung der Biotopwerte vor und nach Durchführung des Eingriffs vorzunehmen und mit der voraussichtlich beeinträchtigten Fläche in Quadratmetern zu multiplizieren (§ 6 Abs. 1 Nr. 1). Bei mittelbaren Beeinträchtigungen ist ein nach Stärke, Dauer und Reichweite zu bildender „Beeinträchtigungsfaktor“ nach § 4 Abs. 4 Satz 2 BKompV-E hinzuzuziehen, der zwischen 0,1 und 1 liegen kann (§ 6 Abs. 1 Satz 2). Die Summe der gebildeten Produkte ergibt den biotopwertbezogenen Kompensationsbedarf.
Liegt für das Schutzgut Biotope oder für die weiteren Schutzgüter und Funktionen eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere vor oder beim Schutzgut Landschaftsbild eine erhebliche Beeinträchtigung, ist dagegen verbal-argumentativ der funktionsspezifische Kompensationsbedarf zu ermitteln (§ 6 Abs. 2). Der Biotopwert der funktionsspezifischen Kompensationsmaßnahmen ist vom biotopwertbezogenen Kompensationsbedarf abzuziehen (§ 7 Abs. 1 BKompV-E).
2.5 Ermittlung der Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz bzw. Höhe des zu zahlenden Ersatzgeldes
Entsprechend der Differenzierung in den §§ 4 und 5 BKompV-E unterscheiden die §§ 7 und 8 der Verordnung bei den Anforderungen an die Realkompensation zwischen Biotopen und weiteren Schutzgütern sowie erheblichen Beeinträchtigungen und erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere.
Erhebliche Beeinträchtigungen von Biotopen sind nach § 7 Abs. 1 ausgeglichen oder ersetzt, wenn im betroffenen Naturraum innerhalb einer angemessenen Frist eine Aufwertung des Naturhaushalts oder Landschaftsbildes erfolgt, die in ihrem Biotopwert dem nach § 6 ermittelten biotopwertbezogenen Kompensationsbedarf entspricht. Die Lage der Naturräume ist dabei gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 BKompV-E „auf der Grundlage“ der Anlage 4 zu bestimmen, die sich – ebenso wie die Begründung zum BNatSchG 2010 (Bundesratsdrucksache 278/09 vom 03.04.2009, S. 180f.) – auf eine Gliederung der Naturräume durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) beruft und diese nunmehr in den Gesetzesrang erheben will. Ein besonderer Stellenwert wird Kompensationsmaßnahmen eingeräumt, die mit einer Entsiegelung oder einer Wiedervernetzung von Lebensräumen verbunden sind, indem ihnen zusätzlich 15 Wertpunkte je Quadratmeter aufgewerteter Fläche anzurechnen sind. Bei technischen Wiedervernetzungmaßnahmen sind auch mittelbare erzielte Aufwertungen anzuerkennen. Erhebliche Beeinträchtigungen von Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima oder Luft werden durch die nach den vorstehenden Regelungen erforderliche Aufwertung kompensiert (§ 8 Abs. 1 BKompV-E). Erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere von Biotopen sind dagegen entsprechend den erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere der weiteren Schutzgüter zu kompensieren (§ 7 Abs. 3 BKompV-E).
Je nachdem, ob die betroffenen Funktionen innerhalb des Funktionsraumes (entsprechend Anlage 5 Abschnitt A Spalte 4) oder im selben Naturraum hergestellt werden können, ist eine Beeinträchtigung besonderer Schwere ausgleichbar oder ersetzbar (§ 8 Abs. 3 und 4).
Die Anforderungen an Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere sowie mindestens erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden in Anlage 5 bestimmt. In Abschnitt A Spalte 3 werden die Ziele für Ausgleich und Ersatz konkretisiert und Beispielmaßnahmen genannt. Für die Schutzgüter Biotope, Tiere und Pflanzen gilt unter den funktionalen Anforderungen als Ziel die Wiederherstellung, Optimierung und Neuschaffung der Biotope, Habitate bzw. Standorte der betroffenen Art. Als Maßnahmenbeispiel werden u.a. Nährstoffentzug, Wiedervernässung, Reaktivierung/Schaffung von Vernetzungsstrukturen, Wiederherstellung von Lebensräumen oder Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen genannt. Im Sinne des § 2 Abs. 4 BKompV-E ist bei der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Multifunktionalität und damit einen möglichst geringen Flächenbedarf zu achten.
Für Ausgleichsmaßnahmen wird ein enger räumlicher Bezug vorausgesetzt, der in Anlage 5 Abschnitt A Spalte 4 näher bestimmt wird. So sind z.B. die Ausgleichsmaßnahmen für Pflanzen und Tiere im jeweiligen vom Eingriff betroffenen populations- bzw. artspezifischen Funktionsraum in Abhängigkeit von konkreten Verbreitungsarealen bzw. Aktionsräumen durchzuführen; Ausgleichsmaßnahmen für Biotope sind im betroffenen Landschaftsraum, der sich durch eine ähnliche Biotopausstattung abgrenzt, umzusetzen.
Sowohl für Ausgleichs- als auch für Ersatzmaßnahmen ist die Wiederherstellung innerhalb einer angemessenen Frist zwingend. Dabei sind Entwicklungszeiten nach Anlage 5 Abschnitt B BKompV-E zu berücksichtigen.
§ 10 BKompV-E regelt gemeinsam mit den Abschnitten A bis C der detaillierten Anlage 6 zum BKompV-E
die Festsetzung von Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen (Abs. 1),
Maßnahmen zur Entsiegelung, die durchgeführt werden sollen, um eingriffsbedingte Neuversiegelungen zu kompensieren (Abs. 2), sowie
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen, um bestehende Beeinträchtigungen der ökologischen Austauschbeziehungen sowie des räumlichen Zusammenhangs von Lebensräumen zu verringern (Abs. 3).
Hinsichtlich der Unterhaltung und rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regelt § 11 Abs. 1 BKompV-E zunächst, dass die Unterhaltung die zur Entwicklung und Erhaltung erforderliche Pflege umfasst – die noch im ersten Entwurf enthaltene Regelung, dass Kompensationsmaßnahmen bei privaten Vorhabenträgern 30 Jahre nicht überschreiten sollen, wurde nicht übernommen. In Absatz 2 wird – ebenfalls abweichend vom ersten Entwurf – festgelegt, dass die zuständige Behörde über die Art und Weise der rechtlichen Sicherung der Realkompensationsmaßnahmen nach pflichtgemäßen Ermessen entscheidet – eine zwingende dingliche Sicherung wäre danach nicht mehr erforderlich. Auch die Möglichkeit, dass sich der Kompensationspflichtige seiner Kompensationspflichten durch vertragliche Vereinbarungen mit Dritten entledigt, kann die zuständige Behörde auch nach Erlass des Zulassungsbescheids „mit befreiender Wirkung“ gestatten.
Sofern die Anforderungen an Ausgleich bzw. Ersatz aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht erfüllt werden können, wird entsprechend der bundesrechtlichen Vorgabe in § 15 Abs. 6 BNatSchG die Möglichkeit einer Zahlung von Ersatzgeld eingeräumt. Dieses ist nach den aufgeführten Regelbeispielen insbesondere der Fall, wenn die betroffenen Funktionen durch Maßnahmen nicht oder nur unter unzumutbaren Belastungen herstellbar sind (Nr. 1) oder geeignete Kompensationsflächen im betroffenen Naturraum nicht vorhanden oder nicht verfügbar sind (Nr. 2). Nach der Sonderregelung für vertikale Mast- oder Turmbauten gelten die oberhalb von 20 m über der Geländeoberfläche verursachten Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds in der Regel nicht als kompensierbar, so dass hierfür regelmäßig Ersatzgeld zu leisten ist. Als mögliche, aber in der Praxis „eher seltene Ausnahme“ einer Realkompensation nennt die Begründung den Rückbau vergleichbarer vertikaler Anlagen (BMU 2013c; zu § 12).
Zur Höhe der Ersatzzahlung regelt § 13 Abs. 1 BKompV-E, dass bei Ermittlung der durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Kompensationsmaßnahmen die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB anzuwenden sind. Für den Fall nicht feststellbarer Kosten konkretisiert Absatz 2 die Höhe der Ersatzzahlung differenziert nach
Mast- und Turmbauten: 100 bis 800 € je m Anlagenhöhe,
Gebäuden: 0,01 bis 0,08 € je m³ umbauten Raums,
Abgrabungen: 0,10 bis 0,80 € je m2 in Anspruch genommener Fläche,
Aufschüttungen: 0,30 bis 2,40 € je 100 m³ aufgeschütteten Materials.
Eine Sonderregelung enthält schließlich § 14 BKompV-E für die Erhebung der Ersatzzahlung im Bereich der AWZ und des Festlandsockels. Diese soll als zweckgebundene Abgabe an den Bund geleistet werden. Das BMU als Bewirtschafter der Mittel kann diese an eine der Aufsicht des Bundes unterstehende Einrichtung oder eine vom Bund beherrschte Gesellschaft oder Stiftung weiterleiten, wodurch es ermöglicht werden soll, aus fachlicher Sicht sinnvolle Maßnahmen auch Dritten zur Verfügung stellen zu können (BMU 2013c; zu § 14).
3 Bewertung und Vorschläge
3.1 Chancen
Die Zielsetzung der neuen Verordnung ist grundsätzlich zu begrüßen. Eine möglichst weitreichende Vereinheitlichung der Methode der Eingriffsregelung auf Bundesebene ist überfällig und wird die Transparenz und Akzeptanz des Naturschutzrechts verbessern. Diverse unbestimmte Rechtsbegriffe aus dem BNatSchG sollen zudem durch die BKompV bundesrechtlich definiert und konkretisiert werden.
In der Begründung zum Entwurf der BKompV wird der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ein hoher Stellenwert zuerkannt. So wird ausdrücklich auf die Bedeutung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung als grundlegendes Instrument zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des § 1 BNatSchG hingewiesen. Es wird betont,
dass der Eingriffsregelung eine erhebliche Bedeutung bei der dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft zukommt (vgl. § 1 Abs. 1 BNatSchG) und
dass die Verpflichtung zur Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft als eine Ausprägung des Vorsorgeprinzips im weiteren Sinne und des Verursacherprinzips zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung des Verfassungsgebots zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen aus Artikel 20a des Grundgesetzes (GG) darstellt.
Im Weiteren wird hervorgehoben, dass die Verordnung zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme beitragen soll: „Je stärker es im Rahmen des Vermeidungsgebots gelingt, die Flächenneuinanspruchnahme durch den Eingriff selbst zu verringern, desto geringer fällt in der Regel auch der Kompensationsbedarf aus, der eine weitere Flächeninanspruchnahme mit sich bringt.“ (BMU 2013b).
Für den Ausgleich von Beeinträchtigungen besonderer Schwere bzw. mindestens erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds werden in Anlage 5 BKompV-E konkrete räumliche Anforderungen an die funktionsbezogenen Ausgleichsmaßnahmen gestellt, die das BNatSchG bisher nicht zur Verfügung stellt. Diese Konkretisierung stärkt den funktionsbezogenen Ausgleich zumindest bei Beeinträchtigungen besonderer Schwere sowie bei erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und ist ein deutlicher Schritt in Richtung auf eine bundeseinheitliche Standardisierung.
Durch die Einführung der Bagatellklausel in § 3 Abs. 1 Satz 2 BKompV-E, nach der vorhabenbezogene Wirkungen, die naturschutzfachlich als „sehr gering“ eingeschätzt werden, bei den nachfolgenden Bewertungsschritten außer Betracht bleiben sollen, sowie der Einschränkung für die detaillierte Erfassung und Bewertung von „weiteren“ Schutzgütern nach § 3 Abs. 3 BKompV-E ergibt sich gegenüber dem Vorentwurf der BKompV eine größere Berücksichtigungsmöglichkeit fachgutachterlicher Einschätzungen im Einzelfall. Durch die zusätzliche Option, länderspezifische Biotope in die Biotoptypenliste in Anlage 2 aufzunehmen, können mit diesem Entwurf auch regionsspezifische Besonderheiten Berücksichtigung finden.
Die Möglichkeit der spezifischen Anpassung des Untersuchungsprogramms, nach dem eine Art vorgezogenes Screening durchgeführt wurde, ist aus Sicht der Planungspraxis sehr begrüßenswert. Allerdings bleibt zu prüfen, inwieweit ein solches Screening ohne Bestandsaufnahme der relevanten Schutzgüter erfolgreich sein kann.
In Anlage 1 (Bestandserfassung und Bewertung weiterer Schutzgüter und Funktionen) werden für die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima/Luft die wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeit und Erfassungsparameter aufgenommen. Hierdurch wird zum einen ein Augenmerk auf aktuelle umweltrelevante Probleme (z.B. Treibhausgasemissionen) gelenkt und zum anderen eine Standardisierung der Eingriffsbewertung erreicht. Beim Schutzgut Wasser werden z.B. Wasserentnahmen oder diffuse Einträge in ein Gewässer als wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeiten genannt. Hieraus lässt sich schließen, dass solche Wirkfaktoren erhebliche Beeinträchtigungen und damit Kompensationspflichten auslösen, was bisher häufig kontrovers diskutiert wurde.
3.2 Defizite
Das Ziel, durch die Verordnung einen Beitrag zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme zu leisten, könnte die BKompV in der Fassung des zweiten Entwurfs nur eingeschränkt erreichen. Zwar wird in § 2 Abs. 3 BKompV-E festgelegt, dass bei der Prüfung zumutbarer Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, auch berücksichtigt werden soll, inwieweit diese dazu beitragen, die Inanspruchnahme von Flächen sowohl durch den Eingriff als auch für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu verringern. Die Soll-Vorgaben (§ 2 Abs. 4 BKompV-E), Kompensationsmaßnahmen multifunktional auszugestalten und zur Deckung des Kompensationsbedarfs insbesondere auf bevorratete Kompensationsmaßnahmen nach § 16 BNatSchG sowie Flächen der öffentlichen Hand zurückzugreifen (§ 2 Abs. 5 BKompV-E), dienen jedoch allein dem Ziel, die Flächeninanspruchnahme auf der Kompensationsseite so gering wie möglich zu halten. Der Anspruch, eine Flächenneuinanspruchnahme durch den Eingriff selbst zu verringern, wird nicht weiter aufgegriffen. Der Zusatz in § 2 Abs. 3, dass bei der Prüfung zumutbarer Alternativen auch berücksichtigt werden soll, inwieweit diese dazu beitragen, die Inanspruchnahme von Flächen durch den Eingriff sowie für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu verringern, mag eine rechtliche Konkretisierung darstellen, bedeutet für die gegenwärtige Praxis aber keine Änderung, da Alternativenprüfungen i.d.R. diesem Grundsatz bereits folgen.
Neuversiegelungen des Bodens werden erst ab einer Größe von 300 m2 als erhebliche Beeinträchtigung gewertet. Ein zusätzlicher Kompensationsbedarf über die Biotoptypen hinaus, entsteht erst bei Neuversiegelungen oder Bodenabtrag ab einer Fläche von 10000 m2 (vgl. Anlage 3 BKompV-E). Gerade für kleinere Vorhaben wird sich der Kompensationsbedarf durch diese Regelung verringern. Diese Regelungen bringen praktische Erleichterungen, widersprechen jedoch dem selbst gesteckten Ziel des Verordnungsentwurfs, die Flächeninanspruchnahme grundsätzlich zu minimieren. Auch durch die generelle multifunktionale Anrechenbarkeit erheblicher Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft mit den Kompensationsmaßnahmen für Biotope (§ 8 Abs. 1 BKompV-E) werden sich in vielen Fällen die Anforderungen an die Kompensation verringern. Die Wiederherstellung spezifischer Funktionen findet bei erheblichen Beeinträchtigungen ohne besondere Schwere keine Berücksichtigung mehr, da die Kompensation allein nach dem Biotopwertverfahren ermittelt wird.
Unklar bleibt die Stellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung. Erhebliche Beeinträchtigungen der Biotope sind nach § 7 Abs. 1 BKompV-E ausgeglichen oder ersetzt, wenn im betroffenen Naturraum innerhalb einer angemessenen Frist eine Aufwertung des Naturhaushalts oder Landschaftsbilds erfolgt. Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sowie erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere sonstiger Schutzgüter sind dagegen nach § 8 Abs. 3 und 4 BKompV-E ausgleichbar, wenn die betroffene Funktion (BMU 2013c; zu § 6) innerhalb des vom Eingriff betroffenen Funktionsraums (entsprechend Anlage 5 Abschnitt A Spalte 4) und in einer angemessenen Frist wiederhergestellt werden kann. Sie gelten als ersetzbar, wenn die betroffene Funktion durch Maßnahmen im selben Naturraum und innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt werden kann.
Diese explizite Unterscheidung erweckt den Eindruck, dass die Verordnung Ersatz erst dann vorsieht, wenn Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich sind, was aber im Widerspruch zu § 15 Abs. 2 BNatSchG sowie § 8 Abs. 2 der BKompV-E selbst steht, wonach „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zueinander nicht in einem Vor- und Nachrangverhältnis stehen, sondern gleichrangig sind“ (vgl. auch Bayerischer VGH 2013; Rn. 58 ). Da die Umsetzungsmöglichkeit von Kompensationsmaßnahmen in der Praxis in erster Linie von der Verfügbarkeit geeigneter Flächen abhängt, ist davon auszugehen, dass die räumlichen Anforderungen, die an Ausgleichsmaßnahmen gestellt werden, dazu führen, dass in den meisten Fällen Ersatzmaßnahmen das Mittel der Wahl sein werden, womit sich die Ausführungen in Anlage 5 A Spalte 4 erübrigen würden.
Nach Anlage 3 BKompV-E soll die Feststellung der Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigungen durch die Verschneidung der Bedeutung der Funktionen des jeweiligen Schutzgutes mit der Stärke, Dauer und Reichweite der vorhabenbezogenen Wirkungen erfolgen (s. Tab. 1). Während eine Konkretisierung für die Bewertung der Bedeutung der Schutzgutfunktionen mit Anlage 1 zumindest versucht wird, erfolgt für die Bewertung der zu erwartenden Beeinträchtigungen keine weitere inhaltliche Normierung. In § 4 Abs. 4 BKompV-E wird lediglich für Beeinträchtigungen von Biotopen ausgeführt, dass Versiegelungen zu einer hohen Beeinträchtigung führen. Darüber hinaus gibt es in Anlage 3 konkrete Vorgaben zur Einstufung der Beeinträchtigungen natürlicher Bodenfunktionen. In der Begründung werden als relevante Bewertungskriterien noch der Grad der mechanischen, chemischen und akustischen Einwirkung sowie der zeitliche und räumliche Umfang der Einwirkung genannt.
Ohne eine weitergehende Normierung der Einstufung zu erwartender Beeinträchtigungen nach Stärke, Dauer und Reichweite der Auswirkungen kann eine bundesweit einheitliche und vergleichbare Anwendung der Eingriffsregelung kaum gewährleistet werden. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der entscheidenden Rolle dieser Einstufung für die weitere Kompensationsberechnung, denn je nachdem, ob eine besondere Schwere der erheblichen Beeinträchtigung festgestellt wird, variieren die Anforderungen an Ausgleich und Ersatz beträchtlich. Hier hilft auch die Erläuterung in der Begründung zu § 4 Abs. 4, dass Vorgaben für die Bewertung der Beeinträchtigungsintensität auf normativer Ebene notwendigerweise sehr abstrakt bleiben, wenig weiter. Der in der Begründung vorgeschlagene Leitfaden, in dem zumindest anhand von Beispielen Vorgaben zur Einstufung der Beeinträchtigungen gemacht werden, sollte daher unbedingt vor Inkrafttreten der Verordnung zur Verfügung stehen.
Anlage 2 sieht eine einheitliche Anwendung der Standard-Biotoptypenliste bei der Kartierung im Gelände vor. Dieses wäre jedoch nur mit Hilfe eines differenzierten Kartierschlüssels möglich, der auch regionstypische Besonderheiten berücksichtigen sollte. Als Neuregelung im Vergleich zum ersten Entwurf der BKompV können regionstypische Differenzierungen nach § 4 Abs. 1 durch die Länder ergänzt werden. Auch eine Zuordnung der Biotoptypenlisten der Länder zu den Biotoptypen der Anlage 2 ist nach § 4 Abs. 1 BKompV-E möglich, allerdings ist eine Übertragbarkeit vermutlich nicht in jedem Fall gegeben. Insbesondere die weniger schützenswerten kulturgeprägten Biotoptypen fehlen häufig in den Länderkartierschlüsseln (vgl. Riecken et al. 2006: 49). Dennoch stellen die Neuerungen des zweiten BKompV-E im Vergleich zum ersten Entwurf, insbesondere die Möglichkeit der Berücksichtigung länderspezifischer Besonderheiten und der größere Spielraum bei der Bewertung der Biotoptypen, eine deutliche Verbesserung aus Sicht der Planungspraxis dar.
3.3 Regelungsvorschläge
Die Heterogenität der gesetzlichen und untergesetzlichen Normen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse und Leitfäden, die bisher auf Landes- und kommunaler Ebene, teilweise aber auch auf Bundesebene besteht, wobei z.T. auch sektorale Unterscheidungen gemacht werden (vgl. z.B. ML 2002, MU & NLÖ 2003, NLfS &NLWKN 2006, NLÖ 1994, NLT 2011) führt zwangsläufig zu einer unterschiedlichen Bewertung vergleichbarer Sachverhalte in den Ländern und über Ländergrenzen hinweg. Hierdurch werden insbesondere große Vorhaben, die administrative Grenzen überschreiten, erschwert (BMU 2013b; Gliederungspunkt A.I). Insofern ist der Ansatz einer bundeseinheitlichen Standardisierung und der Definition und Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe aus dem BNatSchG durch die BKompV zu begrüßen. Die Neuerungen, die in den zweiten Entwurf eingebracht wurden, verbessern die Umsetzbarkeit gegenüber dem ersten Entwurf deutlich. Hervorzuheben sind insbesondere die Flexibilisierung bei der Bestandserfassung der verschiedenen Schutzgüter sowie der veränderte Bewertungsrahmen zu den Biotoptypen (Anlage 2).
In jedem Fall sollte vor Inkrafttreten einer bundeseinheitlichen Kompensationsverordnung ein Praxistest erfolgen, bei dem Eingriffsvorhaben unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Umfangs eine konkrete Bewertung erfahren. Durch eine solche Erprobung ließen sich Schwierigkeiten und Widersprüchlichkeiten bei der Umsetzung ermitteln und korrigieren.
Als eine der größten Vollzugsschwächen der Eingriffsregelung wird bezeichnet, dass die tatsächliche Verwirklichung und vor allem auch die dauerhafte Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen nicht angemessen gewährleistet und überwacht wird. Stichprobenartige Untersuchungen zeigen, dass nach wie vor ein bedeutsamer Teil der festgesetzten Maßnahmen gar nicht realisiert wird oder zumindest in seiner Wirkung fragwürdig ist. Fallstudien belegen, dass in einem nicht unerheblichen Umfang Kompensationsmaßnahmen gar nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Und selbst wenn eine Maßnahme wie geplant realisiert wurde, stellt sich die Frage, ob und für wie lange sie die zugedachte Funktion erfüllt oder ob die Fläche nicht über kurz oder lang anderweitig verwertet wird (vgl. z.B. Mayer 2006).
Ein einheitliches und verbindliches Instrumentarium für die Herstellungs-, Funktions- und Sicherungskontrolle von Kompensationsmaßnahmen wäre daher dringend notwendig, findet sich aber im Entwurf der BKompV nicht wieder. Dieses wird z.B. im Entwurf einer bayerischen Kompensationsverordnung (Bay. StMUG 2013), der in § 10 Abs. 2 Satz 3 eine Anzeigepflicht in Bezug auf den Abschluss der Herstellung der Kompensationsmaßnahme und das Erreichen des Entwicklungsziels an die Gestattungsbehörde vorsieht, anders geregelt. Die Neuregelungen des BNatSchG in § 17 Abs. 6 (Erfassung der Flächen in einem Kompensationsflächenkataster) dienen dagegen zunächst allein der Sicherungskontrolle. Herstellungs- und Funktionskontrollen sind nach wie vor gesetzlich nicht geregelt.
Zu § 12 Abs. 1 Satz 2 BKompV-E wäre eine Konkretisierung wünschenswert, da der Nachweis der fehlenden Verfügbarkeit von Grundstücken im betroffenen Naturraum in der aktuellen Praxis immer wieder ein Problem darstellt. Auch wenn hierzu in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 2011) insofern konkretisiert wurde, dass im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung die Suche nach geeigneten Kompensationsflächen zu dokumentieren ist und die Nachfrage bei Gemeinden und Verbänden genüge, bleiben – in Abhängigkeit von der Art der Kompensationsmaßnahmen – in vielen Fällen Unsicherheiten, wann der Nachweis der Nichtverfügbarkeit als abschließend erbracht angesehen werden kann bzw. ob nicht weitere zeitliche und/oder finanzielle Anstrengungen erforderlich wären.
Literatur
Bayerischer VGH (2012): Urteil vom 20. 11. 2012 – 22 A 10.40041.
Bay. StMUG (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (2013): Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung) –BayKompV. Abrufbar unter http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/bay_komp_voindex.htm; zuletzt besucht am 23. 04.2013.
BMU (2013a): Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft; Bundeskompensationsverordnung (BKompV); Entwurf vom 13.04.2013. Abrufbar unter http://www.bmu.de/service/publikationen/downloads/details/artikel/entwurf-verordnung-ueber-die-kom pensation-von-eingriffen-in-natur-und-land schaft-bundeskompensationsverordnung-bkom pv-1; zuletzt besucht am 15.05.2013.
– (2013b): Begründung (Allgemeiner Teil) zum Entwurf einer Bundeskompensationsverordnung (BKompV). Abrufbar unter http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strategien_Bilanzen_Gesetze/Kompensationsver ordnung/entwurf_bkompV_begruendung_all gemeiner_teil_19-04-13_bf.pdf; zuletzt besucht am 15.05.2013.
– (2013c): Begründung (Besonderer Teil) zum Entwurf einer Bundeskompensationsverordnung (BKompV). Abrufbar unter http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strategien_Bilanzen_Gesetze/Kompensationsverord nung/entwurf_bkompV_begruendung_beson derer_teil_19-04-13_bf.pdf; zuletzt besucht am 22.05.2013.
BVerwG (2011): Urteil vom 24.03.2011 – 7 A 3.10.
LANA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung, 1996): Methodik der Eingriffsregelung – Gutachten zur Methodik der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft, zur Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie von Ausgleichszahlungen.
Mayer, F. (2006): Qualitätssicherung in der Eingriffsregelung – Nachkontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. BfN-Skripten 182.
ML (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2002): Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz.
MU & NLÖ (Niedersächsisches Umweltministerium & Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, 2003): Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben.
NLfS &NLWKN (Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr & Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, 2006): Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Bewältigung von Eingriffsfolgen im Fernstraßenbau.
NLÖ (Nieders. Landesamt für Ökologie, 1994): Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung.
NLT (Niedersächsischer Landkreistag, 2011): Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung beim Bau von Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen und Erdkabeln.
Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder E., Ssymank, A. (2006): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Bonn-Bad Godesberg.
Anschrift der Verfasser(innen): Michaela Warnke und Elith Wittrock, Arbeitsgruppe für Regionale Struktur und Umweltforschung (ARSU GmbH), Escherweg 1, D-26121 Oldenburg, E-Mail warnke@arsu.de bzw. wittrock@arsu.de; Dr. Peter Schütte, BBG und Partner Rechtsanwälte, Contrescarpe 75a, D-28195 Bremen, E-Mail schuette@bbgundpartner.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

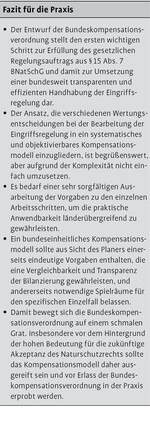
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.