Neue Ansätze digitaler Artenerfassung für den ehrenamtlichen Naturschutz
Abstracts
Die Erfassung von Flora und Fauna durch den ehrenamtlichen Naturschutz befindet sich derzeit im Wandel – sowohl hinsichtlich der Art der Datenaufnahme als auch des anschließenden Datenflusses. Vermehrt sind in den letzten Jahren Web-Portale für die Aufnahme von Beobachtungen bereitgestellt worden. Sie wurden auf Basis von Open-Source-Software wie Datenbankmanagementsystemen und Kartenanwendungen programmiert. Bestimmungshilfen, Artensteckbriefe und Foren ergänzen die Web-Angebote. Die Portale werden von Verbänden und Behörden betrieben, die vermehrt auf die Methode des Citizen Science setzen. Die Methode scheint für eine breite Erfassung von Daten in der Fläche sehr effektiv zu sein. Ein Trend im Bereich der ehrenamtlichen Erfassungstätigkeiten wird durch den Einsatz mobiler Geräte wie Smartphones bestimmt.
Dadurch kann ein effizienter und beschleunigter Datenfluss vom Gelände bis hin zu Verbänden und Naturschutzbehörden erfolgen. Der Beitrag befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen der Datenerfassung durch das Ehrenamt und erläutert die Ergebnisse des Projekts ARDINI. Die im Rahmen des Projekts entwickelte LibellenApp und das WebGIS-Portal eMapper werden vorgestellt. Zudem wird der auf Basis von internationalen Standards hergestellte Datenfluss vom Gelände bis zum NLWKN, wie er in dem Projekt angewendet wurde, erläutert. Es wurden Apps entwickelt, die unabhängig von den aktuell auf dem Markt erfolgreichen Betriebssystemen (iOS/Android) eingesetzt werden können und auf Basis aktueller Techniken der IT-Branche, gerade jungen Menschen, eine Möglichkeit des Einstiegs in das Ehrenamt bieten.
New Approaches for Digital Species Inventories for Honorary Nature Conservation – Results of the development of mobile solutions in Lower Saxony
The collection of data on flora and fauna by honorary nature conservation has been subject of changes in terms of techniques in the field and the flow of data. During the last years web portals have been established supported by open source software including free usable maps and forms for the recording of the observations as well as identification keys, species profiles and internet platforms. The portals are hosted by NGOs and public authorities. The method of Citizen Science seems to be very effective for data collection in a broad geographical range. Voluntary data collection has been additionally facilitated by the use of mobile devices such as smartphones, simplifying data flow from the field to the NGOs or nature conservation authorities.
The paper summarises the current developments of voluntary data collection. It illustrates software developments such as the DragonflyApp (LibellenApp) and the web-based GIS portal eMapper. As an additional example the paper explains the standardized digital flow of data from the field up to the Lower Saxony Water Management, Coastal Defense and Nature Conservation Agency (NLWKN) which has also been implemented within the joint research project ARDINI. The apps have been developed to run on both operating systems (iOS/Android). The application of modern techniques of the IT sector may encourage young people to participate in honorary nature conservation.
- Veröffentlicht am

1 Hintergrund
Die Erfassung und das Monitoring der Biodiversität basieren in Deutschland auf behördlichem Expertenwissen, das sich zu einem großen Teil auf die ehrenamtliche Erfassungsarbeit der Naturschutzverbände im Gelände stützt. 2011 waren in den beiden größten Umweltverbänden Deutschlands, dem Naturschutzbund Deutschland [NABU – rund 460000 (NABU 2012a)] und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland [BUND – ca. 480000 Mitglieder (BUND 2012)] die meisten aktiven Mitglieder organisiert. 37000 NABU-Mitglieder leisteten 2011 drei Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit und sind bundesweit in rund 2000 Gruppen organisiert (NABU 2012a und b). Insgesamt sind in den Verbänden etwa 188000 Mitglieder aktiv in der Datenerfassung tätig (Mitlacher & Schulte 2005). Der amtliche Naturschutz ist ohne ehrenamtliche Helfer nicht mehr vorstellbar (Röscheisen 2000) und ein landesweiter, aktueller Überblick zum Zustand der Arten und deren Vorkommen nur dadurch möglich (NLWKN 2012a).
Jährlich werden bis zu 200000 Artbeobachtungen an die Fachbehörde für Naturschutz im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gemeldet. Die Landesbehörden, deren Aufgabe nach § 12 BNatSchG die Durchführung des Umweltmonitorings ist, sind auf diese Leistungen angewiesen. Beispielsweise können die staatlichen Vogelschutzwarten eine Vogelerfassung im Rahmen ihrer Arbeiten nicht durchführen. Sie verwalten die Daten und nutzen sie für Analysen und Beratungen. Für andere Tiergruppen, wie z.B. Libellen, gehen deutlich weniger Meldungen ein. Den Verbänden und Behörden fehlt es partiell an tierartenspezifischen Kompetenzen für die Aufnahme der Daten und anschließende Plausibilitätskontrollen. Aber auch die Popularität einzelner Tiergruppen und die Schwierigkeiten bei der Bestimmung einzelner Arten sind ausschlaggebend.
Der ehrenamtliche Naturschutz ist heute von Veränderungen betroffen. Die Verbände sind strukturell überaltert. Ein Grund ist der demographische Wandel der Gesellschaft, ein anderer die Tatsache, dass sich junge Menschen von der mit großer Kontinuität verbundenen Arbeit oft nicht angezogen fühlen. Junge Menschen bevorzugen Projekte, Aktionen und Events, insbesondere wenn neue Medien eingesetzt werden (Caspari 2011). Zudem wollen sie jederzeit mit ihren Freunden über Smartphones und Tablets vernetzt sein. Das Ausfüllen sowie der Postversand von analogen Meldebögen, die auf den Webseiten der Behörden (z.B. NLWKN) heruntergeladen werden können, entspricht nicht den Trends des IT-Marktes. Probleme sind aber auch darin zu sehen, dass die naturkundliche Bildung in der Schule nicht über den Biologieunterricht hinaus geht, aber eine Basis der ehrenamtlichen Arbeit im Naturschutz darstellt.
Abgesehen von den Methoden der Datenverarbeitung gewährleisten einheitliche tierartenspezifische Erfassungsmethoden die Vergleichbarkeit der Daten. Monitoring-Programme mit entsprechenden Standards existieren auf Landes- und Bundesebene mit gezielter Ausrichtung auf spezielle Tiergruppen (z.B. AK Libellen NRW 1996, NLWKN 2012b, Tagfalter-Monitoring Deutschland 2012). Jedoch gibt es zwischen den Bundesländern tierartenübergreifend Unterschiede in Methoden und Umfang der zu erfassenden Daten. Für eine Beurteilung des Zustands und der Verbreitung von Arten können bei ehrenamtlich erhobenen Daten länderübergreifend immer nur Schnittmengen dieser genutzt werden. Anders verhält es sich bei behördlichen Erfassungstätigkeiten, die z.B. im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie und des Netzwerks Natura 2000 stattfinden. Hier gelten einheitliche Standards und Konzepte für das Monitoring (vgl. Sachteleben & Behrens 2010).
Trends
In den letzten Jahren wurden erste auf Geoinformationssystemen (GIS) gestützte Artenerfassungsprogramme entwickelt, zu denen sowohl Desktop-Anwendungen (z.B. Multibase CS) als auch WebGIS-gestützte Lösungen gehören (vgl. Lipski et al. 2010). Mit dem Einsatz von GIS können räumliche Daten standardisiert zusammengeführt, fortgeschrieben und ausgetauscht werden. Mit dem Internet und Web-Mapping-Systemen setzte eine weitere Verbreitung der Nutzung von Geodaten ein (Reichenbacher 2001). Im Naturschutz findet der Einsatz von GIS unter anderem beim Umweltmonitoring sowie bei Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und im Flächenmanagement statt (Walz & Wagenknecht 2010). Erfolgt die Digitalisierung von Artenfunden bis heute vor allem an Desktop-GIS, nachdem die Meldungen bei der Behörde eingegangen sind und einer Kontrolle unterzogen wurden, so liegt es daran, dass es kaum eine Möglichkeit des webbasierten Datenimports gibt. Auch werden noch zu selten GIS aufseiten der Verbände genutzt, um Daten digital aufzubereiten. Für eine effektive Einbindung der Daten in behördliche GIS müssen deshalb geeignete Softwareprodukte zur Verfügung gestellt werden, die anerkannte Schnittstellen und Hilfestellungen bieten.
Im Bereich der webbasierten Datenerfassung sind einzelne Verbände vielen Behörden um technische Entwicklungsschritte voraus. Sie bieten ihren Mitgliedern eigene Portale für die Eingabe von Beobachtungen an. Nach Hoppe (2012) sollen bereits 40 Web-Portale in Deutschland aktiv sein, die sich mit dem Thema Artenerfassung oder deren Bestimmung befassen. Die Portale konzentrieren sich zum Teil auf einzelne Tiergruppen, Pflanzen oder Pilze. Sie erlauben die Eingabe von Funden z.B. über enthaltene Artenlisten oder freie Dateneingaben und bieten speziell angepasste Formulare an (z.B. http://www.ornitho.de, http://www.naturgucker.de, http://www.tagfalter-monitoring.de, http://www.artenfinder.de, http://www.science4you.org ). Diese sind je nach Erfahrungsstand auszufüllen und enthalten optionale Eingabefelder. Verbände wie der NABU-Regionalverband Hannover setzen WebGIS-Portale wie den eMapper für die Artenerfassung ein. Die Formulare richten sich hier nach den Standards der Meldebögen des NLWKN (Rüter et al. 2010).
Speziell für Behörden wurden im Rahmen des Umweltmonitorings bereits ähnliche Systeme, wie das Moos-Monitoring zum Schwermetallgehalt in Moosproben in Deutschland oder das WebGIS WaldIS als ein Referenzdatensystem für das Forst-Monitoring entwickelt und getestet. Hier wurden Standards des Open Geospatial Consortiums (OGC) für die Aufnahme, Speicherung, Visualisierung und Verarbeitung der Daten genutzt (Aden et al. 2010, Kleppin et al. 2008, Schmidt et al. 2010). Solche Standards eignen sich besonders für die Vernetzung von Geodaten, wie es auch mit der EU-Richtlinie Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) umgesetzt wird (EC 2007). Dadurch wird ein auf einheitlichen Datenmodellen basierendes Umweltmonitoring ermöglicht.
Ein Trend geht derzeit in Richtung mobiler Lösungen für die Erfassung von Daten. Neben Web-Portalen werden teilweise kostenlose Anwendungen (Apps) für den Einsatz auf Smartphones und Tablets bereitgestellt. Sie bilden die Formulare der Web-Portale ab. Der Artenfinder ( http://www.artenfinder.de ) ist eine der bekannteren Anwendungen. Die App wird für iOS und Android bereitgestellt. Das System wird von der Koordinierungsstelle für Naturschutz und dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF) in Rheinland-Pfalz betrieben (KoNat 2012). Inzwischen hat auch die Naturschutzbehörde in Nordrhein-Westfalen eine Schnittstelle für den Artenfinder eingerichtet. Die App erlaubt die Erfassung von Arten und deren Verhalten sowie das hinzufügen von Fotos. Den Nutzern steht nach der Datenaufnahme ein Web-Portal für die kartographische Darstellung und Verwaltung der Datensätze zur Verfügung, über das auch die Anbindung an die Datenbanken der Behörde erfolgt. Regionale Experten kontrollieren die gesammelten Informationen, um sie anschließend als amtliche Daten nutzen zu können.
Ein weiteres Beispiel, das jedoch nicht im Zusammenhang mit Behörden steht, ist die App „Animals & Plants“ (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.anymals.anymallog). Diese war aufgrund der Benutzerführung und fehlender Kontrollen jedoch schon vielen Kritiken ausgesetzt. Ein Blick auf die Nutzungsstatistiken von Betriebssystemen bei der mobilen Internetnutzung zeigt, dass über 50 % über Android (26,5 %) und iOS (25,4 %) erfolgten (Stand: Juli 2012, Statista 2012), und erklärt damit auch die Herstellung von Apps für diese Systeme.
Citizen Science
Schon seit mehreren Jahren werden Bürger dazu eingeladen, an webbasierten Datenerfassungen zu bestimmten Tiergruppen oder einzelnen Arten teilzunehmen, wie es auch bei Aktionen wie „Stunde der Garten- bzw. Wintervögel“ ( http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/stundedergartenvoegel/ ) vom NABU praktiziert wird. Solche Programme sind in der Lage, Daten von Tausenden von Standorten zu erfassen, während wissenschaftliche Studien oft nur einige Hundert Standorte untersuchen können (Losey et al. 2007). Viele dieser Programme erlauben auch das Monitoring einer größeren Anzahl an Spezies über große geographische Ausdehnungen mit dem Ziel, die Daten für ein weites Feld an Fragestellungen zu nutzen (Dickinson et al. 2010). Beispiele sind die Erfassungen von invasiven Arten wie Bienen in Australien (Ashcroft et al. 2012) oder bedrohter und vermisster Tierarten wie dem Neun-Punkt-Marienkäfer (Losey et al. 2007). Mit dem Programm Journey North wurden die Flugrouten des Monarchfalters während der Herbstwanderung von Nordamerika nach Mexiko anhand der nächtlichen Rastplätze durch Anwohner verfolgt (Howard & Davis 2009).
Die Qualität der mit solchen Methoden erfassten Daten wurde von Beaubien & Hamann (2011) im Rahmen des Alberta and Canada PlantWatch Program untersucht. Dabei wurden die Erfassungsmethoden und die phänologischen Aufnahmen aus neun Monitoring-Jahren herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl artenspezifisches Training und Erfahrung als auch die dauerhafte Bindung der Ehrenamtlichen an das Programm wesentliche Faktoren sind. Darüber hinaus sind Koordinatoren, die sowohl die Ansprüche und Bedürfnisse der Interessierten identifizieren als auch Rückmeldungen und eine Art Honorierung geleisteter Arbeit bieten, wichtig (Beaubien & Hamann 2011).
Gründe für ein ehrenamtliches Engagement im Bereich des Artenmonitorings sind vielfältig. Nach Bell et al. (2008) sind es das Draußensein in der Natur, der Austausch und das Miteinander gleichgesinnter Menschen sowie die Möglichkeit, Neues zu lernen. Die Nutzung und Mitarbeit bei webbasierten standortbezogenen Erfassungen, auch „Volunteer Geography“ genannt, ermöglicht es, Informationen für Freunde und Gleichgesinnte erreichbar zu machen, unabhängig von der Tatsache, dass sie schlussendlich für alle einsehbar sind. Das erklärt die Popularität von Webseiten wie Picasa, Flickr oder Wikimapia (Goodchild 2007), aber auch von Projekten wie OpenStreetMap (OSM).
Bestimmungshilfen
Auch wenn digitale Hilfen aufgrund der Komplexität teilweise nur schwer im Gelände nutzbar sind, werden derzeit Vorhaben realisiert, die eine Bestimmung von Tier- und Pflanzenarten unterstützen oder Informationen in Form von Steckbriefen anbieten. Ein Beispiel ist der Online-Vogelführer, der durch den NABU entwickelt wurde und inzwischen als App zur Verfügung steht. Zusammen mit dem Kosmos-Verlag erarbeitete der NABU außerdem die iKosmos Apps, bei denen es sich um kostenpflichtige Bestimmungshilfen für Sträucher, Bäume, Muscheln und Schnecken handelt. Das Portal offene-naturführer.de, das im Rahmen des Projekts Key2Nature entwickelt wurde und auf Basis einer Art Wiki das Anlegen von Bestimmungshilfen für Pflanzen und Tiere erlaubt, soll ebenfalls als App umgesetzt werden. Zudem wurden Lehrmedien, wie z.B. das Moor Buch, als App entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Offline-Webseite für Personal Digital Assistants (PDA), die allgemeine Informationen zum Thema Moore bereitstellt (Fiene et al. 2011).
Die aktuell eingesetzten Apps und Portale zeigen zwar Erfolge bei den Nutzerzahlen, unterstützen aber nicht in allen Fällen den gesamten Erfassungsprozess von der Feldarbeit bis zur Verarbeitung der Daten von Naturschutzbehörden. Dabei muss auch gefragt werden, ob dieses von den jeweiligen Betreibern gewollt ist. Beispielsweise wird das Web-Portal ornitho.de durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. (DDA) betrieben. Der DDA wiederum arbeitet zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz am Monitoring im Rahmen der Vogelschutz-Richtlinie (EU-Richtlinie 79/409/EWG). Der Artenfinder in Rheinland-Pfalz wurde vor allem zu dem Zweck entwickelt, die Fachbehörden mit aktuellen Daten auszustatten. Hier wurden Standards des OGC beachtet. Jedoch lassen viele andere Entwicklungen Brüche in der Datenübertragung und Bearbeitung zu (z.B. Datenformate, Projektionen, Meldestandards) – und werden zu einem Teil nur mit kostenpflichtigen Spezialgeräten (z.B. Ornilogger) ermöglicht, die keine weitere Nutzung im Alltag erlauben. Mobile Lösungen, die an Standards der Landesbehörden zur Erfassung von Arten angepasst sind (z.B. NLWKN-Meldebögen), den Erfassungsmethoden im Gelände entsprechen und auf Standards des OGC und der ISO basierende Verwaltungs-, Visualisierungs- und Export-Werkzeuge für die Daten und damit eine der effektivsten Möglichkeiten der ehrenamtlichen Artenerfassung bereitstellen würden, gibt es bisher kaum und vor allem nicht in Form frei erhältlicher Software mit zugänglichem Quellcode.
In dem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt ARDINI wurde nun die Erfassung von Arten am Beispiel von Vögeln und Libellen mit Hilfe von Smartphones unter Beachtung genannter Standards erprobt. Das Projekt wurde in Kooperation der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, der Jade Hochschule, dem NABU Oldenburg, BIOSYS e.V. und der Firma IP SYSCON GmbH durchgeführt. Die Ergebnisse des Projekts werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.
2 Das Projekt ARDINI
Eine effektive Zusammenarbeit von ehrenamtlichen Kräften und Fachbehörden setzt voraus, dass entsprechende Software sowie spezifische Hilfestellungen und Vorgaben zur Erstellung, Aufbereitung und Weitergabe der Umweltfachdaten zur Verfügung gestellt werden. Mit ARDINI wurde erstmals eine IT-Infrastruktur entwickelt, die es dem ehrenamtlichen Naturschutz in leichter und zuverlässiger Weise ermöglicht, Libellen und Vögel mithilfe mobiler Endgeräte dezentral und auf Plausibilität geprüft zu erfassen, unterstützt durch Bestimmungshilfen und Artensteckbriefe. Die Daten werden mithilfe des WebGIS-Portals eMapper gespeichert, visualisiert und ausgewertet. Entsprechende Schnittstellen erlauben den Export der Daten an das NLWKN.
Mobile Apps
Smartphones sind Mobiltelefone, die mit leistungsfähiger Hardware ausgestattet sind und so Aufgaben übernehmen können, die früher einem PDA vorbehalten waren. Durch die Einführung des Apple iPhone im Jahr 2007 sind Smartphones für eine breite Masse von Anwendern interessant geworden. Sie besitzen ein intuitives Bedienkonzept, das auf der Verwendung von Gesten beruht, die auf einem Touchscreen ausgeführt werden. Der Funktionsumfang eines Smartphones lässt sich durch Apps erweitern. Dabei unterscheiden sich je nach verwendetem Betriebssystem die Möglichkeiten, eigene Anwendungen zu entwickeln und auf einem Gerät zu installieren. Die Betriebssystemhersteller bieten für die Anwendungsentwicklung Software Development Kits (SDK) an, mit denen die Hardware der Geräte angesprochen und Anwendungsoberflächen gestaltet werden können. Für die derzeit stark verbreiteten Plattformen werden die SDKs z.B. in Java für Android (DevAndroid 2012) und ObjectiveC für iOS (DevApple 2012) angeboten. Die damit entwickelten Anwendungen werden als native Apps bezeichnet und können den gesamten Funktionsumfang eines Smartphones nutzen. So lassen sich z.B. Daten auf dem Gerät speichern, Fotos aufnehmen, Kontaktdaten bearbeiten oder GPS-Koordinaten abfragen.
Die Entwicklung einer App für die genannten Betriebssysteme unterscheidet sich durch die vorgegebene Programmiersprache. Dadurch gibt es keine Möglichkeit, eine native App für beide Systeme zu entwickeln. Soll eine App auf mehreren Systemen eingesetzt werden, bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand. Um diesen zu umgehen, werden Apps vermehrt mit bekannten webbasierten Techniken hergestellt. Sie ahmen das Aussehen und Verhalten von nativen Anwendungen nach und werden als WebApps bezeichnet. WebApps können mit den auf iOS- bzw. Android-Smartphones vorhandenen Webbrowsern genutzt werden (vgl. Mühlichen 2012). Die im Rahmen des Projekts entwickelten Apps sind als WebApps hinsichtlich der Betriebssysteme (iOS/Android) und der eingesetzten Geräte (Smartphones und Tablets) in der gleichen Weise nutzbar.
eMapper
Das WebGIS-Portal eMapper (Abb. 1) gewährleistet auf der Grundlage einer standardisierten, digitalen Erfassung und Dokumentation planungsrelevanter Geofachdaten einen interoperablen OGC konformen Datenaustausch. Den Kern des eMappers stellt eine WebGIS-Komponente dar, bestehend aus dem Datenbankmanagementsystem PostgreSQL/PostGIS, dem GeoServer für die Bereitstellung von Karten und dem Map Client OpenLayers.
Über Formulare können ehrenamtlich Kartierende ihre erfassten Daten von jedem beliebigen Rechner mit Internetzugang eingeben und verwalten. Zusätzliche Geodaten wie Luftbilder oder Biotopkartierungen können als Web Map Services (WMS) bzw. Web Feature Services (WFS) in das WebGIS integriert werden. Für die Auswertung der erfassten Artenfunde stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Die Ergebnisse werden tabellarisch sowie in Form von Karten dargestellt und können exportiert werden.
Ein Nutzer- und Zugriffsmanagement ermöglicht es, Mitarbeitende nach fachlichen oder räumlichen Kriterien in Nutzergruppen mit individuellen Zugriffsrechten einzuteilen. Der Nutzer kann ebenfalls Rechte für seine Daten vergeben und so eine Verwendung dieser durch Verbände oder Behörden ermöglichen, wie auch Informationen anderer Kartierender in die eigene Erhebung einbinden.
Infrastruktur und Software
Die Systemarchitektur beinhaltet Schnittstellen zwischen den entwickelten ARDINI-Apps und dem eMapper. Der Datenfluss aus dem Gelände zum eMapper und von dort zu den Naturschutzverbänden und -behörden ist in Abb. 2 dargestellt.
Bei der Entwicklung des Systems wurden ausschließlich kostenlose Softwareprodukte genutzt, die unter Open-Source-Lizenzen zur Verfügung stehen.
Zu erfassende Parameter der Libellenbeobachtungen orientieren sich an den vorhandenen Erfassungsstandards, die in NLWKN-Meldebögen verwendet und in einschlägiger Literatur nach Sternberg (1999), Siedler (1992) und AK Libellen NRW (1996) genannt werden.
3 Erfassung von Libellendaten als Beispiel
Für die Umsetzung der LibellenApp wurden die gängigen Arbeitsschritte einer Libellenerfassung dokumentiert und neue Wege mit der Nutzung von Smartphones und Tablets erarbeitet. Dem angepassten Arbeitsablauf entsprechend muss der Nutzer die WebApp herunterladen und auf dem Smartphone speichern. Damit sind alle für die Bestimmung und Aufnahme von Libellendaten erforderlichen Informationen vorhanden. Die Karten für das Begehungsgebiet können über die App zusätzlich geladen werden. So können sie offline genutzt werden. Dafür wird die Ausdehnung des Areals über Zoomstufen gewählt und das Kartenmaterial auf dem Smartphone gespeichert. Die Nutzungseinschränkungen bei schwankender UMTS- bzw. GPRS-Verfügbarkeit werden damit umgangen.
Die Dateneingabe und -weiterleitung ist in vier aufeinander aufbauende Schritte unterteilt (Abb. 3):
Anlegen eines Gebiets für die Erfassung,
Anlegen von Erfassungsterminen zu einem Erfassungsgebiet,
Eingeben von Beobachtungen zu einem Erfassungstermin,
Senden der Daten an den eMapper.
Das Anlegen eines Erfassungsgebiets erfolgt mit dem eMapper am PC. Mit der LibellenApp wird das besuchte Gewässer im Gelände beschrieben. Hier erfolgt die Angabe von Pflicht- und optionalen Hintergrundinformationen (z.B. Gewässertyp, Vegetation). Für das Erfassungsgebiet legt der Nutzer einen Erfassungstermin mit dem aktuellen Datum an. Zu jedem Termin können dann beliebig viele Beobachtungen mit Angaben zu Art, Anzahl und Verhalten sowie weitere standardisierte Parameter und Bemerkungen über Formulare und Auswahllisten eingegeben werden. Die Eingabe des Standortes erfolgt auf Basis der im Vorfeld heruntergeladenen Karten mithilfe des GPS-Moduls des Smartphones. Schon während der Eingabe werden die Daten auf ihre Plausibilität hin geprüft. Dafür werden Daten zu Flugzeit, Häufigkeit und Verbreitung der betreffenden Art sowie zum Lebensraum aus den Artensteckbriefen abgerufen und über eine Verknüpfung zu den erfassten Daten in Echtzeit überprüft. Darüber hinaus werden Verwechslungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Für weniger erfahrene Anwender stehen digitale Bestimmungshilfen zur Verfügung. Zu jeder Art kann ein Steckbrief mit relevanten Bestimmungsmerkmalen, leicht verwechselbaren Arten und Angaben zum Lebensraum sowie Fotos aufgerufen werden. Für die Projektlaufzeit konnte darüber hinaus der dichotome Libellenbestimmungsschlüssel für Norddeutschland nach Glitz (2012) in digitalisierter Form verwendet werden.
Die erfassten und kontrollierten Daten können nach der Speicherung jederzeit, abhängig von der Netzverfügbarkeit, an den eMapper gesendet und vom Nutzer am eigenen PC verwaltet werden.
Integration des eMappers
Um den eMapper in die ARDINI-Infrastruktur einzubinden, wurden Erweiterungen der Datenbanken und der Webservices durchgeführt. Funktionen wie das Erstellen von Projekten und Projektgebieten erlauben das Verknüpfen von Nutzern des Portals z.B. zu bestimmten Untersuchungen. Wichtig sind aber vor allem die Schnittstellen für den Import der Datenpakete von den Smartphones an den eMapper, die mit der Geography Markup Language (GML) umgesetzt wurden. Alle erfassten Daten können nach dem Import vollständig oder gefiltert im eMapper betrachtet werden (Abb. 4). Filter für die Datensuche und Auswertung sollen die Bestimmung bodenständiger Libellenarten für einzelne Beobachtungsgebiete unterstützen.
Über einen Filter können Projektgebiet und Erfassungszeitraum festgelegt werden. Tabellarisch werden einerseits die Anzahl und das Verhalten für alle im Projektgebiet vorkommenden Arten des angegebenen Zeitraums dargestellt, andererseits wird eine weitere Tabelle angeboten, die Daten der einzelnen Begehungen aggregiert (Abb. 5). Die jeweiligen Daten können im Anschluss im Format von MS Excel und als Shapefile exportiert werden.
Für den Versand der erfassten Daten an den NLWKN wurde eine Exportschnittstelle auf Basis des GML-Standards entworfen. Auf Seiten des NLWKN wird aktuell eine entsprechende Importschnittstelle eingerichtet, die eine Integration der Daten in die dortigen Geodatenbanken erlaubt. Mit dem sich noch im Aufbau befindenden Umweltinformationssystem des NLWKN werden die geprüften Daten wiederum für die Öffentlichkeit bereitgestellt.
Testphasen
Geländetests sind mit der LibellenApp in den Sommermonaten 2011 und 2012 von Laien sowie erfahrenen Libellenkartierern durchgeführt worden. Beachtung fanden dabei die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der LibellenApp. Obwohl die Tester überwiegend keine Smartphones besaßen, fanden sie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell in der Anwendung zurecht. Im Rahmen einer ausführlichen Evaluation wurden positive und negative Kritiken ausgetauscht und Verbesserungsvorschläge diskutiert. Dabei zeigte sich, dass eine Libellenerfassung in dieser mobilen Art akzeptiert und gerne durchgeführt wurde sowie der Ablauf der Erfassung dem tatsächlichen Vorgang entspricht. Als sehr positiv wurde vor allem die Zeitersparnis bei der Digitalisierung der Meldebögen und Standorte bewertet sowie die Möglichkeit der Orientierung im Gelände. Leichte technische Unsicherheiten gab es bei der punktgenauen Darstellung des Standortes, je nachdem, ob die Position per Mobilfunknetz berechnet oder das GPS-Modul nach einem „Kaltstart“ genutzt wurde. Mit einer manuellen Digitalisierung des Punktes in der Karte kann dieses jedoch umgangen werden.
Als problematisch in der Handhabung der Smartphones stellte sich die Reflektion des Sonnenlichts auf dem Touchscreen dar, so dass es zu Schwierigkeiten bei der Nutzung kam. Probleme mit der Akkulaufzeit, bedingt durch den dauerhaften GPS-Einsatz, können durch zusätzliche Akku-Packs behoben werden.
4 Weiterentwicklungen und Implementierung
In Zukunft zu erarbeitende digitale Methoden werden die Arbeit im Gelände weiter beschleunigen. Spracheingaben (heute noch per Diktiergerät), aber auch bioakustische Aufnahmemethoden sowie deren automatische Aufbereitung durch Apps bzw. serverbasierte Software können eine weitere Hilfe bei der Artenerfassung sein.
Zusätzliche OGC-Standards wie Web Processing Services könnten aufbauend auf den eingehenden Daten eingerichtet werden, um statistische und geostatistische Analysen und die Herstellung von Karten zur Verbreitung sowie die Darstellung von Bestandsveränderungen zu vereinheitlichen. Grundlage dafür sind jedoch flächendeckend eingesetzte und standardisierte Datenmodelle für die Artenerfassung. Beachtung sollten daher bei allen zukünftigen Entwicklungen die OGC-Standards finden. Sie erlauben die interoperable Vernetzung der Daten im Sinne von INSPIRE und sollten schon bei der Aufnahme von Daten im Gelände genutzt werden.
Dank
Diese Arbeit ist im Rahmen des Forschungsprojekts „Entwicklung und Erprobung eines Systems von dezentralen mobilen Erfassungsgeräten und zentralen GIS-Anwendungen zur Steigerung von Qualität, Effizienz und Attraktivität der ehrenamtlichen Artenerfassung im Gelände – Artenerfassung digital in Niedersachsen (ARDINI)“ entstanden und mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert worden. Die Autoren bedanken sich bei den ehrenamtlichen Testern, den Studenten und Kooperationspartnern für ihre Mitarbeit und die ausführlichen und konstruktiven Hinweise, die zu einem erfolgreichen Abschluss des Projekts beigetragen haben.
Literatur
Aden, C., Schmidt, G., Schönrock, S., Schröder, W. (2010): Data analyses with the WebGIS WaldIS. European Journal of Forest Research 129 (3), 489-497.
AK Libellen NRW (Arbeitskreis zum Schutz und zur Kartierung der Libellen in Nordrhein-Westfalen, 1996): Erläuterungen zur Erfassung der Libellen (Odonata) in Nordrhein-Westfalen. http://www.ak-libellen-nrw.de/Download/Kartieranleitung.pdf (Stand: 27.03.2012).
Ashcroft, M.B., Gollan, J.R., Batley, M. (2012): Combining citizen science, bioclimatic envelope models and observed habitat preferences to determine the distribution of an inconspicuous, recently detected introduced bee (Halictus smaragdulus Vachal Hymenoptera: Halictidae) in Australia. Biological Invasions 14, 515-527.
Beaubien, E.G., Hamann, A. (2011): Plant phenology networks of citizen scientists: recommendations from two decades of experience in Canada. International Journal of Biometeorology 55, 833-841.
Bell, S., Marzano, M., Cent, J., Kobierska, H., Podjed, D., Vandzinskaite, D., Reinert, H., Armaitiene, A., Grodzinska-Jurczak, M., Mursic, R. (2008): What counts? Volunteers and their organisations in the recording and monitoring of biodiversity’. Biodiversity and Conservation 17, 3443-3454.
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 2012): Spendenservice. http://www.bund.net/service/mitglieder_spenderservice/ (Stand: 24.07.2012).
Caspari, S. (2011): Viele Wege führen zur Natur. Begeisterung wecken durch cross over-Motivation. Vortrag beim Dialogforum Ehrenamt am 18.02.2011 in Bonn. http://www.biologischevielfalt.de/fileadmin/NBS/documents/Dialogforen/DF_Ehrenamt/Caspari_BioDok_Saarland.pdf (Stand 18.04.2011).
DevAndroid (2012): API Guides – Application Fundamentals. http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html (Stand: 26.09.2012).
DevApple (2012): iOS Developer Library – Start Developing iOS Apps Today. https://developer.apple.com/library/ios/#referencelibrary/GettingStarted/RoadMapiOS/chapters/Introduction.html (Stand: 26.09.2012).
Dickinson, J.L., Zuckerberg, B., Bonter, D.N. (2010): Citizen science as an ecological research tool: challenges and benefits. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 41, 149-172.
EC (European Community, 2007): Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007, establishing an Infrastructure for the Spatial Information in the European Community (INSPIRE). Official Journal of the European Union L 108, 25/04/2007, 1-14.
Fiene, C., Michel, U., Plass, C. (2011): Lernen und Forschen im Moor – Entwicklung eines Moorinformationssystems für eine nachhaltige Umweltbildung. In: Strobl, J., Blaschke, T., Griesebner, G., Hrsg., Angewandte Geoinformatik 2011, Wichmann, Heidelberg, 548-556.
Goodchild, M.F. (2007): Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal 69 (4), 211-221.
Hoppe, A. (2012): Neue Lösungen zur Datenerfassung im ehrenamtlichen Naturschutz: Ersatz, Transformation oder Ergänzung „alter Tugenden“? In: Frohn, H.-W., Rosebrock, J., Bearb., Ehrenamtliche Kartierungen für den Naturschutz – Historische Analysen, aktuelle Situation und Zukunftspotenziale, Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 243-271.
Howard, E., Davis, A.K. (2009): The fall migration flyways of monarch butterflies in eastern North America revealed by citizen scientists. Journal of Insect Conservation 13, 279-286.
Kleppin, L., Schröder, W., Pesch, R., Schmidt, G. (2008): Entwicklung und Erprobung einer Metadaten- und WebGIS-Applikation für das Expositionsmonitoring mit Moosen in Deutschland. Ein Beitrag zum LTER-Netzwerk. Umweltwissenschaften und Schadstoffforschung – Zeitschrift für Umweltchemie und Ökotoxikologie 20, 38-48.
KoNat (2012): Artenfinder in Rheinland-Pfalz. http://artenfinder.de/index.php/rlp-projekt.html (Stand: 27.07.2012).
Lipski, A., Rüter, S., Ruschkowski, E.v., Hachmann, R. (2010): Digitale Artenerfassung im ehrenamtlichen Naturschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (8), 235-242.
Losey, J.E., Perlman, J.E., Hoebeke, E.R. (2007): Citizen Scientist rediscovers rare nine-spotted lady beetle, Coccinella novemnotata, in eastern North America. Journal of Insect Conservation 11, 415-417.
Mühlichen, T. (2012): Einsatz von HTML5 mit jQuery Mobile. iX kompakt Webdesign 2/2012, 156-160.
NABU (2012a): NABU Jahresbericht 2011. http://imperia.verbandsnetz.nabu.de/imperia/md/content/nabude/nabu/nabu_jb11.pdf (Stand: 25.02.2012).
– (2012b): Im NABU aktiv werden! Web: http:// http://www.nabu.de/spendenundhelfen/aktivwerden/ (Stand: 24.07.2012).
NLWKN (2012a): Die Erfassungsprogramme. Wie funktionieren die Erfassungsprogramme? http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8369&article_id=38814&_psmand=26 (Stand 27.03.2012).
– (2012b): Arten brauchen Daten. Erfassung von Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen. http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8076&article_id=39236&_psmand=26 (Stand: 27.03.2012).
Reichenbacher, T. (2001): Adaptive concepts for a mobile cartography. Journal of Geographical Sciences, 43-53.
Röscheisen, H. (2000): Die organisatorische Struktur des Naturschutzes. In: Lippert, A., Hrsg., Der Naturschutzhelfer, Lausitzer Druck und Verlagshaus GmbH Bautzen, Bonn, 29ff.
Rüter, S., Hachmann, R., Krohn-Grimberghe, S., Laske, D., Lipski, A., Ruschkowski, E.v. (2010): GIS gestütztes Gebietsmonitoring im ehrenamtlichen Naturschutz. Grasdorfer Naturschutzberichte 2, ibidem, Stuttgart.
Sachteleben, J., Behrens, M. (2010): Konzept zum Monitoring des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. BfN-Skripten 278, Bonn.
Schmidt, G., Aden, C., Kleppin, L., Pesch, R., Schröder, W. (2010): Integration of long-term environmental data by the example of the UNECE Heavy Metals in Mosses Survey in Germany: Application of a WebGIS-based metadata system. In: Müller, F., Klotz, S., Schubert, H., eds., Long-Term Ecological Research – Between Theory and Application (Part 5), Springer, Berlin, 299-313.
Siedler, K. (1992): Libellen. Eignung und Methoden. In: Trautner, J., Hrsg., Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tiergruppen. Ökologie in Forschung und Anwendung 5, J. Margraf, Weikersheim, 97-110.
Statista (2012): Global market share of mobile operating systems 2009-2012. http://www.statista.com/statistics/184335/market-shares-of-mobile-operating-systems-worldwide-since-2009/ (Stand: 13.08.2012).
Sternberg, K. (1999): Erfassungsmethodik und Kartierung. In: Sternberg, K., Buchwald, R., Hrsg., Die Libellen Baden-Württembergs 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera), Ulmer, Stuttgart, 27-35.
Tagfalter-Monitoring Deutschland (2012): Methode. Transekt-Erfassung. http://www.tagfalter-monitoring.de/ (Stand 27.03.2012).
Walz, U., Wagenknecht, S. (2010): Stand und Trends des Einsatzes von GIS in Schutzgebietsverwaltungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (6), 188-192.
Anschrift der Verfasser(in): Dipl.-Umweltwiss. Christian Aden und Dipl.-Landschaftsökol. Friederike Kastner, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, Ammerländer Heerstraße 114-118, D-26129 Oldenburg, E-Mail christian.aden@uni-oldenburg.de bzw. friederike.kastner@uni-oldenburg.de; Jan Loesbrock, M.Sc., Jade Hochschule Oldenburg, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik, Ofener Straße 16-19, D-26121 Oldenburg; Dipl.-Ing. Sebastian Krohn-Grimberghe, IP SYSCON GmbH, Tiestestraße 16-18, D-30171 Hannover.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen





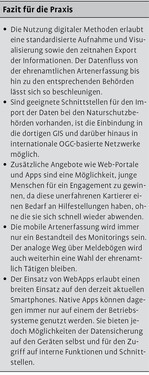
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.