Naturbild in den Medien
Die Frage, wie Film und Fernsehen Natur und Landschaft der Öffentlichkeit präsentieren und was sie damit bewirken, wurde von Wissenschaftlern und Medienleuten im November 2011 bei einer Tagung in Mainz erörtert. Der Schwerpunkt lag dabei auf Mediengeographie.
- Veröffentlicht am
Von Barbara Froehlich-Schmitt
Ulrike Höfken, grüne Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, eröffnete die Tagung, die in Zusammenarbeit von Land, Johannes Gutenberg-Universität und Bundesverband Beruflicher Naturschutz (BBN) in Mainz veranstaltet wurde, mit einer Metapher wie aus einem Film: ihr begeisterter Blick aus dem Zugfenster in das vorbeiziehende Mittelrheintal.
Anton Escher, Professor für Kulturgeographie in Mainz, begann mit der Ideengeschichte von Natur, die von magisch-religiösen über mechanische bis zu kulturellen Konstrukten reiche. Der Philosoph Hans Blumenberg habe den Menschen über sein Verhältnis zur Natur definiert, Martin Heidegger darüber, dass die Welt zum Bild werde und so zur Weltanschauung. Am Beispiel des erfolgreichen Kinofilms „Avatar“ beschrieb Escher die Wirkung dieses Science-Fictions über den Reiz der computeranimierten exotischen Welt des Urvolks der „Navi“ auf dem Mond Pandora, die ihr reales Vorbild im tropischen Regenwald habe. Der Papst habe den Film kritisiert, weil er Natur vergöttere. Dagegen habe man in China aus touristischen Gründen Berge umbenannt. Palästinenser seien als blaue Navi verkleidet aufgetreten. Escher schloss provozierend: Fakt sei, dass Filme wie „We feed the world“ wütend machten, aber keinen Spaß. Märchen wie Avatar würden „funktionieren“.
Karl Nikolaus Renner, Professor für Journalismus in Mainz, verglich zwei TV-Dokumentarfilme über die Berchtesgadener Alpen. Der Film „Sommer auf der Reiteralm“ zeige mit Hilfe von Interviews das emphatische Leben einer Bauernfamilie bzw. die Konstruktion einer Kulturlandschaft, die durch Mühsamkeit als Produkt von Arbeit entstehe. Der andere Film aus der ARD-Reihe „Erlebnis Erde: Wildes Deutschland“ präsentiere eine Welt der Superlative im Alpennationalpark mit Überwältigungs-Bildern und ebensolcher Musik in biologischer Sprache als Konstruktion einer Naturlandschaft ohne Menschen. Ähnliche mediale Erlebnisräume fänden sich in Computerspielen, die Realität des Massentourismus werde ausgeblendet.
Bernhard Gißibl, Historiker an der Universität Mannheim, referierte über Grzimeks Film von 1959 „Serengeti darf nicht sterben“ und die Bezüge zur Entstehung des Nationalparks Bayerischer Wald. Er besprach auch den neuen Kinofilm „Serengeti“ des Biologen Reinhard Radke, der nur vage politisch appelliere. Hier zeige sich ein grundlegendes Problem der Medialität des Na-turschutzes, nämlich die mit technischen Mitteln erzeugte Illusion bzw. „Hyperrealität“. Menschen kämen in Radkes Film nicht vor. Grzimek habe als Pionier eines ökologisch verstandenen Naturschutzes zusammen mit einer spendenwirksamen Ikonisierung einen „Platz für Tiere“ geschaffen, aus dem die einheimischen Massai vertrieben worden seien. Das Tier trete in Grzimeks Afrika-Filmen als moralische Instanz auf. Die koloniale Haltung – über lokale Enteignung und „Erziehung“ der Einheimischen zum Naturschutz fortgesetzt – habe als Ergebnis einen attraktiven Freilandpark für kaufkräftige Touristen hervorgebracht. Den Transfer dieser Nationalparkidee nach Deutschland habe Weinzierl besorgt, der mit Grzimek nach Ostafrika reiste. Die Herstellung einer „germanischen Ur-Natur“ – tradiert aus der NS-Zeit – habe man zunächst angepeilt. Aber dazu hätte man massiv in die Ökologie des Bayerischen Waldes eingreifen müssen, wovon ein landschaftsökologisches Gutachten von Wolfgang Haber abgeraten habe. So kam es zu einem Kompromiss mit Kulturlandschaft, was Grzimek enttäuscht habe.
Auf die Frage, wie Naturschutz heute werben solle, antwortete Gißibl, er halte NGOs für wirksam. So sei der WWF auf keinem schlechten Weg, weil er Firmen einbinde und damit alte Feindbilder abbaue.
Manuela Reichart, Germanistin und Publizistin in Berlin, referierte über die Familiensaga „Heimat – Teil 1“ von Edgar Reitz. Sie zeige die Sehnsucht nach der vertrauten Landschaft des Hunsrücks, die Sehnsucht des Mannes nach Aufbruch und Ferne und der Frau nach Beständigkeit und Nähe. In den Gesichtern der starken Frauen könne man wie in Landschaften lesen, die sich verändern, um sie selbst zu bleiben. In der Diskussion bemerkte die Referentin, dass sie nicht wie Ministerin Höfken der Ansicht sei, Windräder könnten schön aussehen, denn durch sie würden vertraute Landschaftsbilder verschwinden.
Stefan Zimmermann, Geograph an der Universität Mainz, thematisierte „Ferne Landschaften im Film – Ergänzung oder Überlagerung lokaler Identität?“. Er habe in Australien das gesehen, was er aus Filmen und Büchern kannte, weil man nur das sehen könne, was man kenne. Es gebe kein Original mehr, weil wir Vorstellung und Original nicht trennen könnten. Der Hirnbereich für räumliche Wahrnehmung liege nahe dem für Emotionen. Durch den Film könne man das Leben im Raum verständlich darstellen. Den Begriff „Lebensraum“ würden Geographen (wegen Missbrauchs in der NS-Zeit) allerdings vermeiden, merkwürdigerweise nicht die Raumplaner bzw. Planungsgeographen.
Manfred Ladwig, studierter Biologe und Fernsehjournalist des SWR, betrachtete die Umwelt- und Naturschutz-Berichterstattung im Fernsehen. Bildschwache Themen seien nur über Printmedien zu publizieren. Die Zielgruppenorientierung sei Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation, da sich nur 50% der Zuschauer überhaupt für Umweltthemen interessierten. Vormals „objektive“ journalistische Kriterien würden inzwischen beeinflusst und überlagert durch persönliche Einstelllungen des „Sinus-Milieus“, ein Begriff aus dem Marketing. Die Zukunft der visuellen Kommunikation liege in extremen Konstruktionen, metaphorisch visueller Kommunikation und dem Erzählen von Geschichten, z.B. dem Science-Fiction-Drama „Melancholia“ von Lars von Trier oder „Survivor“, dem Film über ein Gnu-Baby, das von einer Löwin adoptiert wurde.
Der Moderator Prof. Klaus Werk vom BBN-Vorstand bemerkte zum Schluss, der berufliche Naturschutz sei in weiten Teilen sehr abstrakt, technisch und rechtlich aufgestellt: „Uns fehlen die Bilder, und das muss sich ändern“.
Fazit und Kommentar: eine spannende Tagung mit widersprüchlichen Botschaften. Die Inszenierung von Natur in bildgewaltigen Dokumentarfilmen ohne Menschen wurde überwiegend negativ beurteilt. Die Inszenierung von Menschen und Natur in den Spielfilmen Avatar, Heimat und Melancholia bekamen gute Noten, obwohl völlig fiktional. Der Historiker kritisierte den kolonialen Stil von Grzimek, lobte aber den WWF, dem aktuell ähnliche Vorwürfe gemacht werden. Die Literatin zitierte aus dem Roman Leopard von Tomasi di Lampedusa: „Alles muss sich verändern, damit es so bleibt wie es ist“, wollte dieses Motto aber nicht für Windkraft-Landschaften anwenden.
Bei der Analyse des Naturbilds in den Medien blieben die Kulturleute weitgehend unter sich. Es fehlte m.E. als Kontrapunkt der naturwissenschaftliche Blick eines Hirnforschers oder Evolutionsbiologen auf das Augentier Mensch.
Anschrift der Verfasserin: Barbara Froehlich-Schmitt, Auf der Heide 27, D-66386 St. Ingbert, E-Mail info@natur-text.de , Internet http://www.natur-text.de .
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

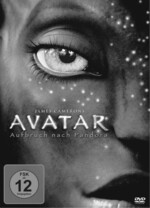
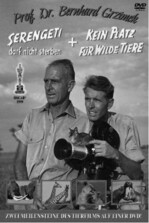


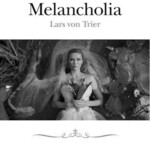
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.