Zustand der Natur verschlechtert sich weiter
Mehr als zwei Drittel der nach EU-Naturschutzrichtlinien zu schützenden Arten in Deutschland befinden sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand, mehr als ein Drittel dieser Arten und fast die Hälfte der Lebensraumtypen weisen einen negativen Entwicklungstrend auf. Dies ist das Ergebnis des Berichts "Die Lage der Natur in Deutschland, der am 19. Mai von BfN und BMU veröffentlicht wurde. Der Bericht basiert auf Daten, die nur alle sechs Jahre erhoben und an die EU-Kommission berichtet werden: insgesamt rund 14.000 Stichproben von den Sandbänken in der Nordsee bis zu den Lärchenwäldern in den Alpen sowie vielen weiteren Beobachtungen aus dem bundesweiten Vogelmonitoring.
- Veröffentlicht am
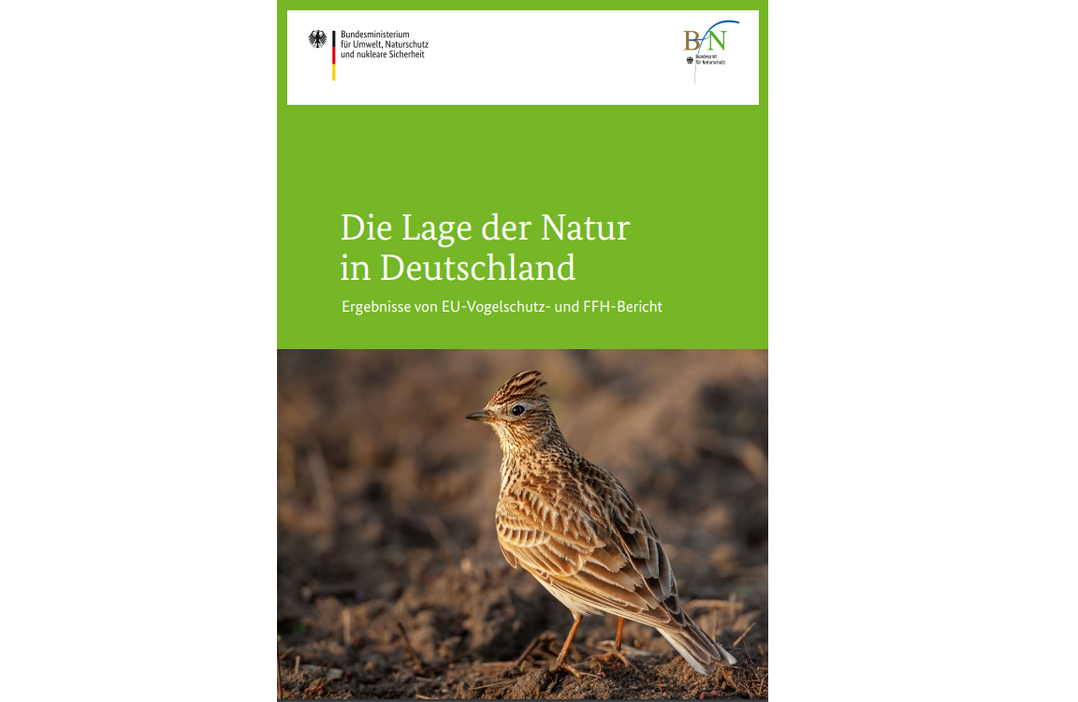
Im Einzelnen sind 25 Prozent der untersuchten Arten in einem günstigen Erhaltungszustand, darunter der Seehund und die Kegelrobbe in der Nordsee oder der Steinbock in den Alpen. 30 Prozent sind in einem unzureichenden Zustand. 33 Prozent sind in einem schlechten Zustand, das betrifft vor allem Schmetterlinge, Käfer und Libellen. Bei den Lebensräumen sieht es ähnlich aus. Hier sind 30 Prozent in einem günstigen Zustand, zum Beispiel verschiedene Wald-Lebensräume, alpine Heiden und Gebüsche sowie Fels-Lebensräume. 32 Prozent weisen einen unzureichenden Zustand auf, während sich 37 Prozent der untersuchten Lebensräume in einem schlechten Zustand befinden, vor allem die landwirtschaftlich genutzten Grünland-Flächen, aber auch Seen und Moore.
Erfolge gibt es vor allem dort, wo aktiv in Naturschutz investiert wird, wie zum Beispiel bei der Renaturierung von Flüssen. Das zahlt sich nicht nur für Tier- und Pflanzenarten, sondern auch für die Wasserqualität und den Hochwasserschutz aus. Hingegen zeigt sich, dass sich dort, wo Lebensräume intensiv bewirtschaftet werden, der Zustand der Arten weiter verschlechtert hat, wie bei vielen Insektenarten und besonders dramatisch bei Vogelarten in der Agrarlandschaft.
Bundesumweltministerin Schulze mahnte daher: "Auf vielen Wiesen und Weiden wird so viel gedüngt und so oft gemäht, dass sie für die Natur immer wertloser werden. Hier ist eine Trendwende dringend nötig. Erste Schritte haben wir bereits getan mit dem neuen Düngerecht und dem Aktionsprogramm Insektenschutz." Schulze kündigte an, als nächsten Schritt ein Insektenschutzgesetz auf den Weg zu bringen, das unter anderem artenreiches Grünland und Streuobstwiesen besser schützt. Der größte Hebel für ein Umsteuern sei aber die EU-Agrarförderung, die gerade neu verhandelt wird. "Das Geld sollte so eingesetzt werden, dass die Landwirtinnen und Landwirte für das honoriert werden, was sie für die Gesellschaft leisten - und dazu gehört ganz zentral der Naturschutz", so Schulze.
Der NABU bezeichnete die Ergebnisse des Berichts als "alarmierend". "Die Lage der Natur ist schlecht, und sie verschlechtert sich weiter. Die Vögel der Agrarlandschaft gehen zurück, in den letzten Jahrzehnten haben wir hier gut zehn Millionen Brutpaare verloren. Das für Vögel und Insekten so bedeutende Grünland steht ebenso unter Druck wie die auch für Klimaschutz und Klimawandelanpassung wichtigen Gewässer- und Feuchtlebensräume. Bund und Länder müssen dringend ihre Hausaufgaben machen und eine Renaturierungsoffensive starten. Wenn nicht endlich ernst gemacht wird, dann bleibt der Bericht nur eine weitere SOS-Meldung im Logbuch der untergehenden Arche Noah", so NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger.
Der BUND wies darauf hin, dass dem Bericht auch positive Botschaften zu entnehmen seien. "Das europäische Netzwerk der Natura 2000-Gebiete funktioniert, wenn es solide finanziert und mit Personal unterstützt wird. Es ist ein Erfolg des Naturschutzes, dass es Arten wie Wildkatze, Kegelrobbe oder Steinbock sowie einigen Lebensräumen heute besser geht", führte Antje von Broock, Geschäftsführerin für Politik und Kommuniaktion beim BUND. "Die schlechte Botschaft: Die Treiber des Artenverlustes wirken vielerorts unvermittelt weiter. Die Zahlen offenbaren, dass die Zukunftsfragen im Naturschutz in Deutschland vielfach immer noch unbeantwortet sind. Das ist nach 28 Jahren Natura 2000 ein Offenbarungseid im Naturschutz.“ Der BUND appellierte daher an die Länder, ressortübergreifend ihre Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft der biologischen Vielfalt wahrzunehmen.
Diesem Appell schloss sich der LBV an. Dr. Andreas von Lindeiner ergänze außerdem: "Schutzgebiete müssen wirklich schützen, sich also positiv auf die Arten und Lebensräume auswirken, zu deren Schutz sie eingerichtet wurden. Wir brauchen deshalb den politischen Willen, konkreten Verordnungen mit spezifischen Zielen ein wirksames Management für die Flächen folgen zu lassen. Auch eine bedarfsgerechte Finanzierung für die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen sicherzustellen ist unabdingbar."
Das ausführliche Informationspapier "Die Lage der Natur in Deutschland" sowie die Ergebnisse von FFH- und Vogelschutzbericht finden Sie HIER. Steckbriefe ausgewählter Arten und Lebensräume finden Sie HIER.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.