„Adaptive Management“ in der Windenergieplanung
Abstracts
Obwohl die Zusammenhänge zwischen Windenergieausbau und wildlebender Fauna ausführlich untersucht wurden, verbleiben weiterhin Unsicherheiten zu Auswirkungen und Vermeidungsmaßnahmen, die vor der Inbetriebnahme der Anlagen schwer prognostizierbar sind. Darüber hinaus findet die natürliche Dynamik (z.B. Populationsschwankungen oder Wechselhorste) in Planungs- und Zulassungsverfahren bisher wenig Beachtung. Adaptive Management erkennt Unsicherheiten bewusst als solche an und versucht, diese durch fortwährende Lern- und Anpassungsprozesse möglichst zu bewältigen. In den USA werden bereits regelmäßig Adaptive Management Pläne erstellt, die das dafür erforderliche Monitoring und entsprechende Anpassungsmaßnahmen berücksichtigen. In diesem Beitrag werden mögliche Ansatzpunkte, Herausforderungen und Praxisbeispiele benannt, die aufzeigen, inwiefern auch in Deutschland Adaptive Management in der Windenergieplanung und genehmigung erprobt und gegebenenfalls zum Einsatz kommen sollte.
„Adaptive management“ for wind energy planning – Opportunity for species protection in Germany?
Although the relationship between the development of wind power and wildlife has been investigated extensively, uncertainties pertaining to both the effects and potential mitigation measures are remaining. They are difficult to predict in advance. In addition, natural dynamics (e. g. fluctuating populations or alternating nest sites of birds of prey) have received little attention in earlier planning and approval procedures thus far. “Adaptive Management” recognizes uncertainties and attempts to overcome them by means of ongoing learning and adaptation processes. In the US, Adaptive Management Plans are being prepared on a regular basis, including monitoring and adaptation measures. The paper outlines possible approaches, challenges, and practical examples which show how adaptive management should be tested and implemented in wind energy planning and approval in Germany.
- Veröffentlicht am

More recently the requirements for wind power plants include a so-called “demand-actuated“ lighting regime, which means that the nocturnal illumination will only be switched on if flying objects do approach.Freiburger Institut für angewandte Wildtierökologie GmbH
1 Einleitung
Adaptive Management (AM) wird in Zeiten des Windenergieausbaus zunehmend als Stichwort genannt, wenn es darum geht, auf bestehende Unsicherheiten aufmerksam zu machen und einen Umgang mit ihnen zu finden (Peste et al. 2015, Sims et al. 2015). Dies scheint bei der Betrachtung der Ergebnisse der vorhergegangenen Beiträge (Bauer & Köppel 2017, Weber & Köppel 2017, Biehl et al. 2017) als naheliegende Option, da sie alle zum Schluss kommen, dass selbst nach 20 Jahren intensiver Forschung zu Windenergie und Auswirkungen auf die wildlebende Fauna noch nennenswerte Unsicherheiten verbleiben müssen. Adaptive Management ist ein Konzept, dass seit mehr als 40 Jahren zum Umgang mit Unsicherheiten thematisiert und teilweise genutzt wird, zunehmend im Kontext der Windenergie (Köppel et al. 2014).
In Planungs- und Genehmigungsverfahren adressieren die meisten Akteure einerseits die verbleibenden Unsicherheiten nur bedingt, denn man möchte zu (möglichst gerichtsfesten) Aussagen gelangen; andererseits sind diese in umweltrelevanten Entscheidungsprozessen stets vorhanden, im Allgemeinen und ebenso bei den möglichen Auswirkungen der Windenergie (Masden et al. 2015, Schuster et al. 2015). Unsicherheiten bestehen sowohl durch nicht vollständige Kenntnisse zu Auswirkungen von einzelnen Einflussfaktoren (z.B. Anlagenhöhe im Hinblick auf das Kollisionsrisiko von Greifvögeln) und kumulativen Wirkungen und Langzeiteffekten von Windparks, als auch durch fehlende Erkenntnisse zur Wirkung und Effektivität von Vermeidungsmaßnahmen. Aber auch veränderte Ziele (z.B. Unterschutzstellung einer Art), Management (z.B. Zunahme einer Population durch erfolgreiches Schutzmanagement) sowie zufällige Ereignisse (z.B. Schrumpfung einer Population durch einen Epidemie-Ausbruch) führen zu Prognoseunsicherheiten.
Darüber hinaus handelt es sich um einen wesentlichen Teil der natürlichen und anthropogenen Dynamik von Ökosystemen, die grundsätzlich auf kleinräumigen Skalen wie innerhalb eines Windparks schwer für die Betriebslaufzeit von 20 Jahren prognostizierbar sind (z.B. sind sowohl Landnutzungsänderungen einzubeziehen als auch Horstwechsel von diversen Greifvogelarten). Vorhersagen, die auf Basis von umfassenden artenschutzfachlichen Gutachten gemacht werden, können all diese Unsicherheiten nicht vollständig einbeziehen: zum einen, weil nicht alle Parameter vor dem Bau messbar sind (z.B. Fledermausaktivität in der Höhe der WEA – es ist i.d.R. nicht möglich, dauerhaft in der angemessenen Höhe zu messen bevor die Anlage steht), und zum anderen, weil selbst noch so genaue Beobachtungen vor dem Beginn eines Projekts die tatsächlichen Auswirkungen nicht exakt vorhersehen können. Folglich können zunächst zwei Fälle eintreten:
1. Negative Effekte treten ein und werden nachträglich bekannt, können aber als solche nach Abschluss der Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht mehr behandelt werden.
2. Aufgrund eines sehr weit verstandenen Vorsorgeaspekts werden Entwicklungen ausgeschlossen, weil keine ausreichende Prognosesicherheit vorliegt. Es entsteht kein Schaden an der Natur, aber auch kein Zubau Erneuerbarer Energieinfrastruktur.
Ein erster Schritt, diesem Dilemma zu begegnen, bedeutet, diese Unsicherheiten hinreichend anzuerkennen, um ihnen dann möglichst zu begegnen.
Heute werden Genehmigungen mit Auflagen erteilt, die zwar teilweise ein Monitoring erfordern, gesicherte Hinweise über die Breite und Tiefe sowie Ergebnisse derartiger Untersuchungen sind bislang aber kaum verfügbar. Vorhersehbare Auswirkungen auf die wildlebende Fauna, die durch den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen entstehen, werden durch „gängige“ Ansätze vermieden, vermindert oder kompensiert. Als betreffendes Leitbild dient das Vorsorgeprinzip, vielfach quasi-standardisiert durch Empfehlungen in Leitfäden etc. Mit dem Vorsorgeprinzip wird ein eher konservativer Ansatz gewählt, der ein sehr hohes Maß an Schutzmaßnahmen erfordert.
In der Folge des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2017 bekommen jedoch die jeweils günstigsten Projekte einen Zuschlag und können nur dann auch eine Vergütung nach EEG erhalten. Projekte mit überdurchschnittlich hohen Kosten (z.B. durch besonders hohe Pachtzahlungen, erhöhten artenschutzfachlichen Handlungsbedarf oder erhöhte Kosten durch bedarfsgerechte Befeuerungssysteme etc.; Abb. 1) bekommen dann möglicherweise keinen Zuschlag mehr. Ein zielgenauerer Umgang mit verbleibenden Unsicherheiten einerseits sowie dem Vorsorgeprinzip andererseits kann jedoch auch weiterhin zu einer verbesserten Einzelfallgerechtigkeit und Wettbewerbsfähigkeit beitragen.
Im Folgenden werden die Herkunft des Adaptive-Management-Konzepts erläutert und auf internationale Ansätze und Erfahrungen verwiesen, praktische Hinweise eingeführt und die Relevanz und Anwendungsfähigkeit des Ansatzes für Deutschland besprochen. Abschließend geht es um die damit verbundenen Herausforderungen und ein Plädoyer für die modellhafte Erprobung von Adaptive Management im Kontext der weiteren Windenergieentwicklung.
2 Adaptive Management Konzept
Bei Adaptive Management handelt es sich um einen strukturierten Entscheidungsprozess, dessen Ziel es ist, bestehende Unsicherheiten zu reduzieren und das Management einer natürlichen Ressource zu verbessern (Williams 2011). Der Begriff Adaptive Management wurde 1978 durch Holling eingeführt und das Konzept wurde seitdem u.a. in der Bewirtschaftung von Wäldern (Bolte et al. 2009, Freiderici 2003, Johnson 2011, Jacobsen et al. 2009), in der Fischerei (Martin & Pope 2011), bei Renaturierungsprojekten und im Artenschutz (Green & Garmestani 2012, Jones 2009, Moore et al. 2011, Smith 2009, Smith 2011) sowie im Bereich des Wassermanagements (Failing et al. 2013, National Research Council 2004, Pahl-Wostl 2006) erprobt. Die geläufigste Definition von Adaptive Management ist eine abgewandelte Form der des National Research Councils aus den Richtlinien des US-amerikanischen Innenministeriums (U.S. Department of the Interior 2009, S.4):
“Adaptive Management [is a decision process that] promotes flexible decision making that can be adjusted in the face of uncertainties as outcomes from management actions and other events become better understood. Careful monitoring of these outcomes both advances scientific understanding and helps adjust policies or operations as part of an iterative learning process.”
Es gibt eine Vielzahl von Modellen zur Darstellung von Adaptive Management. Die Mehrheit davon stellt einen Kreislauf dar, der je nach Autoren unterschiedlich viele Schritte beinhaltet (Argent 2009, Jakeman et al. 2009, Jones 2009), sich jedoch fast immer in eine Phase des Agierens und eine des Lernens und Anpassens unterteilen lässt. Am häufigsten (u.a. von Linkov et al. 2006, Murray & Marmorek 2003, Williams & Brown 2014; Abb. 2) wird das Modell in sechs Schritte (siehe Abb. 1) gegliedert, die als Zyklus zu betrachten sind. Für jeden Adaptive-Management-Prozess wird zu Beginn ein Ziel definiert. Der erste Schritt ist die Vorprüfung, in der die Problemdefinition stattfindet. Es folgt die Planungsphase zur Lösung des Problems und die Phase der Umsetzung des Plans. Direkt an die Umsetzung wird das Monitoring angeschlossen, das messen soll, ob die Umsetzung dem Plan entsprechend funktioniert. Falls dies nicht der Fall ist, gibt es verschiedene Anpassungsmechanismen, die idealerweise bereits in der Planungsphase entwickelt werden. Deren Funktionalität wird fortlaufend durch Monitoring überprüft und gegebenenfalls weiter angepasst, bis das geplante Ergebnis eintritt. Zuletzt ist es ein Lernprozess durch den regelmäßigen Vergleich von Vorhergesagtem und tatsächlich Eingetroffenem.
Monitoring ist also ein wesentlicher Bestandteil im Adaptive-Management-Prozess (Benson & Garmestani 2011), der einerseits Anpassungen im überwachten Projekt ermöglicht (Lernschlaufe I) und andererseits für zukünftige Projekte die Unsicherheit verringern kann (Lernschlaufe II). Ein typisches Beispiel hierfür aus der Windenergienutzung ist, dass im Rahmen der ersten Lernschlaufe als Folge von Gondelmonitoring die Abschaltalgorithmen der tatsächlichen Anwesenheit von Fledermäusen angepasst werden und damit dem Ansatz von Brinkmann et al. (2011) folgend zu einer artenschutzfachlichen Betriebsoptimierung führen. Die zweite Lernschlaufe dazu kann aber in Deutschland bislang kaum durchlaufen werden, da kaum (Fach-)Öffentlichkeit darüber hergestellt wird. Neben entsprechenden Kapazitäten für das Monitoring muss letztlich auch die Bereitschaft vorhanden sein, neues Wissen aufzunehmen und Prozesse anzupassen. In gewissem Umfang erfolgt dies auch in Deutschland bereits, wenn etwa windkraftspezifische Artenschutz-Leitfäden fortgeschrieben werden (wie aktuell in Nordrhein-Westfalen) oder auf den Fortschreibungsbedarf bei neuen Erkenntnissen explizit hingewiesen wird (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 2012 oder MUGV Verbraucherschutz Brandenburg 2014). Ein konkretes Beispiel stellen auch Bemühungen dar, auf einer breiteren empirischen Basis zu harmonisierten Standards für Abschaltzeiten für den Schutz von Fledermäusen zu gelangen.
3 Adaptive Management in der Praxis
Während Adaptive Management in einigen Staaten in der Windenergieentwicklung bereits praktische Anwendung findet (wenn auch nicht zwangsläufig unter dieser Bezeichnung), läuft der Prozess der Implementierung dennoch schleppend. Mögliche Anknüpfungspunkte sollen im Folgenden exemplarisch auch an Praxisbeispielen dargestellt werden, um die Kernfrage zu beantworten, wie es möglich sein kann, den Ansprüchen des Artenschutzes gerecht zu werden und dennoch Planungssicherheit für die Windbranche zu erhalten.
3.1 Adaptive Management und Windenergie – internationale Ansätze
Die Arbeitsgruppe WREN (Task 34) der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Behandlung artenschutzfachlicher Konflikte beim Windenergieausbau hat sich u.a. auf die Kommunikation von Adaptive-Management-Ansätzen fokussiert und arbeitet derzeit an einem White Paper zum Thema, um die Diskussion weltweit anzustoßen (IEA 2016).
Vorreiter sind die USA (vgl. U.S. Department of the Interior 2009; Abb. 3). Dort werden Adaptive-Management-Ansätze als Strategie in der Windenergieplanung systematisch angewandt. Ein Adaptive-Management-Plan ergänzt dort häufig die artenschutzfachlichen Dokumente, das in weitere Genehmigungsdokumente (z.B. Biological Opinion oder Habitat Conservation Plan) als Kapitel integriert werden kann. Dieser Plan bildet sowohl für die Methoden des Monitorings, für die Minimierungsmaßnahmen im Artenschutz als auch ggf. für die Kompensation die Grundlage. Notwendig werden diese Unterlagen ggf. im Zuge artenschutzrechtlicher Verfahren, wenn gelistete Arten gemäß Endangered Species Act betroffen sind.
In verschiedenen Windparks in den USA wurden bereits Adaptive-Management-Pläne erstellt, weil Unsicherheiten darüber vorhanden waren, ob und inwiefern die entsprechenden Tierarten vom Betrieb beeinflusst werden oder ob die ergriffenen Maßnahmen erfolgreich sind. Monitoring und ggf. Anpassungen der Schutzbemühungen sind schon allein deshalb erforderlich, weil häufig artenschutzrechtliche Ausnahmen (Incidental Take Permits) ausgestellt werden. Diese beinhalten eine quantitative Angabe über die maximale Anzahl an Kollisionsopfern, deren Entnahme die Population voraussichtlich verkraften kann.
(1) Im Beech Ridge Windpark (West Virginia) mit ca. 100 Windenergieanlagen wurde frühzeitig erwartet, dass sich Auswirkungen auf die geschützten Fledermäuse Indiana bat (Myotis sodalis) und Virginia big-eared bat (Corynorhinus townsendii virginianus) nicht vollständig vermeiden lassen. Untersuchungen im Rahmen des erforderlichen Habitat Conservation Plan (HCP) konnten zeigen, dass zwar kein Habitatverlust zu erwarten ist, dass aber durch die Migrationsbewegungen und die Schlafplätze in unmittelbarer Nähe Kollisionen eintreten können (U.S. Fish & Wildlife Service 2013c). Nachdem durch die Verkleinerung des Projekts und kleinräumige Anlagenverschiebungen das Risiko bereits gemindert wurde, wurde zusätzlich die Anlaufgeschwindigkeit der WEA in Risikozeiträumen (15. Juli bis 15. Oktober, ab Sonnenuntergang für 5h) von 3,5 auf 4,8m/s erhöht. Im Zeitraum der ersten fünf Jahre wird durch betriebsbegleitendes Monitoring der Effekt der Abschaltung überprüft und ggf. weiter verfeinert (Beech Ridge Energy LLC 2013).
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung (Incidental Take Permit) wurde ermittelt, dass die Population über die Dauer von 25 Betriebsjahren einen Verlust von 53 Individuen der Indiana bats verkraften könne (das entspricht ca. 0,712 % der lokalen Population/Jahr). Sofern sich im Monitoring Tendenzen einer Überschreitung oder Unterschreitung dieses Grenzwertes abzeichnen würden, sollten die betriebsregulierenden Maßnahmen entsprechend – sowohl verschärfend, als auch lockernd – angepasst werden. Zusätzlich wurde ein Forschungsplan erstellt – und damit ein weiterer Beitrag für die zweite Lernschlaufe –, der ermitteln sollte, wie effektiv sich Abschaltungen zur Vermeidung von Fledermauskollisionen erweisen.
(2) Um negativen Auswirkungen auf Kalifornische Kondore (Gymnogyps californianus) vorzubeugen, wurde in Alta East (Kalifornien) der Condor Monitoring and Avoidance Plan (U.S. Fish and Wildlife Service 2013a) aufgestellt, obwohl im Areal des geplanten Windparks bisher keine Vorkommen beobachtet wurden. Auf Grund der großen landesweiten Schutzbemühungen wird die Erholung der stark geschwächten Population des Kalifornischen Kondors jedoch für die nächsten Jahre erwartet und damit auch die Wiederansiedlung in den potenziellen Habitaten (zu denen auch die Region um den Alta East Windpark gehört). Um auf die neuerliche Anwesenheit der Tiere durch veränderte Flugmuster und die neue Populationsgröße reagieren zu können, wurde eine Adaptive Management Strategie erarbeitet. Sie beinhaltet ein Monitoring, das bei Flugbewegungen in Windparknähe zusätzliche Maßnahmen auslöst, die von Gesprächsterminen über eine Veränderung des Monitorings bis zu temporären Betriebseinschränkungen reicht.
In vielen Fällen wird deutlich, dass es sich nicht nur um eine Minimierungsstrategie von Auswirkungen handelt, sondern auch der Lernprozess eine wichtige Rolle spielt. Für den Windpark Buckeye (Ohio) wird dies deutlich kommuniziert, z.B. „Enhance understanding of the factors that contribute to increased risk of Indiana bat collisions“ (Stantec Consulting Services Inc. 2013, S. 191).
Die USA können diverse Fallbeispiele für die Anwendung von Adaptive Management auf alle Teilprozesse der Windenergieplanung vorweisen, allerdings findet dies ausschließlich auf staatlichen Flächen und lediglich für unter dem Endangered Species Act gelistete Arten statt.
Zwei Fallbeispiele aus Portugal und Australien haben im Rahmen von Forschungsvorhaben zumindest Ansätze des Adaptive Management aufgenommen:
(3) Im portugiesischen Windpark Candeeiros wurde zur Ermittlung des Vogelkollisionsrisikos von Cordeiro et al. (2013) ein betriebsbegleitendes Monitoring durchgeführt. Insbesondere für Turmfalken (Falco tinnunculus) wurden im Rahmen der Untersuchungen überraschend hohe Kollisionsraten festgestellt, die zu einer Beeinträchtigung der lokalen Population führen könnten. Um dem entgegenzuwirken, wurde parallel zum laufenden Betrieb ein Monitoringplan zur Überwachung der Populationsgröße und der Ermittlung der Kollisionsopferraten entwickelt. Auf dessen Basis konnte ein standortspezifisches Vermeidungskonzept mit dem Fokus auf Habitatmanagement außerhalb des Windparks entwickelt werden. Ziel war es einerseits, die Vermeidungsmaßnahmen mit Hilfe von standortspezifischem Wissen zu optimieren und dadurch die Turmfalken zu schützen, und andererseits, die Kosten für Habitatmanagement-Maßnahmen zu reduzieren.
(4) Auch im tasmanischen Woolnorth Windpark, der in den 2000-er Jahren schrittweise mit 60 WEA in Betrieb genommen wurde, gibt es adaptive Elemente. Im Rahmen des dazugehörigen Environmental Management Plans wurden diverse Maßnahmen und Monitorings u.a. für den Keilschwanzadler (Aquila audax) und den Goldbauchsittich (Neophema chrysogaster) entwickelt. Sie wurden über die Betriebsdauer evaluiert und je nach Facheinschätzung daraufhin beibehalten, optimiert oder eingestellt (Sims et al. 2015). Da die Evaluation des Vogel- und Fledermausmonitorings den Keilschwanzadler als besonders kollisionsgefährdet identifiziert hat, wurde das Monitoringverfahren für diese Vogelart optimiert, weil eine Überwachung der anderen Arten nicht mehr erforderlich war. Maßnahmen, die sich bewährt haben oder von denen man zumindest einen positiven Effekt erwartet (z.B. Entfernung von Nahrungsressourcen unter den WEA), wurden beibehalten. Andere Maßnahmen, deren Umsetzung nicht den gewünschten Erfolg brachte, wurden eingestellt (z.B. akustische Vergrämung der Adler). Der Erfolg der Evaluation ist ein Maßnahmenset, das sehr gezielt bestehende Konflikte behandelt und sich gleichzeitig als praktisch umsetzbar bewährt hat.
3.2 Adaptive Management und Windenergie – Hinweise für die Praxis
Ausschlaggebend für eine Erfolg versprechende Umsetzung von Adaptive Management ist die Festsetzung der notwendigen Parameter im Rahmen einer von allen Parteien akzeptierten Vereinbarung (Williams & Brown 2014). Teil dessen sind neben der genauen Beschreibung von Zielen sowie art- und ortsspezifischen Auslösern erforderlicher Maßnahmen auch die Monitoringmethoden und -zeiträume.
Dazu gehören zunächst die Identifikation von relevanten Stakeholdern und die Zuteilung von Verantwortungsbereichen. In den USA haben sich in diesem Kontext Technical Advisory Councils (TACs) als hilfreich erwiesen, die aus Projektentwicklern, Genehmigungsbehörden, Naturschutzbehörden, Verbänden, der Öffentlichkeit und weiteren Experten bestehen können. Das TAC einigt sich gemeinsam auf die inhaltlichen Festsetzungen. Die Bestimmung, ausschließlich Entscheidungen im Konsens zu treffen, wurde als erfolgsführend identifiziert (Sims et al. 2015).
Um mit Adaptive Management eine verbesserte Situation für artenschutzfachliche Belange zu erzielen, wird ein Ziel festgelegt (z.B. der Schutz einer bestimmten Art) und das Erreichen des Ziels (z.B. keine signifikant erhöhte Mortalität) wird quantitativ gefasst. Um die ermittelten Monitoringergebnisse bewerten zu können, werden von Gutachter- und Behördenseite Schwellenwerte (X Individuen pro Jahr und Anlage) bestimmt. Im nächsten Schritt wird das zentrale Element des Adaptive Management – die Monitoringmethode – entwickelt. Genaue Angaben dazu, wer das Monitoring wie durchführt, sind elementar (Williams & Brown 2014). Wird laut der Bewertung der Monitoringergebnisse der Schwellenwert überschritten, so wird die erste bzw. nächste Stufe des Adaptive Managements ausgelöst (Trigger) und es kommt zur Anpassung der bisherigen Praxis (Maßnahmen).
Für Fledermäuse kann es sich bei dem Schwellenwert beispielsweise um zwei Kollisionsopfer pro Anlage und Jahr handeln (HMUELV & HMWVL 2012) oder um einen getöteten Greifvogel in einem Windpark mit über 50 WEA (U.S. Fish and Wildlife Service 2013b). Bei solchen Schwellenwerten handelt es sich meist weniger um naturwissenschaftlich belegte Größen, sondern eher um einen gesellschaftlichen Kompromiss (Behr et al. 2011, Sugimoto & Matsuda 2011).
Neue Informationen müssen an den richtigen Stellen ankommen, damit Managemententscheidungen auf Basis dieser neuen Erkenntnisse getroffen werden können (Smith 2009). Daher ist eine gute Form der Kommunikation maßgeblich für den Erfolg von Adaptive Management mitverantwortlich. Grundsätzlich ist ein adaptiver Ansatz nur dann möglich, wenn auch tatsächlich Anpassungen vorgenommen werden können. Identifizieren sich im Rahmen des Monitorings einzelne Maßnahmen oder aber auch die Monitoringprozesse selbst als wenig hilfreich, können sie gestrichen, angepasst oder aber ergänzt werden (Sims et al. 2015). Kann beispielsweise nach Abschluss eines kürzeren Monitorings ein erwartetes Ergebnis bereits eindeutig beobachtet werden, muss der Monitoringprozess nicht dauerhaft weitergeführt werden. Ebenso stuften Sims et al. (2015) Untersuchungen, die durch fehlende statistische Relevanz keine verlässlichen Ergebnisse liefern können, als nicht fortführenswert ein.
3.3 Adaptive Management in Deutschland
Der Fachbegriff Adaptive Management wurde bisher in Deutschland kaum verwendet und wird auch weder im wissenschaftlichen Diskurs der Umwelt- und Landschaftsplanung und Ökologie noch in der Planungspraxis explizit herangezogen und verbreitet. Grundsätzliche Strukturen eines Umgangs mit Unsicherheiten lassen sich einerseits im Rahmen der Artenschutzleitfäden (z.B. aus Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen) erkennen, aber auch auf Projektebene (z.B. bei Fledermausabschaltalgorithmen). Häufig bleiben genaue Angaben zu Anpassungen aber unbekannt, da die Daten nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Williams & Brown (2014) betonen, dass oft schon davon ausgegangen wird, dass es sich bei Vorhaben um Adaptive Management handelt, weil ein betriebsbegleitendes Monitoring vorgesehen ist. Adaptive Management geht jedoch darüber hinaus; nach dem Monitoring muss (sofern erforderlich) die technische und rechtliche Möglichkeit bestehen, eine Anpassung vorzunehmen, um das gesetzte Ziel zu erreichen.
Diese Anpassung ist in Deutschland bereits im Fall der Abschaltzeiten für Fledermäuse zur gängigen Praxis geworden. Mehrheitlich empfehlen die Leitfäden der Bundesländer zu Windenergie und Artenschutz bereits standortspezifische Abschaltalgorithmen zum Schutz von Fledermäusen (TU Berlin et al. 2015) auf Basis von Brinkmann et al. (2011), die regelmäßig auch in der Praxis beauflagt werden (TU Berlin et al. 2015). In Deutschland haben sich die Schwellenwerte der als populationsunschädlich eingeschätzten Schlagopferzahlen für Fledermäuse auf zwei Tiere pro Jahr und Anlage eingependelt und werden durch Gondelmonitoring und sehr vereinzelt über Schlagopfersuchen rechnerisch ermittelt. Sind die berechneten Fatalitätsraten zu hoch, werden Abschaltungen eingeführt (häufig zwischen April und Oktober in den Dämmerungsstunden bei über 10°C, Wind unter 6m/s und in Nächten ohne Niederschlag) bzw. gegebenenfalls ausgeweitet. Die Anpassungen können jährlich stattfinden, bis im dritten Betriebsjahr der endgültige Abschaltalgorithmus festgelegt wird. Im ersten Jahr werden als Basis meist allgemeine Abschaltzeiten eingehalten, die abhängig von der Aktivität einzelner Arten angepasst werden und so zu einer fachlichen und wirtschaftlichen Optimierung führen (TU Berlin et al. 2015).
Auch für Vögel können in der deutschen Praxis bereits adaptive Ansätze erkannt werden. Wiesenweihen wählen als Brutplatz häufig Felder mit Wintergerste und Winterweizen aus (Millon et al. 2002), so dass deren Vorkommen mit einer gewissen jährlich mit dem Bewirtschaftungsregime wechselnden Unsicherheit behaftet sind (Abb. 4). Diese erkennt der rheinland-pfälzische Leitfaden zu Windenergie und Naturschutz an, indem er als Maßnahme zur Minderung des Kollisionsrisikos vorschlägt, bei Brutansiedlung in unmittelbarer Nähe der WEA eine temporäre Abschaltung der WEA zu beauflagen.
Einen weiteren Ansatz mit jährlich anzupassenden Abschaltzeiten für WEA zur Vermeidung von Vogelkollisionen hat Schreiber (2016) in einem artspezifischen Konzept entwickelt. Ohne es explizit zu benennen, beinhaltet das Konzept durch regelmäßig stattfindende Monitorings über die gesamte Betriebsdauer eines Windparks und entsprechende Anpassungen der Abschaltalgorithmen und Lernprozesse, Ansätze des Adaptive Management. In diesem Kontext ist noch zu ermitteln, ob sich aus naturschutzfachlicher Perspektive verhältnismäßige Abschaltungen und wirtschaftlich zumutbare Abschaltzeiten decken.
Ausbaufähig ist in Deutschland allerdings der Zugang zu Wissen aus den iterativen Lernprozessen. Gerade durch die umfassenden Daten, die im Rahmen von Fledermausmonitoring gesammelt werden, könnten Unsicherheiten zu Fledermausverhalten abgebaut werden, wenn es möglich wäre, die Erkenntnisse zu sammeln und auszuwerten (Voigt et al. 2015).
Wünschenswert wären auch weiterhin z.B. im Fall der Fledermausabschaltalgorithmen, dass natürliche Veränderungen, die sich nach dem meist genutzten letzten Anpassungsstichtag von zwei Jahren ereignen, für die rechtlichen 18 Jahre Betriebsdauer relevant wären. Möglich wäre eine regelmäßige Überprüfung der Fledermausaktivität am Standort, um die Abschaltzeiten bei Aktivitätsänderungen anzupassen. Wesentlich relevanter könnten diese betriebsbegleitenden Anpassungen aber für Greifvögel mit Wechselhorsten sein.
4 Herausforderungen
Offensichtlich stellt Adaptive Management nicht erst seit kurzem eine interessante und vielversprechende Innovation dar. Daher stellt sich die Frage, was bisher Hinderungsgründe für eine umfassende Implementierung sind. Williams & Brown (2014) fassen verschiedene Herausforderungen bei der Implementierung von Adaptive Management zusammen, die großenteils auf den Ausbau der Windenergie übertragen werden können. Im Rahmen von Diskussionen und Workshops mit nationalen und internationalen Stakeholdern konnten diese Punkte ergänzt werden. So wurden Möglichkeiten und Herausforderungen von Adaptive Management in der Windenergieplanung im Rahmen von Workshops mit einem nationalen (06. Juli 2015 in Kassel) und internationalen Expertenkreis (12. März 2015 WREN Panel) diskutiert und am 10. November 2015 bei einer Fachtagung in Berlin vorgestellt. Als Gesamtergebnis können die Herausforderungen wie folgt zusammengefasst werden:
Praxisberichte betonen immer wieder die hohe Relevanz der Einbindung aller relevanten Stakeholder für einen erfolgreichen Prozess (Sims et al. 2015, Williams & Brown 2014), um etwa auch falsche Erwartungen und Enttäuschen zu vermeiden. Ein Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien zu ermöglichen, kann in einigen Regionen, in denen es bisher vor allem zwischen der Windenergiebranche und dem Naturschutz zu Konflikten kam, eine (allzu) hohe Eintrittsschwelle darstellen.
Eine generelle Herausforderung dieser längerfristigen Prozesse ist die ideelle und personelle Verpflichtung (Williams & Brown 2014) sowohl auf institutioneller als auch auf privater Seite, die wichtig ist um Lernprozesse ermöglichen zu können.
Bei Innovationen wie Adaptive Management herrscht begründet zunächst Zurückhaltung, da kaum Umsetzungsbeispiele bekannt sind. Leitfäden zu naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für Windenergieanlagen haben sich in den letzten Jahren in Deutschland als hilfreich herausgestellt, weil so auch weniger erfahrene Naturschutzbehörden auf einen hohen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Für Adaptive Management könnte ein bundesweiter oder länderspezifischer Leitfaden mit Hinweisen zu Umsetzungsbeispielen oder Formulierungsvorschlägen die Umsetzung beschleunigen.
Die Aufgabe, Unsicherheiten anzuerkennen, kann sich in der praktischen Zusammenarbeit mit Fachpersonal als Herausforderung erweisen, weil Fachgutachter womöglich ungern ausdrücken wollen, dass sie keine zuverlässigen Aussagen treffen können (Williams & Brown 2014). Die Wissenschaft wiederum steht vor der Herausforderung, auf die jeweils verbleibenden Unsicherheiten hinzuweisen (hier z.B. beim Einsatz von Populationsmodellen), ohne die bis dato gefundenen Ergebnisse zu diskreditieren (Ascher 2004). Von Naturschutzbehörden könnte die Anerkennung von Unsicherheiten und damit das letztlich Nicht-Ausschließen-Können etwa einer (Über- oder) Unterschätzung von Kollisionsopfern als Konflikt mit geltendem Artenschutzrecht gesehen werden, zumindest solange die Anforderungen für artenschutzrechtliche Ausnahmen nach §45 BNatSchG in Deutschland nicht gegeben sind.
Unbestritten ist, dass Adaptive Management durch den zusätzlichen Aufwand an Monitoring zu Zusatzkosten führt (Williams & Brown 2014), zumindest solange sich nicht parallel der ex-ante-Untersuchungsaufwand reduziert. Darüber hinaus besteht durch die Anerkennung der Unsicherheiten ein ebenso anerkanntes finanzielles Risiko über die gesamte Projektlaufzeit, das durch die Kreditgeber eingepreist werden kann und dadurch die Finanzierung eines Windparks verteuert. Werden jüngere Marktentwicklungen und das veränderte Vergütungssystem im Rahmen des EEG 2017 (Ausschreibungen) einbezogen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass verteuerte Projekte unter Umständen nicht wettbewerbsfähig sind. Daher wären marktwirtschaftliche Entlastungsmechanismen wie ein Anreizsystem zukünftig zu diskutieren. Mögliche Ansätze, die bereits in den USA umgesetzt (Echanis 2011) und in Deutschland diskutiert (Schreiber 2016) werden, sind Kostengrenzen, die beispielsweise über vordefinierte Abschaltkontingente festgesetzt werden können. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Rolle Entschädigungsansprüche spielen, sofern Betriebsausfälle oder zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich werden, oder wenn die Auswirkungen sich als erheblich gravierender erweisen als prognostiziert. Adaptive Management bedarf konsensfähiger Finanzierungskonzepte.
Sehr wichtig für den Erfolg von Adaptive Management sind die Lernprozesse. In Deutschland werden Auflagen zum Monitoring teilweise als Grundlagenforschung betrachtet, die nicht vom Projektentwickler zu tragen seien (vgl. HMUELV & HMWVL 2012).
Adaptive Management kann nur dann zum besseren Schutz der Tierwelt beitragen, wenn als Folge von entsprechenden Monitoringergebnissen auch Maßnahmen ergriffen werden. Durch den regelmäßigen Abgleich von prognostizierten Auswirkungen eines Windparks und den eingetretenen Entwicklungen und ggf. Maßnahmenentwicklung und -überprüfung entsteht zusätzlicher Aufwand sowohl für die Naturschutzbehörden als auch die Windkraftbetreiber.
In welcher Form die Umsetzung von Adaptive Management auch rechtlich abgesichert gestaltet werden kann, wurde bislang wenig erörtert. Ein Gutachten der FA Wind (2016a) beschäftigt sich mit der Frage, welche nachträglichen Anforderungen juristisch möglich sind, wenn sich nach Erteilung einer Genehmigung neue Erkenntnisse ergeben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass von Behördenseite aus bisher relativ selten die Möglichkeit besteht, Anpassungen über BImSchG, das Umweltschadensrecht oder §3 Abs.2 BNatSchG vorzunehmen. Der nachträgliche Widerruf von überflüssig gewordenen Auflagen – also die Lockerung zugunsten der Betreiber – könnte von der Genehmigungsbehörde durchaus umgesetzt werden (FA Wind 2016a). Folglich besteht voraussichtlich rechtlicher Anpassungsbedarf, sofern Adaptive Management in formellen Verfahren berücksichtigt und über die bestehenden Möglichkeiten (z.B. Auflagenvorbehalte nach BImSchG für bereits absehbare Konflikte) hinausgehen soll.
Womöglich könnte daher eher eine informelle Einigung in Frage kommender Akteure ein Adaptive-Management-Planwerk besiegeln. Wird ein von allen Akteuren entwickeltes und anerkanntes Konzept umgesetzt, ist die Wahrscheinlichkeit anschließenden Rechtsstreits geringer als im Rahmen einer verpflichtenden Auflage durch die Genehmigungsbehörde. Offen ist dennoch, welcher Ansatz langfristig mehr Sicherheit bietet.
5 Ein Plädoyer zum Erproben
Das Konzept des Adaptive Management kann nicht nur für den Artenschutz, sondern für alle Beteiligten im Windenergieausbau eine Chance darstellen. Zunächst ermöglicht es eine aus artenschutzfachlicher Sicht zielgerichtetere Betrachtung von möglichen Auswirkungen. Dies beinhaltet sowohl den optimierten Umgang mit unbekannten Auswirkungen als auch die Anpassungsmöglichkeit, wenn vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen nicht entsprechende Wirkungen zeigen. Darüber hinaus profitiert wiederum der Artenschutz von der Wissensgenerierung, die durch die systematische Auswertung von Monitoring-Ergebnissen entstünde.
Projektentwickler und Windkraftbetreiber könnten davon profitieren, dass ihnen durch Adaptive Management mehr Standorte zur Verfügung stehen, die zunächst wegen als zu hoch wahrgenommener Unsicherheit womöglich ausgeschlossen wurden (so wie z.B. zumindest anfangs zur Frage von Windkraft im Wald). Zusätzlich könnten gegebenenfalls die genehmigungsrechtlichen Auflagen dem aktuellen Projektstand angepasst werden und auf teilweise kostspielige Vermeidungsmaßnahmen auch wieder verzichtet werden, wenn etwa Nester oder Nahrungsflächen in unmittelbarer Windparknähe verlassen werden. Nicht zuletzt würde es auch den Genehmigungsbehörden einen transparenteren Umgang mit Unsicherheiten erlauben und ihre Verantwortung über Themen relativieren, über die aufgrund verbleibender Unsicherheiten ohnehin schwer zu entscheiden ist.
Schlussendlich steht der Ansatz auch in der Windenergie aber noch ganz am Anfang und Fragen zu möglichen Einsatzarten, zur Verbesserung der Lernprozesse, zur rechtlichen Umsetzbarkeit und weitere offene Punkte müssen erörtert werden. Dazu bedarf es betreffender Modellvorhaben bzw. sorgfältig begleiteter und auszuwertender Fallbeispiele und empirisch nachweisbarer Win-win-Effekte sowie einer breiteren Diskussion in der Fachöffentlichkeit.
Literatur
siehe beitragsübergreifende Bibliographie unter http://www.nul-online.de, Webcode 2231
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




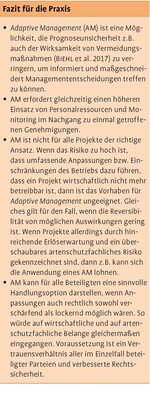
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.