Extensive Weidewirtschaft und Forderungen an die neue Agrarpolitik
Abstracts
Die naturnahe Beweidung unserer Kulturlandschaft steht für eine moderne, multifunktionale Landwirtschaft. Viele weidetierhaltende Betriebe leisten einen wichtigen Beitrag, die europäischen Herausforderungen Biodiversitäts-, Klima- und Gewässerschutz effektiv anzugehen. Mit nachfolgender Position, von zahlreichen Verbänden unterstützt, werden Vorschläge für eine bessere Etablierung der extensiven Weidetierhaltung in dem Förderrahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU nach dem Jahr 2013 formuliert. Bestehende Instrumente der GAP sollen in folgenden Bereichen weiterentwickelt werden:
Als besonders förderfähige Maßnahmen werden (a) extensive ganzjährige Standweide mit Rindern und Pferden, (b) Umwandlung von Ackerland in beweidetes Extensivgrünland in Überschwemmungsgebieten und auf Niedermoorböden sowie (c) Biotoppflege durch Schafe und Ziegen empfohlen.
Extensive Grazing and Requirements for the new Agricultural Policy – Promotion of biological diversity, climate protection, water balance and landscape aesthetics
The near-natural pasturing of our cultural landscape stands for a modern, multi-functional agriculture. Many farms with grazing animals have an important share in effectively implementing the European challenges to protect biological diversity, climate and water. The subsequent paper – supported by numerous associations – makes proposals for a better establishment of extensive grazing in the funding guidelines of the Common Agricultural Policy (CAP) of the EU after 2013. Existing instruments are to be advanced in the following areas:
The study recommends the following measures which are particularly eligible: (a) extensive all-year continuous grazing with cattle and horses, (b) conversion of arable fields into extensively grazed grasslands in flood areas and on fen soils, and (c) biotope management with sheep and goats.
- Veröffentlicht am
1 Herausforderungen in Europa anpacken
Die Europäische Union hat mit der Europäischen Vogelschutz-Richtlinie (VSRL), der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) einen anspruchsvollen rechtlichen Rahmen zur Sicherung der Biodiversität und des Ressourcenschutzes geschaffen. Auch Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes sind unverkennbar.
Dennoch konnten wichtige Ziele der Europäischen Union zum Schutz der Biodiversität, des Klimas und des Wassers bisher nicht im gewünschten Maße erreicht werden. Die erste umfassend angelegte Untersuchung der im Rahmen der FFH-Richtlinie geschützten und am stärksten gefährdeten Lebensräume und Arten Europas zeigte, dass lediglich 17 % der betroffenen Lebensräume einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen. Wiesen und Feuchtlebensräume zählen dabei zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen (Europäische Kommission 2009).
Der Farmland-Bird-Index, ein wichtiger Basisindikator zur Darstellung der Maßnahmenwirkungen der Entwicklungsprogramme für die ländlichen Räume in den EU-Mitgliedsstaaten der EU-27-Länder, zeigt eine signifikante Verschlechterung vom Referenzwert 100 im Basisjahr 1990 auf 82,8 im Jahr 2006. Für Deutschland sank der Index in diesem Zeitraum auf den Indikatorwert 74,1 (Europäische Kommission 2010). Der Statusbericht „Vögel in Deutschland“ 2009 (Sudfeldt et al. 2009) weist seit 1990 eine gleichbleibend negative Bilanz auf: 2006 und 2007 wurde mit 67 % des Zielwertes für 2015 der bisher niedrigste Stand erreicht. Nahezu 60 % der Arten des Ackers und Grünlandes werden in der Roten Liste Deutschlands als gefährdet eingestuft oder stehen auf der Vorwarnliste. Die alarmierende Negativ-Entwicklung hat in den letzten 15 Jahren auch die ehemals häufigsten Vogelarten des Grünlands erfasst. Kiebitz (Vanellus vanellus) und Uferschnepfe (Limosa limosa) zeigen seit 1980 Bestandsverluste von >50 %, Rotmilan (Milvus milvus), Feldlerche (Alauda arvensis) und Braunkehlchen (Saxicola rubetra) abnehmende Langzeittrends von >20 %. Auch die bis vor wenigen Jahren noch stabilen oder sogar leicht zunehmenden Bestände von Gebüsch- und Heckenbrütern der Agrarlandschaft wie der Goldammer (Emberiza citrinella) gehen neuerdings zurück. Diese besorgniserregende Situation der Avifauna gilt stellvertretend für Gefäßpflanzen, Heuschrecken, Schmetterlinge und viele andere Artengruppen.
Große Defizite bestehen auch beim Klimaschutz. Die Kohlenstoffsenkenfunktion der zentraleuropäischen Landschaft ist durch andauernde und vielfach sich verschärfende intensive Landnutzungen gefährdet. Schulze et al. (2009) treffen dazu folgende Aussagen: Durch den intensiven Ackerbau und die Entwässerung von Mooren werden jährlich 57Mio.t Kohlenstoff in Europa freigesetzt. Dagegen haben die bestehenden Grünländer durch die jährliche Bindung von 85 Mio.t Kohlenstoff/Jahr auf einer Fläche von 1,51 Mio. km² schon jetzt eine Bedeutung als Kohlenstoffsenke, die vor allem auf das Bindungspotenzial im Boden zurück zu führen ist. Weiterhin zeigt sich, dass die noch wesentlich stärker klimaschädlichen Lachgas- und Methanemissionen der intensiven Landwirtschaft (97Mio.t Kohlenstoff-Äquivalente aus Lachgas/Jahr und 67Mio.t Kohlenstoff-Äquivalente aus Methan) drastisch reduziert werden müssen. Die Europäische Kommission hat den Klimawandel daher auch als zentrale Herausforderung für die Agrarpolitik benannt.
Weiteres wichtiges Ziel der Europäischen Union ist die Umsetzung der WRRL. Oberflächengewässer und Grundwasser müssen bis zum Jahr 2015, spätestens 2027, in einen „guten ökologischen“ bzw. in einen „guten chemischen Zustand“ gebracht werden. Aufgrund eines übermäßigen Nährstoffeintrags, der vorwiegend aus intensiver Landnutzung stammt, wird in mehr als der Hälfte der europäischen Mitgliedsstaaten in Oberflächengewässern der „gute ökologische Zustand“ gemäß WRRL nicht erreicht (European Environmental Bureau 2010).
Zentrale Bedeutung für die Lösung der genannten Probleme ist die Frage, auf welche Weise unsere Kulturlandschaften künftig landwirtschaftlich genutzt und bewirtschaftet werden. Die Neuprogrammierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum 2013 bis 2020 kann ein entscheidender Schritt für eine nachhaltigere Landbewirtschaftung und für das Erreichen politischer Ziele der EU sein. Die Beschlüsse der 10. Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über die biologische Vielfalt Ende Oktober 2010 im japanischen Nagoya haben den Handlungsbedarf erneut unterstrichen: So sollen bis spätestens 2020 alle die Biodiversität schädigenden Subventionen beseitigt und stattdessen Anreizinstrumente für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt entwickelt und angewendet werden (Ziel A3 des Strategischen Plans für die Post-2010-Periode; Convention on Biological Diversity 2010).
In Deutschland gibt es von Seiten der Wissenschaft und von Verbänden weitreichende Vorschläge zur Verbesserung der GAP, z.B. vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) (2009) und von den so genannten „Plattform-Verbänden“ (Gemeinsames Papier 2010). Konkrete Verbesserungsvorschläge zur Weiterentwicklung der ersten Säule sowie der Förderprogramme der zweiten Säule der GAP wurden z.B. von NABU (2010) und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL 2010, DVL & NABU 2009) in die Diskussion eingebracht. Auf europäischer Ebene hat u.a. der Prozess der Agricultural and Rural Convention (ARC) das Ziel, die Debatte um die GAP zu intensivieren und um neue Visionen zu erweitern ( http://www.arc2020.eu ).
Aus Sicht der Unterzeichner der vorliegenden Stellungnahme kann die extensive Nutzung von Grünland in Form großflächiger naturnaher Weidesysteme einen erheblichen Beitrag zum Schutz von Artenvielfalt, Klima und Wasser leisten. Das Papier verdeutlicht diese zentrale Bedeutung für die künftige Ausgestaltung der GAP und formuliert erstmals Vorschläge, wie der Multifunktionalität der extensiven Beweidung bei der Ausgestaltung der GAP in der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 in der Praxis entsprochen werden sollte. Im Sinne einer multifunktionalen Landwirtschaft sollten alle Finanzmittel, welche künftig im Rahmen der GAP investiert werden, einen mehrfachen Nutzen zur Einkommensstützung der Landwirtschaft und für Ziele des Erhalts der Biodiversität, des Klima-, Boden- und Wasserschutzes haben; entsprechende Ziel- und Qualitätskriterien sind ausreichend konkret und hinsichtlich der Zielerreichung nachprüfbar zu definieren.
2 Win-win-Effekte durch naturnahe Beweidung
In vielen Landschaften Europas ist noch heute die standortgerechte, naturnahe Beweidung mit unterschiedlichen Tierarten und Tierrassen ein prägendes Element und Grundlage der Artenvielfalt (Pykälä 2000 und 2005, Veen et al, 2009, Wallis De Vries et al. 1998). Extensiv genutzte Weiden sind Lebensräume für viele gefährdete Arten der Agrarlandschaften. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass diese Landnutzungsform eine Schlüsselrolle zur Sicherung der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft hat (u.a. Bunzel-Drüke et al. 2008, Ruf et al. 2010). Die für den naturschutzfachlichen Erfolg entscheidenden Kriterien und konzeptionellen Rahmenbedingungen der Weideverfahren sind bekannt und umfassend beschrieben (Reisinger 2004). Es kann daher belastbar festgehalten werden, dass insbesondere ganzjährige und großflächige Beweidungsverfahren in der Lage sind, eine Vielzahl auch ehrgeiziger Naturschutzzielsetzungen zu erreichen (Pykälä 2005, Riecken et al. 2004).
Die naturnahe und standortangepasste Beweidung trägt zudem noch weitere Aspekte zu einem ausbalancierten Naturhaushalt bei: Sie ist im Vergleich zu den üblichen intensiven Grünlandnutzungsformen wesentlich klimafreundlicher. Sousanna et al. (2007) zeigen für wenig oder nicht gedüngte Weidesysteme mit Rindern, dass die Klimabilanzen auch unter Berücksichtigung der Lachgas- und Methan-Emissionen durch den Wiederkäuer positiv sind. Die aktuelle Studie von Gross et al. (2010) belegt, dass die intensiv gedüngten Saatgrünländer eine dreimal so hohe Lachgasemission wie die extensiv beweideten Prärieweiden haben. Die negativen Klimafolgen einer industrialisierten Stallhaltung, insbesondere auch unter Einbeziehung der Treibhausgase durch die Dünger- und Kraftfutterproduktion sowie Transportkosten, werden auch in einer Studie der FAO (2006) betont.
Beweidungsverfahren, welche die Vegetation nicht vollständig nutzen, reduzieren im Vergleich zur Mähnutzung die Emission von CO2 und Lachgas (Braun 2005, Willms et al. 2002). Setzt man extensive Weidesysteme unmittelbar mit der stallgebundenen Tierhaltung und dem Einsatz von Futter gedüngter Wiesen sowie Kraftfutter in Vergleich, so schneidet die Weidehaltung klimaschonender ab. Entsprechend empfiehlt Braun (2005), aus Klimaschutzgründen Weideland zu erhalten und neu zu schaffen.
Extensive Beweidung ist vor allem in Überschwemmungsgebieten und auf grundwassernahen Standorten die naturverträglichste Form der landwirtschaftlichen Nutzung und trägt zu einem intakten Wasserhaushalt bei (Gerken 2002, Schaich et al. 2009). Durch den Düngeverzicht wird im Vergleich zu intensiven Grünlandnutzungen eine Reduktion der Stickstoffbelastung für Grundwasser und Fließgewässer erreicht und leistet somit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Gewässerqualität. Die Umwandlung von Ackerflächen in beweidetes Extensivgrünland in Überschwemmungsgebieten ermöglicht weiterhin, die Auen wieder als natürliche Filter der Fließgewässer in Funktion zu setzen. Auch kann eine bessere Einbeziehung der Gewässerufer zur Redynamisierung von Fließgewässern erfolgen (Genetzke 2010, Gerken 2002, Krüger 2003). Naturnahe Weideverfahren in Auenlandschaften können ideale Instrumente zur Umsetzung der EU-WRRL sein. Aufgrund der geringen Besatzdichte sind keine Erosionsschäden zu erwarten. Vielmehr werden die Struktur- und Artenvielfalt positiv beeinflusst (Mann & Tischew 2010, Reisinger 2004). Auswirkungen auf die Gewässermorphologie und den Wasserhaushalt sind die Ausdifferenzierung kleiner Gewässerläufe und Initiierung von Eigenentwicklungen, in Teilbereichen eine Sohlanhebung, Unterdrückung von den Gewässerlauf festlegenden Ufergehölzen und insgesamt Beiträge zum verstärkten Wasserrückhalt in der Fläche durch Vernässungen (Luick 2001). Nach § 21 BNatSchG (2010) sind „die oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer Randstreifen, Uferzonen und Auen als Lebensstätten und Biotope für natürlich vorkommende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten“ und „so weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können“; auch dazu leistet die großflächige extensive Beweidung wichtige Beiträge. Weidelandschaften können ein Rückgrat jeder regionalen und überregionalen Biotopverbundplanung sein (Bunzel-Drüke et al. 2008).
Darüber hinaus gehören Weidetiere in vielen Regionen zur touristischen Visitenkarte und stehen für Erholung in attraktiven Kulturlandschaften und gesunder Umwelt (Luick 2001). Europaweit gesehen liegt der Schwerpunkt der ästhetisch ansprechenden Weidelandschaften oft in Gebieten, die nicht zu den Gunstlagen der Landwirtschaft gehören. Extensive Weidelandschaften können damit zur Sicherung von Einkommen und Arbeitsplätze in peripheren ländlichen Gebieten beitragen – Biodiversität als „stilles Kapital“ der Regionalentwicklung (Jedicke 2008).
Betriebe mit extensiver Weidetierhaltung stehen somit für eine moderne, multifunktionale Landwirtschaft, da sie der Gesellschaft zahlreiche öffentliche Güter kostengünstig zur Verfügung stellen und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die europäischen Herausforderungen zum Biodiversitäts-, Klima- und Gewässerschutz effektiv anzugehen (Luick et al. 2009). Es gibt also viele Argumente, die extensive Weidehaltung über die Gemeinsame Agrarpolitik aktiv zu fördern und innovativ zu unterstützen!
3 Weichenstellung durch den Europäischen Gerichtshof
In einem jüngst gefällten Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 14.10.2010 wird ausdrücklich festgestellt, dass die Zahlungen von Fördergeldern und Direktzahlungen auf allen landwirtschaftlich genutzten Flächen legitimiert sind, auf denen Naturschutz und Landschaftspflege vorrangige Ziele sind (EuGH 2010). Demnach sind künftig auch extensiv beweidete Flächen in vollem Umfang als förderfähige landwirtschaftliche Fläche zu werten, da die Beweidung, unabhängig von Art und Intensität, eine landwirtschaftliche Nutzung darstellt. Dies ist laut EuGH auch dann der Fall, wenn die Tätigkeit dieser landwirtschaftlichen Nutzung den Anweisungen der Naturschutzbehörden unterliegt. Das Urteil des EuGH macht deutlich, dass die EU-Mitgliedsstaaten (Vertragspartner für Deutschland sind die Bundesländer) extensive Weidesysteme, wie Heiden, Magerrasen oder Huteflächen, ohne weitreichende Sanktionsrisiken in die Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (z.B. Direktzahlungen, Agrarumweltprogramme, Landschaftspflegeprogramme) einpassen können. Diese neue Rechtsicherheit muss offensiv für die weitere Integration und Ausbau von Förderinhalten für weidetierhaltende Betriebe genutzt werden.
4 Beweidung in Förderarchitektur einpassen
Um Betrieben mit extensiver Weidetierhaltung zukunftsfähige Perspektiven zu ermöglichen, müssen unterstützende Maßnahmen als Querschnittsaufgabe in die Förderarchitektur der zukünftigen Gemeinsamen Agrarpolitik zielführend eingepasst werden. In den folgenden Abschnitten werden weitere Problemlagen und Lösungsvorschläge formuliert.
4.1 Förderfähigkeit in der 1. Säule der GAP
Bei der Integration von beweidetem Extensivgrünland in die erste Säule treten aktuell zahlreiche Probleme auf, die in vielen Fällen zur Ablehnung der Förderung beweideter Flächen oder zu erheblichen Sanktionsrisiken führen (DVL & NABU 2009).
Problem 1 – Weiden als beihilfefähige Flächen: Bei der Integration von beweidetem Extensivgrünland in die erste Säule treten in der aktuellen Förderperiode zahlreiche Unsicherheiten und Unklarheiten in Bezug auf die Beihilfefähigkeit von Heiden, gehölzreichen Hutungen, traditionellen Bergweiden sowie beweideten Übergangbereichen von Offenland zu Wald (sog. Ökotonen) auf, die in vielen Fällen zur Ablehnung der Förderung beweideter Flächen oder zu erheblichen Sanktionsrisiken führen.
Auch die naturschutzfachlich wertvollen extensiv beweideten Schilf- und Seggenbestände sowie Uferbereiche von temporären Gewässern werden in einigen Bundesländern von der Beihilfe ausgeschlossen. Das trifft auch auf viele beweidete ehemalige militärische Liegenschaften zu.
Lösungsansätze: Direktzahlungen müssen künftig ohne Ausnahme auf allen extensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen gewährt werden. Die Aktivierung von Zahlungsansprüchen auf diesen Flächen ist die Grundvoraussetzung für die nachhaltige Bewirtschaftung. Das Urteil des EuGH zur Förderung der extensiven Beweidung bildet für die Anerkennung der Flächen die Grundlage, minimiert die Anlastungsrisiken für die Landwirte und verringert den bürokratischen Aufwand. Dazu ist auf Ebene der Bundesländer das Bruttoflächenprinzip verbindlich anzuwenden. Die in Deutschland oft sehr eng interpretierte „Dauergrünland-Definition“ muss um alle beweideten Offenland-Lebensraumtypen wie Heiden, lückige Pionierfluren, Trockenrasen und Sauergrasbestände erweitert werden, auch wenn typische Weidegräser nicht dominieren. Alle temporären Gewässer sollten ebenfalls mit ihren beweideten Uferbereichen als prämienfähig anerkannt werden; dies gilt auch für temporär trocken fallende See-, Fließgewässer- und Grabenufer sowie durchweidete Röhrichte.
Traditionelle Waldweiden und halboffene Systeme müssen zukünftig ebenfalls in die Förderung der 1. Säule einbezogen werden. Hierzu bedarf es allerdings entsprechend positiver Auslegungen der Waldgesetzgebungen der Länder, denn Waldweide ist in der Mehrzahl der Bundesländer nicht generell verboten (Bunzel-Drüke et al. 2008). Eine Einbindung in die Förderung sollte darüber hinaus auch bei einer naturschutzfachlich begründeten Waldweide möglich sein, z.B. für die Umsetzung von Natura-2000-Erhaltungszielen oder besonderen Aspekten des Artenschutzes (z.B. Ziegenmelker, Auerhuhn und Orchideen). Hierzu sollen spezielle Flächenkulissen festgelegt werden. Auf ehemaligen militärischen Liegenschaften müssen ebenfalls Zahlungsansprüche aktivierbar sein, wenn die Kontrollfähigkeit hergestellt ist.
Problem 2 – unterschiedliche Flächencodes in den Bundesländern: Augenblicklich werden in 14 deutschen Bundesländern Extensivweiden mit sechs unterschiedlichen Flächencodes versehen. Dies bereitet bei der Kombination der Zahlungsansprüche mit Agrarumweltprogrammen zunehmend Probleme, da manche Vertragsvarianten nicht mit allen Nutzungscodes kompatibel sind. Durch Umcodierungen nach Vor-Ort-Kontrollen können Zahlungsansprüche nicht aktiviert oder die Ausgleichszulage nicht beantragt werden. Auch das ursprünglich gewählte Vertragspaket im Rahmen der Agrarumweltprogramme kann vom Landwirt nicht mehr erfüllt werden. Das Wegfallen der Agrarförderung und drohende Sanktionen können für den betreffenden Landwirt erhebliche finanzielle Konsequenzen haben.
Lösungsansätze: Die EU sollte für die Codierung von Extensivweiden für die Mitgliedsstaaten klare Vorgaben machen, um Fördermöglichkeiten deutlich aufzuzeigen und mögliche Sanktionsrisiken bei Landwirten zu vermindern.
Problem 3 – Landschaftselemente auf Weideflächen nach Cross Compliance (CC): Extensive Weidelandschaften sind häufig durch Sukzessions- und Verbuschungsstadien geprägt, die bis zu einem bestimmten Flächenanteil naturschutzfachlich gewünscht sind. Andererseits muss im Hinblick auf den Erhalt von Zielarten und offenen Lebensräumen die Reduzierung einer zu starken Verbuschung möglich sein. Zusätzlich ist durch den Einfluss von Weidetieren eine räumliche Verschiebung von Gehölzinseln zu beobachten. Eine dauerhafte Festlegung der Landschaftselemente ist deshalb nicht möglich.
Für Landwirte können sich aber sowohl durch einen erhöhten Verbuschungsgrad als auch durch das Beseitigungsverbot für CC-relevante Landschaftselemente Anlastungsrisiken ergeben. Es sind Verpflichtungen nach Cross Compliance zum Schutz von Landschaftselementen und zur Mindestinstandhaltung einzuhalten (sowohl auf landwirtschaftlichen als auch auf nicht-landwirtschaftlichen Nutzflächen), soweit auf einer Fläche Prämien aus der 1. und/oder 2. Säule gewährt werden oder die Fläche zumindest im Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) erfasst ist.
Lösungsansätze: Eine Lösung zeigt die EU bereits auf. So gibt es gemäß der VO (EG) 73/2009 (gemeinsame Regelungen für die Anwendung von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik) in Art. 34 (2) b) i) schon jetzt die Möglichkeit, auf den Nachweis einzelner Landschaftselemente zu verzichten und somit die Förderung extensiver Weideflächen zum Schutz der heimischen Biodiversität zu vereinfachen. Dies trifft aber nur für Natura-2000-Gebiete zu und wird in Deutschland augenblicklich nicht angewandt. Eine weitergehende Lösung wäre die Einführung eines eigenen einheitlichen Nutzungscodes für extensive Weiden. Die Kontrolle der Fläche könnte den Naturschutzbehörden unterliegen – die Zahl der Landschaftselemente und der Verbuschungsgrad werden dann allein nach naturschutzfachlichen Kriterien festgelegt und von der gängigen CC-Kontrolle ausgenommen. Ein akzeptabler Schwellenwert wäre die Tolerierung von bis zu 30 % Anteilen an verbuschten Flächen. Bei der Berechnung des Verbuschungsgrades ist die gesamte bewirtschaftete Fläche bzw. der gesamte Feldblock zu berücksichtigen
4.2 Weiterentwicklung und Anpassung der 2. Säule der GAP: Agrarumweltmaßnahmen
Die zweite Säule der GAP ist für einen zielgerichteten Schutz des Klimas, der Biodiversität und der Gewässer durch die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung. Zu den wichtigsten Förderprogrammen zählen die Agrarumweltmaßnahmen (AUM). Sie müssen fachlich zielgerichtet weiterentwickelt und finanziell zuverlässig ausgestattet werden. Folgende Verbesserungen werden vorgeschlagen:
Kofinanzierung: Im Hinblick auf die ökosystemar positiven Leistungen sollten eindeutig definierte extensive Formen der Beweidung mit einer Kofinanzierung von 90 % EU-Geldern in der Förderpolitik der EU-Staaten und der Bundesländer verankert werden. Mit der Anhebung der Fördersätze für hocheffektive Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität, des Klimas und des Wasserhaushalts wird es auch finanzschwachen Bundesländern und Mitgliedsstaaten ermöglicht, attraktive Förderprogramme anzubieten.
Einführung verpflichtender Maßnahmen: In Europa sollten im Bereich Agrarumweltmaßnahmen folgende Inhalte verpflichtend angeboten werden (siehe auch Maßnahmen im Anhang):
(a) Beweidung als Maßnahme zur Extensivierung bisher intensiv genutzter Flächen (z.B. Umwandlung Acker in Grünland bzw. Weideland). Mit dieser Maßnahme soll erreicht werden,
– dass sich die Weidetierhaltung auch in Landschaften etabliert, die bisher nicht zu den Naturschutzschwerpunktgebieten zählen,
– dass auf organischen Böden und in Überschwemmungsgebieten die Ackernutzung zurückgedrängt wird und Flächen mit extensiver Beweidung entwickelt werden können.
(b) extensive Weidenutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume (z.B. Trockenrasen, Niedermoore, Heiden, Salzwiesen, Waldweiden, artenreiches Grünland). Ziel dieser Maßnahme ist, den Status quo in wichtigen Naturschutz-Schwerpunktgebieten zu sichern. Dafür wird folgende Flächenkulisse vorgeschlagen: Natura-2000-Gebiete, Kohärenzflächen, Überschwemmungsflächen sowie ausgewählte Hotspots der Biodiversität außerhalb von Natura-2000-Gebieten.
Vertragslaufzeiten: Landwirtschaftliche Betriebe müssen langfristig in die Weidehaltung investieren (Weidelogistik, Tiere etc.). Es muss daher eine zuverlässige nachhaltige Finanzierung der Maßnahmen gewährleistet werden. Den landwirtschaftlichen Betrieben müssen somit langfristige Verträge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit angeboten werden.
Anreizkomponente: Die Freiwilligkeit bei der Anwendung der Agrarumweltprogramme ist wesentlicher Bestandteil der kooperativen Umsetzung von Natur- und Umweltschutz, impliziert aber die Notwendigkeit eines finanziellen Anreizes für den Landwirt. Wie Erfahrungen aus der Praxis zeigen, sind Landwirten wichtige Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Beweidung kaum vermittelbar, wenn ihnen nur der Ertragsausfall und die Erschwernis entgolten wird, sie aber keinen Gewinn erzielen. Darüber hinaus ergeben sich für die an Agrarumweltprogrammen teilnehmenden Landwirte zusätzliche Kontrollen mit Sanktionsrisiken. Zentraler Bestandteil bei der Kalkulation der Förderhöhe muss deshalb neben Ertragsausfall und Arbeitsaufwand ein Akzeptanzzuschlag sein.
Minimierung von Auflagenüberschneidungen: In vielen Schutzgebieten und auch auf Ankaufflächen, die mit öffentlichen Geldern gefördert wurden, können aufgrund bestehender Schutzgebiets- oder Pflegevorgaben oft bestimmte Leistungen der Landwirte nicht gefördert werden. Dazu zählen z.B. der Verzicht auf Dünger und Pflanzenschutzmittel oder die Ganzjahresbeweidung. Dies führt zur Reduktion der Fördersätze und somit zu erheblichen Akzeptanzproblemen für Naturschutzmaßnahmen bei den Landwirten. Auch in derartigen Gebieten muss die Förderung in adäquater Höhe sichergestellt werden können. Hier sollten erfolgsorientierte Komponenten eingeführt oder pauschale Förderungen auf diesen Flächen (ähnlich dem Art.38 ELER-VO zur Natura-2000-Förderung) in gleicher Höhe zu den herkömmlichen Agrarumweltmaßnahmen angeboten werden, so dass bei vergleichbaren Maßnahmen auf keinen Fall niedrigere Fördersätze als im Rahmen der Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen ausgereicht werden.
Integration in die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK): Maßnahmen zur extensiven Beweidung müssen generell in den Förderrahmen der GAK der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden, um die Kofinanzierung zur Umsetzung prioritärer Ziele der EU in den deutschen Bundesländern zu sichern.
4.3 Weiterentwicklung und Anpassung der 2. Säule der GAP: Landschaftspflegeprogramme
Parallel zu der Weiterentwicklung der Agrarumweltprogramme müssen der Ausbau und die Weiterentwicklung des Art.57 ELER-VO „Erhalt des natürlichen Erbes“ auf EU-Ebene erfolgen und über so genannte „Landschaftspflegeprogramme“ in allen Bundesländern etabliert werden. Im Zentrum der Förderung stehen dabei Ziele des Natur- und Klimaschutzes sowie der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte muss in Landschaftspflegeprogramm kein betriebliches Kernziel sein. Die Förderung durch Landschaftspflegeprogramme erfolgt nicht flächenorientiert über feste Vertragslaufzeiten (wie z.B. beim Vertragsnaturschutz), sondern maßnahmenorientiert mit flexiblen Laufzeiten. Die Umsetzung von Landschaftspflegeprogrammen sollte für die Mitgliedsstaaten und Bundesländer verpflichtend und dauerhaft eingeführt werden.
Auch spezielle Inhalte zur Förderung der extensiven Beweidung, wie z.B. die Beweidung extrem steiler oder verbuschter Flächen sowie Entbuschungen als vorbereitende Maßnahmen für die spätere Integration der Flächen in die Agrarumweltmaßnahmen, müssen förderfähig sein. Investitionen in Weidelogistik (Einrichtung von Tränken, Fanggatter, Zaunbau, Weidetore, Bau von Weideunterständen) sollen ebenfalls in diese Förderschiene fallen. Wichtig ist weiterhin, dass die Erstellung von Weidemanagementplänen und die Anschaffung und Haltung bedrohter Weidetierarten und -rassen förderfähig sind.
Eine wichtige Forderung in diesem Kontext ist auch die Kombinationsmöglichkeit von Maßnahmen aus Landschaftspflegeprogrammen mit Bausteinen der Agrarumweltprogramme und mit Förderungen aus der 1. Säule auf identischen Flächen. Ein konkretes Beispiel sind die notwendigen Pflegearbeiten auf Extensivweiden.
5 Beratung
Für weidetierhaltende Betriebe ist eine umfassende Betriebsberatung von zentraler Bedeutung. Besonders die Teilnahme an Agrarumweltprogrammen und deren Verzahnung mit anderen Förderbereichen, wie Direktzahlungen und Landschaftspflegeförderung, müssen gezielt bei Landwirten beworben und deren Umsetzung administrativ begleitet werden. Erfahrungen aus Österreich zeigen, dass aufgrund von Beratungen deutlich mehr Landwirte an Naturschutzmaßnahmen teilnehmen (36 % der Landwirte) als ohne Beratung (nur 5 %; Suske 2009). Eine kompetente Beratung erhöht also die Akzeptanz bei den Landwirten für Naturschutzbelange und Förderprogramme des Naturschutzes. Sie verbessert weiterhin die Effektivität bei der Implementierung von Förderprogrammen und verringert die Anlastungsrisiken für Landwirte bei der Programmbeantragung. Im Sinne einer umfassenden Beratung sollten nicht allein naturschutzfachliche Zielsetzungen, sondern zugleich Aspekte von Bodenschutz, Wasserschutz (insbesondere Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz und Flurneuordnung abgedeckt werden. Die Flurneuordnung mit ihren verschiedenen Instrumenten, wie z.B. dem freiwilligen Flächen(nutzungs)tausch, bietet gute Hilfestellungen, um ausreichend große und zusammenhängende Weideflächen zu schaffen. Da für die Akzeptanz der Landwirte letztlich wirtschaftliche Aspekte entscheidend sind, sollte eine betriebswirtschaftliche individuelle Beratung auch ökonomische Aspekte (z.B. Produktion, Vermarktung, Werbung) sowie Beratung im Hinblick auf überbetriebliche Kooperationen (z.B. Weidegemeinschaften) berücksichtigen. Eine derart integrative Beratung kann auch die Erarbeitung von Weidemanagementplänen umfassen.
Die einzelbetriebliche Beratung sollte entweder durch die länderspezifischen Agrarverwaltungen bzw. Landwirtschaftskammern sichergestellt oder von externem Fachpersonal übernommen werden und förderfähig sein.
Die EU sollte daher darauf hinwirken, dass eine umfangreiche Beratung weidetierhaltender Betriebe zur effektiveren Vermittlung in die Programmplanung der Länder zwingend integriert und finanziert wird.
6 Änderungen weiterer Rahmenbedingungen
Tierhaltungsbestimmungen sind bisher vor allem auf konventionelle und intensive Stallhaltungsverfahren ausgerichtet, bei denen ein unproblematischer Zugang zu einer großen Zahl von Tieren gewährleistet ist. Ihre Anwendung auf mehr oder weniger wild gehaltene Robustrassen in halboffenen großflächigen Weidelandschaften und auf die Hüteschäferei ist sowohl für die Weidetiere als auch den Bewirtschafter aufwändig und sogar unmöglich. Nach unserer Auffassung kann die derzeitige Regelungsdichte deutlich reduziert werden, ohne gleichzeitig den Standard bei Lebensmittelsicherheit und Veterinärhygiene abzusenken. Folgende Verbesserungen für tierhaltende Betriebe werden gefordert:
Tierkennzeichnung: Nach der Viehverkehrsverordnung (2010) muss jedes in Deutschland geborene Kalb oder Lamm innerhalb von sieben Tagen nach der Geburt mit zwei Ohrmarken markiert und der nationalen HI-Tier-Datenbank (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere; http://www.hi-tier.de ) unter Angabe von Geschlecht, Rasse etc. gemeldet werden. Die Tierkennzeichnung bei Rindern, Büffeln, Wisent und Bison ist in großflächigen Weidegebieten mit großen Schwierigkeiten und Gefahren für die Halter verbunden. Dies ist auch vor dem Hintergrund der ab 01.11.2011 zu verwendenden neuen Ohrmarken mit Gewebestanzprobe für die Kontrolle auf Bovine Virusdiarrhoe (BVD) zu sehen, die eine weitere Verschärfung der aktuellen Regelung mit sich bringt.
Für großräumige Beweidung ist die von der EU-Kommission vorgesehene Ausnahmeregelung (Entscheidung 2006/28/EG) für eine Verlängerung/Flexibilisierung der „Sieben-Tage-Regelung“ (Viehverkehrsverordnung) zur Kennzeichnung Rinderartiger (Bison, Wasserbüffel, Zebu, Hausrind) oder Schafe und Ziegen in Anwendung zu bringen. Diese kann z.B. eine Kennzeichnung erst mit Verlassen des Bestandes bzw. der Mutterherde oder für definierte Gebiete vorsehen. Eine entsprechende Ausnahmeregelung für die Identifizierung bestimmter „Pferdeartiger“ (Verordnung EG-Nr. 504/2008) nach Artikel 7 sollte ebenfalls für großräumige Weidelandschaften in Anwendung gebracht werden. Als Kriterien für die Gewährung der Ausnahmetatbestände werden vorgeschlagen:
– zusammenhängende Weidegebiete in der Regel >40 ha (in Ausnahmefällen, z.B. auf stark vernässten Flächen, Untergrenze >10ha);
– Ganzjahresbeweidung;
– die Beweidung dient dem Naturschutz, eine Bescheinigung der Notwendigkeit für den Naturschutz wird von der zuständigen Naturschutzbehörde ausgestellt.
veterinär-medizinische Überwachung: In Bezug auf die Bekämpfung von Tierseuchen existiert derzeit keine Möglichkeit, von den bestehenden, auf konventionelle Tierhaltung ausgerichteten Vorschriften des Tierseuchengesetzes (TierSG) abzuweichen. Jedes 24 Monate alte Rind muss jährlich geblutet und auf BHV-1 und alle drei Jahre auf Brucellose und Leukose untersucht werden. Im Zuge der BVD-Kontrollpflicht bei bis zu sechs Monate alten Kälbern kommt ab dem 01.11.2011 eine weitere Erschwernis hinzu (s.o. Gewebestanzprobe). Erleichterung könnte eine Flexibilisierung der Fristen bringen. Bei BHV-1-freien Rinderbeständen (Bovines Herpesvirus Typ 1), die nicht in Kontakt mit Tieren aus anderen Beständen stehen, könnte die Möglichkeit eröffnet werden, dass eine Blutuntersuchung lediglich vor Verlassen des Bestandes erforderlich ist bzw. diese Tiere mit Verlassen in Quarantäne zu stellen sind, bis die Blutproben vorliegen. Bei Zoonosen (Brucellose, Leukose, Tuberculose) könnten jährliche Stichproben den Herdenstatus zuverlässig wiedergeben.
Schlachten: Die Tötung landwirtschaftlicher Nutztiere erfolgt in Deutschland mit Ausnahme von Hausschlachtungen in speziellen EU-zugelassenen Schlachtstätten. Dies erfordert ein Verladen und Transportieren der lebenden Tiere, was unter Gesichtspunkten des Tierschutzes und der Nahrungsmittelqualität (Ausschüttung von Stresshormonen mit negativen Folgen für die Fleischqualität) vor allem bei den halbwilden Weidetieren unvertretbar ist. Die Tiere sind weder die Nähe des Menschen noch beengte Raumverhältnisse gewöhnt und lassen sich daher nur unter Schwierigkeiten verladen. Das Betäuben bzw. Töten (mit Kugelschuss) von ganzjährig im Freien gehaltenen Weidetieren in ihrem Lebensraum bietet dagegen gegenüber anderen Praktiken aus Gründen der Arbeitssicherheit sowie des Tier- und Verbraucherschutzes deutliche Vorteile.
Derzeit ist aber festzustellen, dass die in der Anwendung der EU-Hygienebestimmungen von der EU-Kommission gewünschte „Flexibilisierung“ durch die in Deutschland mit der Umsetzung betrauten unteren Behörden bei den Landratsämtern nicht hinreichend praktiziert wird. Stattdessen erschweren strenge Auflagen, die häufig nicht den Vorgaben des EU-Hygienepaketes entsprechen, sondern sich vielmehr auf das alte Fleischhygienerecht (FlHV) beziehen, die Umstände in der Praxis im Hinblick auf die Schlachtung sowie die Verwertung und Vermarktung von Fleisch aus Extensivbeweidungsprojekten.
Die Praxis der Schlachtung im Herkunftsbetrieb, insbesondere das Verfahren des Kugelschusses auf der Weide, sollte nachhaltig gestärkt werden und muss auf EU-Ebene im Anhang III Abschnitt III der VO 853/2004/EG insbesondere für Huftiere der Gattung Rind, die in Mutterkuh- oder extensiver Weidehaltung oder zur Landschaftspflege gehalten werden, aufgeführt sein. Weiter sollte bis zur Notifizierung durch die EU-Kommission eine Regelung durch das BMELV auf nationaler Ebene nach Artikel 10 Absatz 3 der VO 853/2004/EG erlassen werden.
Um das Verfahren sicher, hygienisch einwandfrei und tierschutzgerecht durchzuführen, laufen die ersten Vorbereitungen zur Erarbeitung und Entwicklung prozessorientierter Leitlinien durch mehrere Institutionen in Zusammenarbeit mit Landwirten, Metzgern, Veterinären und Wissenschaftlern, die im Jahr 2012 fertig gestellt werden. Einen wesentlichen Aspekt bilden die mobilen Schlachtboxen, die als Bestandteil der Schlachtstätte anzuerkennen sind.
Tierkadaver: Bei Todesfällen unter den Weidetieren fordert das Tierische Nebenprodukts-Beseitigungsgesetz (TierNebG) die zügige Entsorgung der Kadaver über Tierkörperbeseitigungsanstalten und – insbesondere bei Rindern – die umgehende Abmeldung des Tieres aus dem HI-Tier. Schon auf kleineren Weidearealen (<100ha) können in der Praxis Probleme auftreten; in Weidesystemen, die mehrere 100ha umfassen können, sind sie im Grunde nicht vermeidbar: Einzelnen Tiere können verschollen gehen, Ohrmarken sind zum Zeitpunkt des Kadaverfundes bereits verschwunden oder die Kadaverentsorgung bzw. der Reste ist problematisch.
Zudem haben Tierkadaver eine große und völlig unterschätzte ökosystemare Bedeutung (Krawczynski & Wagner 2008). Aus Naturschutzgründen, z.B. zum Schutz zahlreicher hochbedrohter Wirbelloser und Greifvögel, wäre es sehr wünschenswert, von Medikamenten freie Großtierkadaver in der Landschaft zu belassen. In großflächigen Weidelandschaften sollte das auch in Deutschland, ähnlich wie in den Niederlanden, unter strengen Richtlinien und mit wissenschaftlicher Überwachung möglich sein. Hierdurch könnten die Praktikabilität großflächiger Beweidungsprojekte verbessert, neue Erkenntnisse zu bestehenden oder nur vermuteten Ausbreitungsrisiken gesammelt und zugleich ein wertvoller Beitrag zum Artenschutz geleistet werden. Die EU-Verordnung 1774/2002 (Europäisches Parlament 2002) ermöglicht Ausnahmeregelungen, die in Einzelfällen die Einrichtung von „Luderplätzen“ bzw. in streng begrenzten Ausnahmefällen die Belassung von Kadavern im Gebiet zulässt.
Dank
Der Naturstiftung David, Erfurt, danken die Autoren für die finanzielle Unterstützung des Diskussionsprozesses, als dessen Ergebnis das vorliegende Papier entstand.
Literatur
Braun, M.D. (2005): Spatial and temporal variation on greenhouse gas flux as affected by mowing on grasslands of Hummocky terrain in Saskatchewan. Master-Thesis, University of Saskatchewan/CA, 113pp. ( http://library2.usask.ca/theses/available/etd-09132005-104448/ ).
Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, C., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung – „Wilde Weiden“. Arb.gem. Biol. Umweltschutz Kreis Soest e. V., Bad Sassendorf-Lohne.
Convention on Biological Biodiversity (ed., 2010): COP 10 Outcomes. Decisions (Advance Unedited Texts). http://www.cbd.int/nagoya/outcomes/ (08.11.2010).
Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL, 2010): Entwicklung vielfältiger Kulturlandschaften eine zentrale Aufgabe. Stellungnahme zur GAP 2013. http://www.lpv.de .
–, Naturschutzbund Deutschland (2009): Integration naturschutzfachlich wertvoller Flächen in die Agrarförderung – Fallstudien zu den Auswirkungen der Agrarreform. DVL, Schr.-R. „Landschaft als Lebensraum“ 16.
Europäische Kommission (2009): Zusammenfassender Bericht über den Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen gemäß Artikel 17 der Habitatrichtlinie. KOM (2009), 358.
– (2010): Eurostat, Index weit verbreiteter Vogelarten – Gemeine Feldvogelarten. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7971b30e6283ab01c72814090bf20c12cfac86437.e34RaNaLaN0Mc40LcheTaxiLbN8Ne0?tab=table&plugin=1&pcode=tsdnr100&language=de .
Europäischer Gerichtshof (2010): Urteil vom 14.10.2010 – Rechtssache C-61/09.
Europäisches Parlament (2002): Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte – Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des europäischen Parlaments und des Rates. Amtsbl. EG L273, 1-95 (10.10.2002).
European Environmental Bureau (2010): 10 years oft the Water Framework Directive: A toothless tiger? http://www.eeb.org/?LinkServID=B1E256EB-DBC1-AA1CDBA46F91C9118E7D&showMeta=0 .
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2006): Livestock’s Long Shadow - Environmental Issues and Options. Rome.
Gemeinsames Papier von Verbänden aus Umwelt- und Naturschutz (2010): Landwirtschaft, Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz und Tierschutz. Für eine grundlegende Reform der EU-Agrarpolitik. http://www.die-bessere-agrarpolitik.de .
Genetzke, K. (2010): Auswirkungen extensiver Rinder-Beweidung auf Gewässer- und Uferstrukturen kleiner Fließgewässer. Unveröff. Dipl.-Arb., Univ. Würzburg, Institut für Geographie, 95S.+ Anh.
Gerken, B. (2002): Was hat die Renaturierung von Auen mit der Wirkung großer Säugetiere zu tun? Artenschutzreport 12, Jena, 42-48.
Barrierefreiheit Menü
Hier können Sie Ihre Einstellungen anpassen:
Schriftgröße
Kontrast

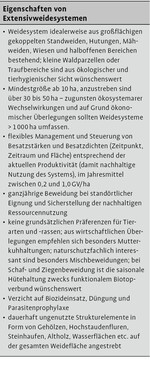





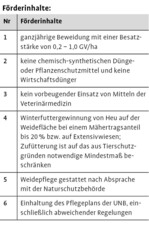
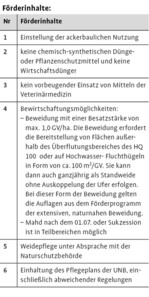
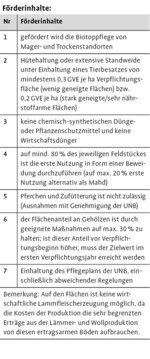
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.